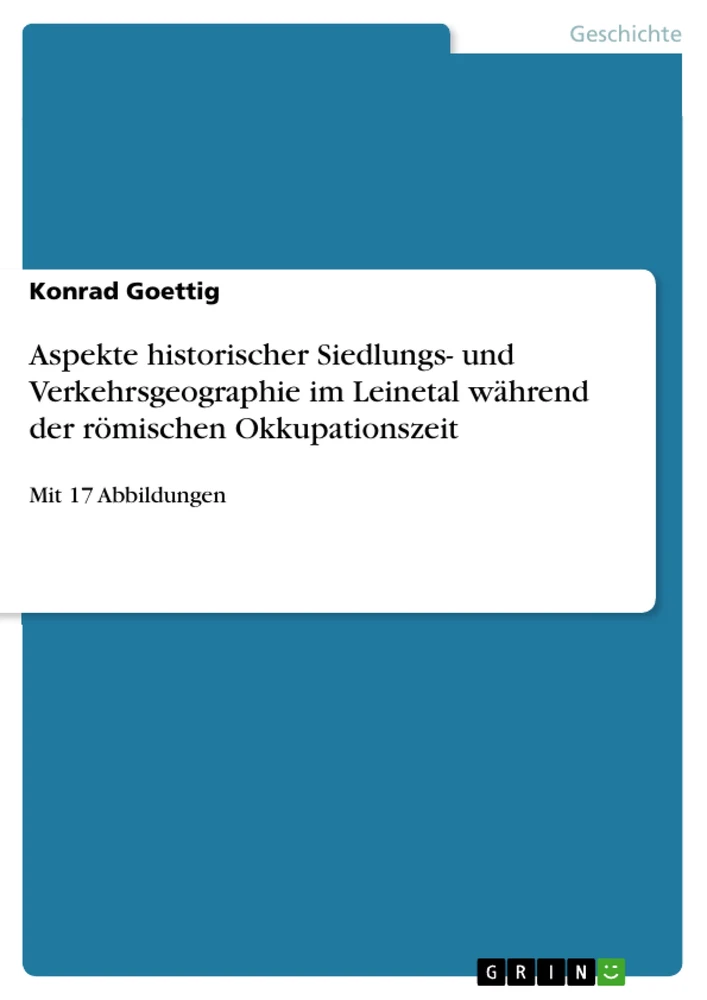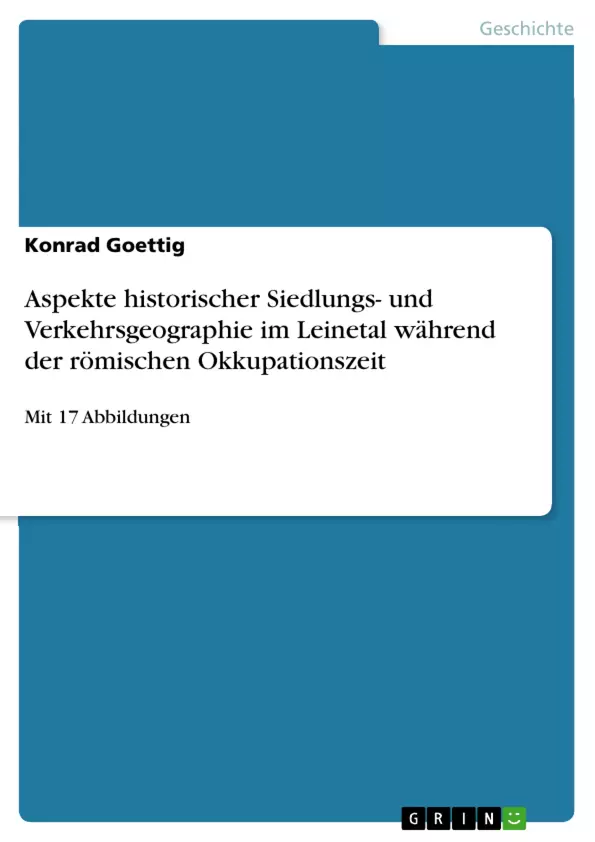Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit historischen verkehrs- und siedlungsgeographischen Aspekten im südlichen und mittleren Leinetal während des Zeitraumes, der allgemein als "Römische Kaiserzeit" bezeichnet wird. Im Mittelpunkt steht die Rekonstruktion der damaligen Hauptverkehrswege, die auch von den römischen Invasoren während der Okkupationsphase in Germanien (12 v. Chr. bis 16 n. Chr.) benutzt worden sein können. Diese Verkehrswege scheinen während der nachfolgenden Phasen römischer Präsenz in diesem Gebiet weiter ausgebaut und gesichert worden zu sein.
Da die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur auch damals nicht ohne einen Bezug zu den Siedlungen der hier lebenden Menschen betrachtet werden kann, erfolgen auch Hinweise auf das Siedlungswesen und die Siedlungsstruktur im Leinetal, die im Zusammenhang mit den Verkehrsleitlinien gesehen werden müssen. Deutlich werden soll, dass Germanien in der Römischen Kaiserzeit eher durch offene Landschaften geprägt war als durch dichte Wälder, Sümpfe und Moore, die nur in bestimmten Regionen des Landes kennzeichnend waren. Zum anderen soll klar werden, dass es ein enges Netz von Wegeverbindungen und regelrechte Fernstraßen in der damaligen Landschaft gab, die teilweise weit in die urgeschichtliche Vergangenheit hineinreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Die naturräumlichen Gegebenheiten des südniedersächsischen Berglandes und des Leinetals
- Geologie und Topographie
- Böden
- Hydrologie
- Klima
- Rezentes Klima
- Klima während der Römischen Kaiserzeit
- Ressourcen und Bodenschätze
- Eisenerz
- Salz
- Germanen in Südniedersachsen
- Stämme
- Ethnogenese, Ethnizität und Ethnographie
- Siedlungsräume und Siedlungswesen während der Römischen Kaiserzeit
- Siedlungswesen, Hausbau und Siedlungsweise
- Landwirtschaft und Handel
- Frühe Verkehrswege
- Landschaft und Verkehrswege in Germanien
- Okkupationszeitlich genutzte Verkehrs- und Kommunikationsstrukturen im Leinetal
- Unterwegs auf vorgeschichtlichen Wegen
- Ausblick
- Katalog römischer Münz-, Metall- und Terra sigillata-Fund im Leinetal
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit widmet sich der Erforschung historischer Verkehrs- und Siedlungsgeographischer Aspekte im Leinetal während der Römischen Kaiserzeit. Im Fokus steht die Rekonstruktion der damaligen Hauptverkehrswege, die von römischen Invasoren während der Okkupationsphase in Germanien genutzt wurden. Die Arbeit untersucht, wie diese Verkehrswege während der späteren Phasen römischer Präsenz weiter ausgebaut und gesichert wurden.
- Die naturräumlichen Gegebenheiten des südniedersächsischen Berglandes und des Leinetals
- Die Rolle der Germanen in Südniedersachsen während der Römischen Kaiserzeit
- Das Siedlungswesen und die Siedlungsstruktur im Leinetal während der Römischen Kaiserzeit
- Frühe Verkehrswege im Leinetal und ihre Bedeutung für die römische Okkupation
- Der Einfluss römischer Präsenz auf die Landschaft und das Verkehrssystem des Leinetals
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die naturräumlichen Gegebenheiten des südniedersächsischen Berglandes und des Leinetals, inklusive Geologie, Topographie, Böden, Hydrologie und Klima. Das zweite Kapitel beleuchtet die Rolle der Germanen in Südniedersachsen, einschließlich ihrer Stämme und der Ethnogenese, Ethnizität und Ethnographie. Das dritte Kapitel analysiert Siedlungsräume und Siedlungswesen im Leinetal während der Römischen Kaiserzeit, inklusive des Hausbaus und der Landwirtschaft sowie Handel. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit frühen Verkehrswegen, mit Fokus auf die Landschaft und Verkehrswege in Germanien sowie den Okkupationszeitlich genutzten Verkehrs- und Kommunikationsstrukturen im Leinetal und den vorgeschichtlichen Wegen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Schlüsselthemen wie die Römische Kaiserzeit, Verkehrswege, Siedlungswesen, Germanen, südniedersächsisches Bergland, Leinetal, Ethnogenese, Ethnizität, Ethnographie, Okkupation, Landschaft, Geographie, Geschichte, Archäologie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte das Leinetal für die Römer?
Es diente als wichtige Verkehrs- und Kommunikationsachse während der Okkupationsphase (12 v. Chr. bis 16 n. Chr.).
War Germanien damals nur von dichten Wäldern bedeckt?
Nein, die Arbeit zeigt, dass die Landschaft eher durch offene Räume und ein bestehendes Netz von Fernstraßen geprägt war.
Welche Ressourcen machten das Leinetal attraktiv?
Besonders wichtig waren Vorkommen von Eisenerz und Salz.
Wie lebten die Germanen im Leinetal?
Die Arbeit beschreibt das Siedlungswesen, den Hausbau und die landwirtschaftlichen Strukturen dieser Zeit.
Gibt es archäologische Beweise für die römische Präsenz?
Ja, die Arbeit enthält einen Katalog von Funden wie römischen Münzen, Metallgegenständen und Terra Sigillata.
- Quote paper
- Konrad Goettig (Author), 2020, Aspekte historischer Siedlungs- und Verkehrsgeographie im Leinetal während der römischen Okkupationszeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947773