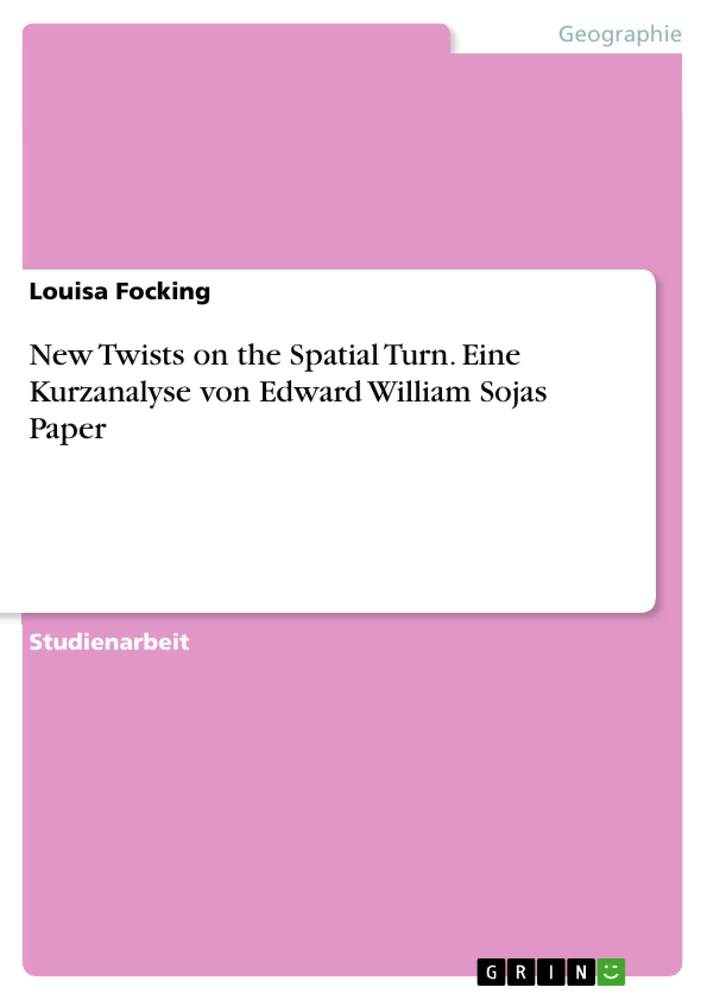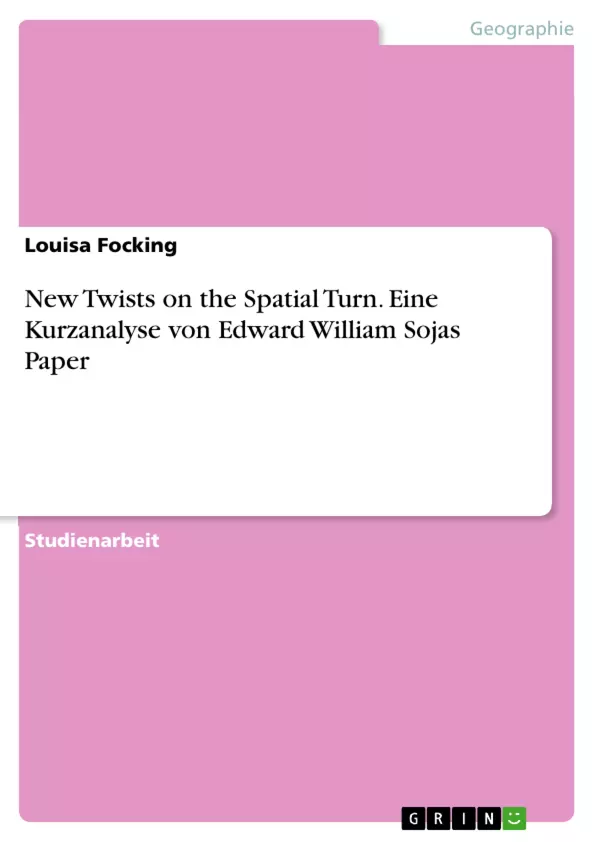Im gesamten Verlauf des analysierten Papers wird der Spatial Turn aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Des Weiteren geht es um verschiedene Dimensionen des Räumlichen und vor allem, wie sich diese heutzutage durch einen Paradigmenwechsel innerhalb vieler Sozial- und Geisteswissenschaften erweitern. Außerdem wirft Soja in dem Paper die Frage auf, wie Raum neu gedacht und verstanden werden muss, um ihn entsprechend zu erforschen und zu verstehen.
Das Ziel hierbei soll es sein, Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten aufzuarbeiten und durch politische Prozesse zu vermeiden. Ein weiteres wichtiges Thema stellen Ontologie und Epistemologie dar, die im Folgenden noch genauer erläutert werden. Das Leitthema besteht neben dem Spatial Turn in dem Verhältnis zwischen Zeit und Raum bzw. Historismus und Raumverständnis. Hierbei bezieht sich Soja vor allem auf Michel Foucault und Henri Lefebvre, die "[b]eide […] der Auffassung [sind], dass räumliches Denken genauso wichtig sei wie historisches Denken"(SOJA 2008: 250).
Abschließend sollen einige Rezensionen die Inhalte und Ergebnisse des Papers kritisch bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- Vom,,Zeitgeist\" zum „,,Raumgeist\". - New Twists on the Spatial Turn..
- Bisherige Veröffentlichungen von Edward William Soja
- Vorstellung des Papers
- Erläuterung zur Wahl des vorliegenden Papers
- Kernaussagen des Autor in der vorliegenden Veröffentlichung
- Rezensionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Paper „Vom „Zeitgeist“ zum „Raumgeist“. – New Twists on the Spatial Turn“ von Edward W. Soja befasst sich mit dem Spatial Turn und dessen Bedeutung für die Geographie und andere Sozialwissenschaften. Soja beleuchtet die Entwicklung des Raumverständnisses und die Bedeutung räumlicher Analysen für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen.
- Die Relevanz des Spatial Turn für das räumliche Denken
- Die Verzerrung von Ontologie und Epistemologie in den letzten 150 Jahren
- Die Bedeutung des Spatial Turn für die Politisierung von Raum
- Das Verhältnis von Raum und Zeit im Kontext des Spatial Turn
- Die Rolle von Michel Foucault und Henri Lefebvre für Sojas Raumverständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Das Paper beginnt mit einer Einführung in Edward W. Sojas bisherigen Forschungsarbeiten und seiner Rolle als Mitbegründer des Spatial Turn. Sojas Trilogie urbaner Studien, „Postmodern Geographies“, „Thirdspace“ und „Postmetropolis“, werden vorgestellt und ihre Relevanz für die Analyse von Raum und Gesellschaft erläutert. Anschließend wird das Paper selbst vorgestellt und seine Bedeutung für Sojas späteres Werk „Seeking Spatial Justice“ hervorgehoben.
Im weiteren Verlauf des Papers analysiert Soja die Ontologie und Epistemologie des Spatial Turn und beleuchtet die Verzerrung dieser Konzepte in den letzten 150 Jahren. Er geht auf die Bedeutung des räumlichen Denkens im Kontext von Zeit und Geschichte ein und bezieht sich dabei auf die Arbeiten von Michel Foucault und Henri Lefebvre. Soja argumentiert, dass räumliches Denken genauso wichtig ist wie historisches Denken, um die Herausforderungen der heutigen Zeit zu verstehen und zu bewältigen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieses Papers sind Spatial Turn, Raum, Zeit, Ontologie, Epistemologie, Politisierung, Geographie, Sozialwissenschaften, Urbanisierung, Postmoderne, Michel Foucault, Henri Lefebvre, Edward W. Soja.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „Spatial Turn“?
Der Spatial Turn bezeichnet einen Paradigmenwechsel in den Geistes- und Sozialwissenschaften, bei dem der Raum als zentrale Analysekategorie neben der Zeit an Bedeutung gewinnt.
Wer ist Edward William Soja?
Edward W. Soja war ein bedeutender Geograph und Mitbegründer des Spatial Turn, bekannt für seine Werke zur postmodernen Geographie und zum „Thirdspace“.
Welche Rolle spielen Foucault und Lefebvre in Sojas Theorie?
Soja bezieht sich auf beide Denker, da sie argumentierten, dass räumliches Denken für das Verständnis gesellschaftlicher Machtstrukturen genauso wichtig sei wie historisches Denken.
Was ist das Ziel der Politisierung des Raumes?
Das Ziel ist es, räumliche Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten (Spatial Justice) aufzuarbeiten und durch politische Prozesse zu korrigieren.
Wie hängen Ontologie und Epistemologie mit dem Raum zusammen?
Soja kritisiert, dass in den letzten 150 Jahren das historische Denken das räumliche Denken in der Wissenschaft verdrängt hat, was zu einer verzerrten Wahrnehmung der sozialen Realität führte.
- Citar trabajo
- Louisa Focking (Autor), 2020, New Twists on the Spatial Turn. Eine Kurzanalyse von Edward William Sojas Paper, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947910