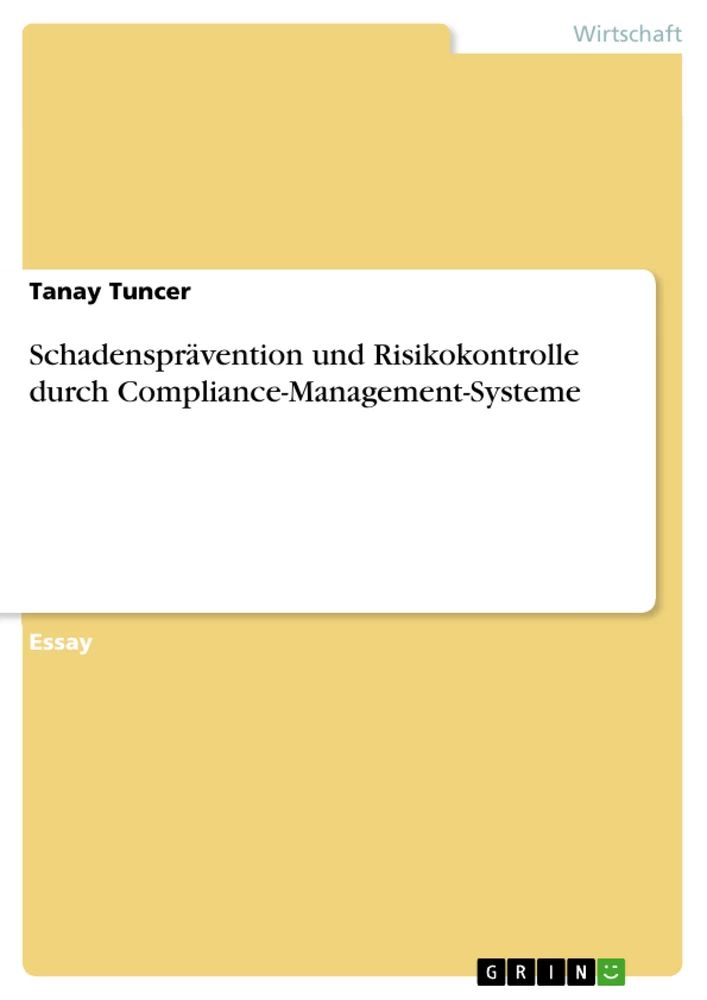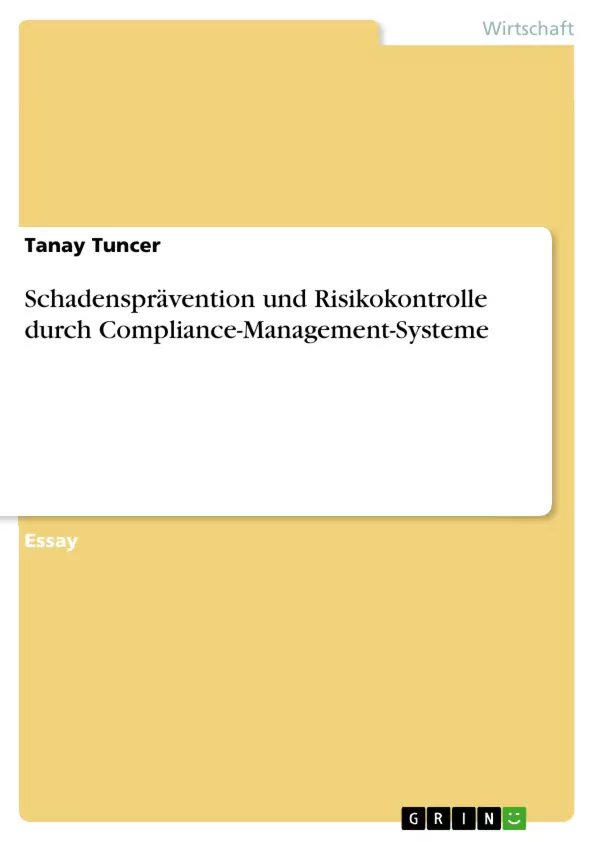Die Arbeit analysiert die Wichtigkeit eines Compliance-Management-Systems (CMS) durch Betrachtung gesetzlicher Vorschriften und allgemein gültiger Compliance-Ziele. Abschließend wird ein Compliance-Management-System Framework konstruiert sowie die Umsetzbarkeit anhand eines konkreten Beispiels erläutert.
Die Einhaltung von Gesetzen und unternehmensinterner Normen und Verhaltensregeln sollte als selbstverständlich gelten. Allerdings besteht die Versuchung oder die Unwissenheit, grundlegende Rechte und Regeln zu missachten. Die Statistik der Wirtschaftskriminalität weist 50% des Gesamtschadensvolumen aller polizeilich erfassten Straftaten auf. Die Schadensumme der Wirtschaftskriminalität für das Jahr 2018 belief sich auf über 3.356 Mrd. Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Berechnung Wirtschaftsstraftaten, die durch die Staatsanwaltschaft oder Finanzbehörden bearbeitet wurden, nicht betrachtet werden. Des Weiteren ist zu bemerken, dass die Konsequenzen der Wirtschaftskriminalität nicht vollständig erfasst werden können und die Einschätzung der Schadenssumme als subjektiv zu urteilen ist.
Reputationsschäden, Vertrauensverluste gegenüber Kunden und Stakeholdern oder auch der Verlust von Wettbewerbsvorteilen weisen ein weiteres nicht quantifizierbares Schadenspotenzial auf. Die Reputation des Unternehmens wird durch das Verhalten der Arbeitnehmer und Geschäftsleitung beeinflusst. Dabei kann die Verweigerung oder die bewusste Missachtung von Gesetzen, Regeln oder allgemeinen ethischen Grundsätzen die Reputation des Unternehmens gefährden. Die Unternehmensverantwortung besteht daher in der Aufrechterhaltung eines regelkonformen Verhaltens im Unternehmen. Der CMS Compliance-Barometer beschreibt in diesem Zusammenhang die Ausprägung von Compliance in Großunternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Compliance-Management-System Framework
- Ziele
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die Bedeutung von Compliance-Management-Systemen (CMS) für die Schadensprävention und Risikokontrolle in Unternehmen. Er untersucht die rechtlichen Grundlagen, die relevanten Rahmenbedingungen und die konkreten Maßnahmen, die ein effektives CMS beinhalten sollte.
- Rechtliche Grundlagen für Compliance
- Das Compliance-Management-System Framework
- Ziele und Funktionsweise von CMS
- Risiken und Herausforderungen im Bereich Compliance
- Best Practices für die Implementierung von CMS
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Schadensprävention und Risikokontrolle durch CMS ein. Sie beleuchtet die Bedeutung von Compliance für Unternehmen und die Folgen von Gesetzesverstößen.
Gesetzliche Grundlagen
Dieses Kapitel behandelt die relevanten Gesetze und Vorschriften, die Unternehmen im Bereich der Compliance beachten müssen. Es erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die damit verbundenen Pflichten.
Compliance-Management-System Framework
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den grundlegenden Prinzipien und Elementen eines effektiven CMS. Es beschreibt die verschiedenen Komponenten eines CMS und deren Funktion.
Schlüsselwörter
Compliance, Compliance-Management-System, Risikokontrolle, Schadensprävention, gesetzliche Grundlagen, Unternehmensethik, Risikomanagement, Rechtskonformität, interne Kontrollsysteme, Best Practices, Unternehmenskultur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Compliance-Management-System (CMS)?
Ein CMS ist ein System zur Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen, unternehmensinternen Normen und ethischen Verhaltensregeln in einem Unternehmen.
Welchen Umfang hat die Wirtschaftskriminalität in Deutschland?
Allein im Jahr 2018 belief sich die polizeilich erfasste Schadenssumme auf über 3,356 Mrd. Euro, was etwa 50% des Gesamtschadensvolumens aller Straftaten entspricht.
Warum sind Reputationsschäden für Unternehmen so gefährlich?
Reputationsschäden führen zu Vertrauensverlust bei Kunden und Stakeholdern, was oft schwerer wiegt als unmittelbare finanzielle Strafen und nicht quantifizierbar ist.
Was sind die Hauptziele eines effektiven CMS?
Die Ziele sind Schadensprävention, Risikokontrolle, die Aufrechterhaltung eines regelkonformen Verhaltens und der Schutz der Unternehmensreputation.
Wer ist im Unternehmen für Compliance verantwortlich?
Die Gesamtverantwortung liegt bei der Geschäftsleitung, jedoch beeinflusst das Verhalten jedes einzelnen Arbeitnehmers die Compliance-Kultur des Unternehmens.
- Quote paper
- Tanay Tuncer (Author), 2020, Schadensprävention und Risikokontrolle durch Compliance-Management-Systeme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947926