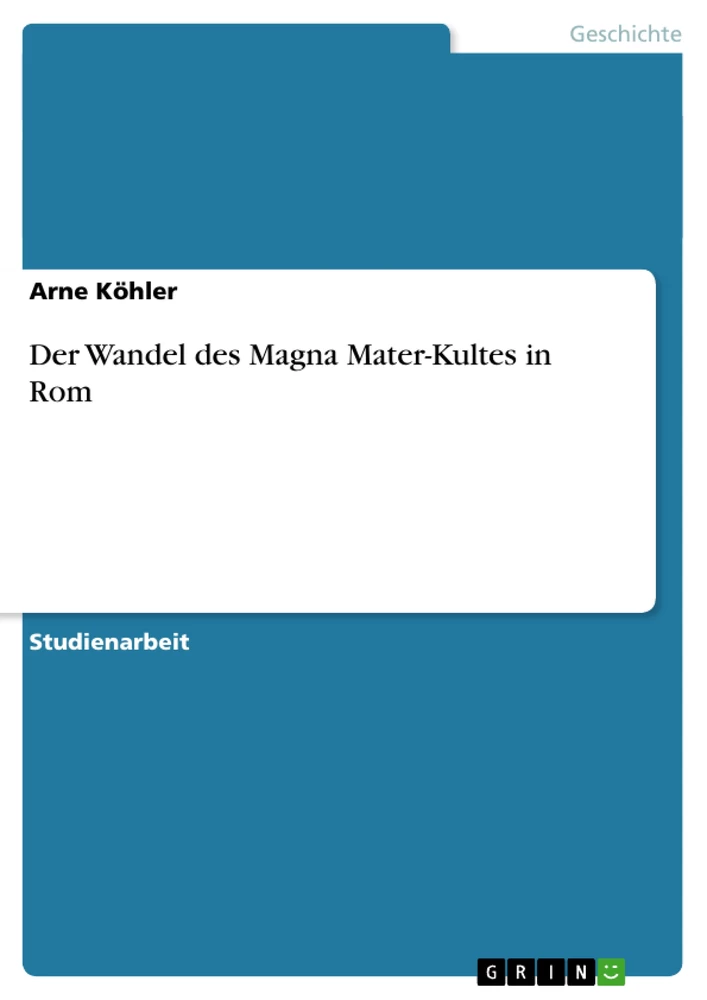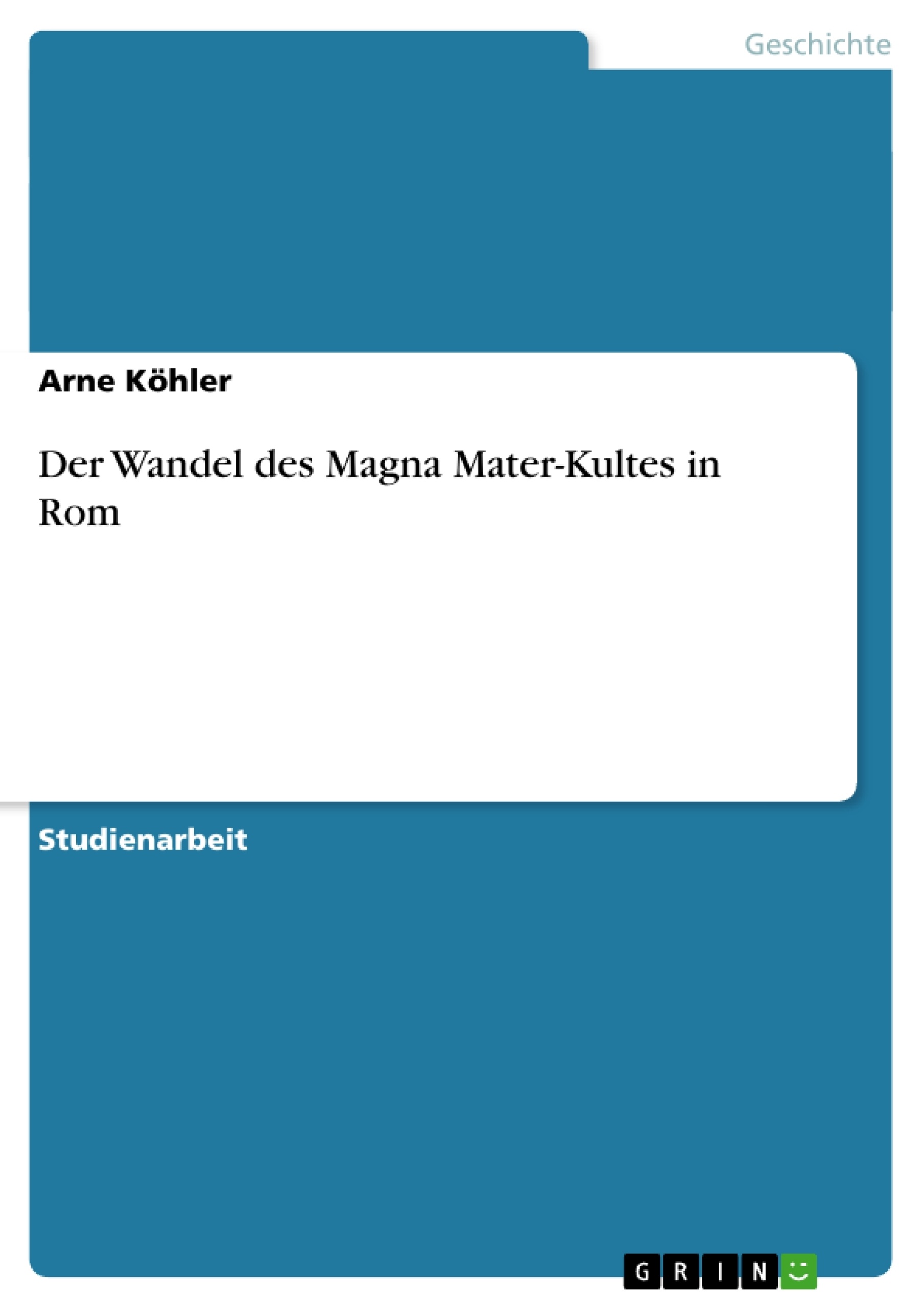Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Aufstieg und Fall eines Kultes im Herzen des Römischen Reiches? Tauchen Sie ein in eine faszinierende Epoche, in der Staatsräson und religiöse Inbrunst auf unvorhersehbare Weise miteinander verschmolzen. Diese packende Analyse entführt Sie ins Rom des 3. Jahrhunderts v. Chr., einer Zeit des Umbruchs, in der die Römer, geplagt von Kriegen und Unsicherheit, nach neuen Wegen suchten, das Schicksal zu ihren Gunsten zu wenden. Die Ankunft der Magna Mater, einer fremden Göttin aus Phrygien, versprach Rettung und Sieg über Hannibal, doch ihr Kult brachte nicht nur Hoffnung, sondern auch Konflikte mit sich. Erleben Sie, wie die anfängliche Begeisterung für die exotische Gottheit schon bald in Ablehnung und staatliche Repressionen umschlug, als die Römer mit den ungewohnten Riten und ekstatischen Praktiken ihrer Anhänger konfrontiert wurden. Von verbotenen Prozessionen und Selbstkastrationen bis hin zu religiösen Spannungen und politischen Intrigen – die Geschichte der Magna Mater in Rom ist ein Spiegelbild der römischen Gesellschaft selbst. Entdecken Sie, wie der Kult unter Augustus eine überraschende Wiedergeburt erlebte, als die Göttin von einer Fremden zur trojanischen Ahnin stilisiert wurde und sich in das Pantheon der römischen Staatsreligion einfügte. Diese tiefgründige Untersuchung enthüllt die komplexen Dynamiken zwischen Staat und Religion, Tradition und Innovation, Faszination und Furcht, die das Römische Reich prägten, und wirft ein neues Licht auf die religiösen Wurzeln Europas. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch Tempel, Paläste und geheime Kultstätten, um die Wahrheit hinter der Magna Mater zu enthüllen und die Frage zu beantworten: War ihr Einfluss ein Segen oder ein Fluch für das ewige Rom? Eine spannende Lektüre für alle, die sich für antike Geschichte, römische Kultur, Religionswissenschaft und die verborgenen Kräfte interessieren, die das Imperium Romanum formten und schließlich zu Fall brachten. Erfahren Sie mehr über Kybele, Mater Deum Magna, kleinasiatische Kulte, römische Religion, Religionspolitik, römische Kaiserzeit, Augustus, Kultuswandel, Religionsgeschichte und antike Mysterienkulte.
Inhalt
1. Einleitung
2. Einführung der Göttin Rom 204 v. Chr.
3. Staatliche Einschränkungen in der Zeit der ausgehenden Republik
4. Erstarken des Kultes in der Kaiserzeit
5. Schluss
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Diese Arbeit ist die schriftliche Ausarbeitung eines Teils des von mir im Rahmen der Lehrveranstaltung ,,Proseminar: Staat und Religion im römischen Reich" gehaltenen Referates, in dem die Verehrung der Magna Mater (andere Namen u.a. Kybele, Mater Idaea, Mater Deum Magna, Magna Mater deum Idea, Berekyntia1 Mater) als Beispiel für einen Kult vorgestellt wurde, der wegen seiner Fremdartigkeit im sonst religionspolitisch recht ,,liberalen" Rom in den Bereich von staatlichen Einflüssen und Religionsverboten geriet.
Betrachtet man das andere in diesem Zusammenhang vorgestellte Beispiel, nämlich die Affäre um die Bacchanalien, die in den Bacchanalien-Prozessen des Jahres 186 v. Chr. ihren Höhepunkt fand, so liegt der Verdacht nahe, dass die scharfen staatlichen Maßnahmen gegen diese Kultgemeinschaft auf den schlechten Erfahrungen der Römer mit dem kultischen Umfeld der Magna Mater basierten.2
Dennoch änderte sich die Behandlung des Kybele-Kultes im Laufe der Geschichte.
Diesem Wandel - von der mit Feiern begleiteten Einführung der Göttin über staatliche Repressionen gegen ihre Anhänger bis zum Wiedererstarken des Kultes in der Kaiserzeit - soll an Hand des auch im Referat vorgestellten Quellenmaterials aus Titus Livius` ab urbe condita, aus den antiquitates Romanae von Dionysios von Halicarnass sowie aus Ovids fasti, die die verschiedenen Zeiträume abdecken, nachgegangen werden. Verzichtet wird hingegen (anders als im Referat) auf eine umfassende Darstellung der Herkunft der Göttin und ihre Mythen, auf die Kybele-Kultgemeinschaften außerhalb der Stadt Rom sowie auf die Fragestellung über mögliche Einflüsse der Magna Mater auf das im Entstehen begriffene Christentum. Auch die zweifellos noch nicht beendete Diskussion über die Rolle ihres ,,Begleiters" Attis in Rom, die in der Literatur vielfach geführt wird, und die in dem Zusammenhang mit dem Kult ein wichtiger Faktor ist, soll hier nicht vertiefend besprochen werden.
2. Einführung der Göttin in Rom 204 v.Chr.
Als die Römer im Jahre 205 v. Chr. nach einem Weg suchten, den Krieg gegen Hannibal endlich erfolgreich zu beenden, fanden sie die erhoffte Hilfe bei diesem Unternehmen außerhalb von Italien, in Kleinasien. Denn als nach mehreren Steinschlägen vom Himmel, die als religiöse Wunderzeichen aufgefasst wurden, die Sibyllinischen Bücher und das Orakel von Delphi befragt wurden, verhießen diese übereinstimmend, dass sich das Kriegsglück endgültig zu Gunsten der Römer wenden würde, wenn die Göttin Mater Idaea, eine Erdgottheit, die in Pessinus und auf dem Berg Ida angebetet wurde, aus Phrygien nach Rom gebracht würde.3 War Hannibal zu diesem Zeitpunkt freilich schon nahezu besiegt, kann der eigentliche, politische Grund für diese Orakelsprüche in der kleinasiatischen Herkunft der weissagenden Sibyllen und vieler römischer Adelsfamilien, aber auch in dem zu dieser Zeit wachsenden Einfluss Roms auf Kleinasien gesucht werden. Letztlich ist er aber noch ungeklärt.4
Die Delegation des römischen Senates, die im darauf folgenden Jahr zu König Attalos, dem seit ihrem gemeinsamen Kampf gegen Philipp von Mazedonien befreundeten Herrscher von Pergamon5, geschickt wurde, bestand aus hochrangigen römischen Adligen.6 Das Symbol der Göttin, ein heiliger schwarzgrau melierter Meteorstein7, wurde ihnen von Attalos übergeben und auf einem Schiff nach Rom gebracht. Um die Verschiffung des Steines rankt sich die Sage der Claudia Quinta. Als das Schiff namens ,,Salvia"8, das den Fetisch nach Rom bringen sollte, im Tiber auf Grund gelaufen war, soll diese hochadlige Matrone oder Vestalin es durch bloße Berührung des Schiffsseiles wieder flott gemacht haben, was als ein Zeugnis der Göttin für ihre - ansonsten gemeinhin eher bezweifelte - Unschuld ausgelegt wurde.9
Das Orakel hatte gefordert, die Göttin müsse vom besten Mann Roms gastfreundlich in Empfang genommen werden.10 Die Wahl fiel auf den bis dahin ämterlosen Publius Cornelius Scipio Nasica, Sohn des Kriegshelden Cn. Scipio, wobei Livius nicht angeben kann, warum man ausgerechnet ihn dazu auserkoren hatte.11
Nachdem der Stein am in Rom eingetroffen war, brachte man ihn an den Nonen des April 204 zunächst im Tempel der Victoria auf dem Palatin unter. Die feierliche Zeremonie ihres Einzuges wurde von Festmählern und Spielen begleitet.12 Gefeiert wurde das Fest der Gottheit zu dieser Zeit besonders in den Häusern der Adligen, die Gastmähler zu ihren Ehren ausrichteten.13 Der Tempel der Siegesgöttin war gewiss nicht zufällig ausgewählt worden, vielmehr sollte ihre vorläufige Heimstatt der neuen Göttin zeigen, was man von ihr erwartete, nämlich den Sieg über Hannibal zu bewirken.14 Tatsächlich wurde die punische Armee noch im selben Jahr bei Zama geschlagen - die phrygische Göttin hatte Rom also den Dienst erwiesen, um den man sie angefleht hatte. Zu ihren Ehren wurde nun ein eigener Magna Mater-Tempel errichtet, der am 10. April 191 v. Chr. eingeweiht wurde. 194 v. Chr. wurden die ludi Megalenses eingeführt, szenische Spiele zu Ehren der Großen Mutter, die alljährlich vom 4. bis zum 10. April von den kurulischen Ädilen ausgerichtet wurden.15
3. Staatliche Einschränkungen in der Zeit der ausgehenden Republik
Die anfängliche Begeisterung für die fremde Göttin verwandelte sich schon sehr bald in Ablehnung und sogar Boykott durch den Adel. Es entsteht der Eindruck, als hätten die Römer nicht geahnt oder nicht wahr haben wollen, welchen Kult sie da gemeinsam mit der Göttin importieren würden.16 Jedenfalls in den überlieferten Quellen wird die Magna Mater lange Zeit kaum noch erwähnt, und als Konsul Lucius Cornelius Scipio und sein Bruder Publius Cornelius Scipio Africanus 190 v. Chr. (also in zeitlich unmittelbarer Nähe zur Einweihung des Kybele-Tempels auf dem Palatin) in Asien einmarschierten, opferten sie Minerva als Stadtgöttin von Ilion, nicht aber Kybele, obwohl deren Berg Ida in unmittelbarer Nähe lag. Und das, obwohl sie von der Existenz und dem Stellenwert der Göttin durch ihre Verwandtschaft zu Publius Cornelius Scipio Nasica, der die Göttin 204 in Empfang genommen hatte, in jedem Fall hätten wissen müssen.17
Um den Stimmungsumschwung erklären zu können, dem sich der Kult der Göttin in der römischen Bevölkerung schon recht bald gegenüber sah, und der zu staatlichen Sanktionen gegen die Kybele-Anhänger führte, muss ein Blick auf die Aktivitäten der Kultgemeinschaft und ihr äußeres Erscheinungsbild geworfen werden.
Denn gemeinsam mit der Göttin waren Priester von Kleinasien nach Rom gekommen, die die traditionellen Riten der Gottheit nun auch am Tiber ausübten. Sie trugen für römische Augen fremdartige, wallende bunte Gewänder, waren langhaarig (bei teilweise gebleichten Haaren) und mit seltsamem Schmuck gehängt. Ihre Rituale vollzogen sie nicht in der Stille ihres Tempels, sondern zogen lärmend begleitet von Flötenmusik in Umzügen durch die Straßen, Trommeln und Becken schlagend. Bei diesen Prozessionen, die während der April-Feierlichkeiten einmal jährlich auch öffentlich stattfinden durften18, tanzten sie sich so sehr in Ekstase, dass sie sich auf dem Höhepunkt der Feierlichkeiten selbst geißelten oder sogar - von der die Kybele begleitenden Gottheit Attis inspiriert - Selbstkastrationen mit so primitiven Mitteln wie Scherben, Messer oder scharfen Steinen vollzogen. Diese Priester wurden galli genannt (die Vorsteher des Kultes archigalli), ein Name, der sich entweder von dem sich ebenfalls selbst entmannten König Gallus, dem Fluss Gallos oder einfach davon ableitet, dass die Priester den Hahn (gallus) als ihr Symbol ausgewählt hatten. Neben der lärmenden April-Prozession und ihrem grellen Erscheinungsbild fielen sie besonders dadurch negativ auf, dass sie in den Straßen um Geld bettelten, was schnell unterbunden und nur noch einmal jährlich geduldet wurde.19
All dies waren Verhaltensweisen, die den konservativen Römern nicht nur fremd, sondern ärgerlich und sogar bedrohlich erscheinen mussten. Warum aber konnte der Kult, der ja eigens nach Rom geholt worden war, nicht kurzerhand wieder abgeschafft werden? Eine solche Maßnahme hätte das Eingeständnis des Senates bedeutet, mit der Übertragung der Göttin einen Fehler gemacht zu haben. Außerdem wäre es ohnehin aus traditionellen Gründen undenkbar gewesen, eine mächtige Gottheit wie Kybele einfach wieder ,,herauszuwerfen", immerhin war ihr bei der Translation Gastfreundschaft versprochen worden.20 Freilich galt dies nicht für Attis. Ob er nun von Anfang an dabei war oder nicht, sei dahingestellt, aber willkommen war er auf keinen Fall in Rom.21
Dennoch ging die Gastfreundschaft für Kybele nicht so weit, dass der Senat vor einer Anti-Kybele-Gesetzgebung und -Rechtssprechung zurückgeschreckt wäre. Er schränkte den Kult stark ein. So wurde es römischen Bürgern untersagt, an den feierlichen Prozessionen teilzunehmen, bei denen Almosen erbettelt wurden, da es dem Pomp und der Raserei der kleinasiatischen Kybele-Riten an Anstand und Schicklichkeit fehle, wie es hieß. Die kultischen Handlungen fanden zwar dennoch statt, wenn auch nur auf den Tempelbezirk beschränkt, und ausgeführt von den eingewanderten Phrygiern.22
Insbesondere war es Römern streng verboten, an den rituellen Selbstkastrationen teilzunehmen. Ein römischer Sklave, der gegen dieses gestoßen hatte, wurde ca. 100 v. Chr. aus Rom und sogar aus Italien verbannt,23 und ein Vierteljahrhundert später verlor ein gewisser Freigelassener namens Genucius durch ein Urteil eine Erbschaft, da er als Kastrierter keinem Geschlecht zuzuordnen und somit nicht mehr rechtsfähig sei. Verbannt wurde er hingegen wohl nicht, was für eine leichte Lockerung der Maßnahmen spricht.24
Diese Restriktionen richteten sich jedoch nur gegen den unerwünschten, traditionell- kleinasiatischen Teil des Kybele-Kultes, gegen Raserei und Überschwang. Die einmal in den Festkalender eingeführten Spiele und Feiertage, also sozusagen der römische Teil des Kultes, wurden dagegen gewissenhaft fortgeführt, immerhin blieb die Magna Mater - einmal eingeführt - trotz aller Bedenken Teil der römischen Staatsreligion.
4. Erstarken des Kultes in der Kaiserzeit
Diese Einstellung gegenüber der Großen Mutter änderte sich grundlegend in der Kaiserzeit, schon unter Augustus. Nun wurde die Göttin in der Betrachtungsweise von der Asiatin zur Trojanerin, und aus Troja waren die Römer nach eigenem Selbstverständnis ja einst selbst nach Rom gekommen - plötzlich schien sie also längst nicht mehr so fremd zu sein, wurde quasi selbst zur Römerin.25
Auch die Sichtweise als Göttin der Raserei wandelte sich. Nunmehr wurde der Aspekt der gütigen Muttergottheit betont.26
Ovid berichtet, dass Augustus selbst den niedergebrannten Tempel auf dem Palatin wieder aufbauen ließ, was dieser auch in seinem Testament besonders hervorhebt. Der Kaiser wohnte sogar gegenüber dem Tempel.27 In heiterem Tonfall berichtet Ovid über den Umzug der Kybele-Anhänger und auch die Sammlung von Spenden, zuvor noch als unschickliche Bettelei verpönt, wird von Ovid als mos bezeichnet und damit legitimiert. Schließlich betont der Dichter die Stellung der Magna Mater als Mutter der Götter, der das erste Fest im römischen Jahr zusteht.28
Augustus, seine eigene trojanische Herkunft betonend, stellte die Göttin sogar in seine Ahnreihe sowie in eine Reihe mit Gottheiten wie Mars Ultor, Venus Genetrix, Apollo, Diana, Latona und Vesta.29
Auch die bereits erwähnte Claudia Quinta, die seinerzeit den Einzug der Göttin in Rom durch ihre Wundertat erst ermöglicht hatte, wurde demonstrativ in die Familie des Kaisers aufgenommen: seine Gattin Livia gehörte zum claudischen Geschlecht.30 Möglicherweise erst in dieser Zeit wurde außerdem das Fest der lavatio eingeführt, bei dem das Götterbild jährlich am 27. März zu einer rituellen Waschung an den Almo gebracht wurde.31
Noch größere Verehrung wurde der Magna Mater in späteren Jahren zu Teil, besonders unter Kaiser Claudius wurde sie gegenüber den anderen Gottheiten regelrecht bevorzugt behandelt. Unter anderem wurde das Verbot für römische Bürger, Magna Mater-Priester zu werden, aufgehoben, die dem Kult vorstehenden archigalli waren nunmehr generell römische Bürger32, und auch die Feiern zum Todestag des Attis, der ja bislang offiziell außen vor war, wurden in den Festkalender aufgenommen.33 Diese Verbesserungen konnte der Kult allerdings nur erreichen, indem er seinerseits auf die für die Römer unerträglichen Entmannungs-Rituale verzichtete. Außerdem stand die Gemeinschaft unter der Aufsicht der quindecimviri.34
Unter Hadrian wurde das Abbild der Magna Mater auf Münzen geprägt35, Antonius Pius erließ weitgehende Reformen zu Gunsten des Kultes36 und Kaiser Julian verfasste im vierten Jahrhundert sogar höchstselbst einen Hymnus ,,an die Mutter der Götter".
5. Schluss
Letztlich ist es der Versuch der Römer, die Religion der Großen Mutter aufzuspalten - in die original-phrygische, wilde, exotische Kybele, die lediglich im Verborgenen agieren durfte auf der einen, und die offiziell-römische, saubere und an die römische Staatsreligion angepasste Magna Mater auf der anderen Seite.
Mit der Translation des Maga Mater-Kultes nach Rom trafen zwei Welten aufeinander, die sich erst durch langwierige gegenseitige Anpassungsprozesse soweit angeglichen hatten, dass sie überhaupt kompatibel erschienen.
Der Einfluss der römischen Gesellschaft, deren Bürger über eine völlig andere Mentalität verfügten als die Bevölkerung in Kybeles kleinasiatischer Heimat, veränderte den Magna Mater-Kult, aber die phrygische Göttin veränderte auch nachhaltig die römische Gesellschaft und ihre Religion.
War das Verhältnis zwischen Individuum und klassisch römischer Gottheit eher von Distanz und pflichtgemäß und exakt ausgeführtem, aber keinesfalls inbrünstigem Gottesdienst geprägt, für das die Gottheit dann im Gegenzug ihre Kraft zu Gunsten des Betenden spielen ließ, ging die Beziehung zwischen Kybele und ihren Gläubigen wesentlich weiter. Ihre Rituale waren voll Hingabe und der Mensch trat in seiner Bedeutung als Individuum in den Hintergrund, wenn die Göttin ihren machtvollen Auftritt in den Köpfen ihrer bis zur Raserei tanzenden und trommelnden Anhänger hatte.37 Bömer hat somit mit großer Sicherheit Recht, wenn er behauptet, dass der Grund für den Boykott der Göttin in der Zeit der ausgehenden Republik nicht zuletzt auch in der Furcht der römischen Priester vor einem grundlegenden Wandel der religiösen Welt, der sich am Horizont abzeichnete, zu suchen ist.38 Dieser Wandel ließ sich letztlich aber auch durch staatliche Einflussversuche auf die Religion nicht vermeiden.
Neu war auch die Hinwendung zu einer alles umfassenden Gottheit, weg von den verschiedenen Göttern, die sozusagen für ,,Teildisziplinen" wie Krieg oder Ernte verantwortlich waren. Dass dieses Bild der einen Muttergöttin und natürlich auch die Mythen um die Auferstehung ihres Begleiters Attis deutliche Parallelen zum Christentum aufweisen, das ja später auf seinem Siegeszug neben den herkömmlichen römischen Gottheiten auch die Magna Mater und Attis in Rom wegfegen und zur Staatsreligion werden sollte, erscheint mir keineswegs zufällig zu sein.39
Literaturverzeichnis
Quellen
Dionysios von Halicarnass, antiquitates Romanae, Bd. II. Mit einer englischen
Übersetzung von Earnest Cary auf Basis der Version von Edward Spelman, Cambridge, London, 1937, ND: 1968.
T. Livius, ab urbe condita. Lateinisch und Deutsch, hrsg. von H.J. Hillen, München, Zürich 1983.
P. Ovidius Naso, Fasti. Lateinisch und Deutsch, hrsg. von N. Holzberg, München 1995.
Literatur
Bömer, F., Kybele in Rom. Die Geschichte ihres Kults als politisches Phänomen, in: MDAI(R) 71, 1964, 130-151.
Cumont, F., Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum, Übers. der 4. franz. Originalausgabe (Paris 1929) durch Gehrich, bearbeitet durch A. Burckhardt- Brandenberg, 9. Auflage, Darmstadt 1989.
Demandt, A., Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justitian 284-565 (HdbA 3,6). München 1989, S. 419f.
Gruen, E.S., Studies in Greek culture and Roman policy (Cincinnati classical studies, new series, vol. 7), Leiden, New York, Kopenhagen, Köln 1990, 5-34.
Köves, T. Zum Empfang der Magna Mater in Rom, in: Historia 12, 1963, 321-347.
Latte, K., Römische Religionsgeschichte (HbdA 5,4), München 1960, 258-263.
Sanders, G, Kybele und Attis, in: Vermaseren, M.J. (hrsg.), OrRR, Leiden 1981, 264- 298.
Schillinger, K., Untersuchungen zur Entwicklung des Magna Mater-Kultes im Westen des römischen Kaiserreiches, Diss. Konstanz 1979.
Erika Simon, Die Götter der Römer. München 1990, S. 146-151.
Thomas, G., Magna Mater and Attis, in: Temporini H. - Haase, W. (Hrsg.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Teil II Principat, Bd. 17, 3. Teilband, Berlin, New York, 1984, S. 1500-1535.
Turcan, R., The Cults of the Roman Empire, Übers. der 2. franz. Originalausgabe (Paris 1992) durch A. Nevill, Oxford 1996.
Vermaseren, M.J., Cybele and Attis. The myth and the cult, London 1977.
Wissowa, G., Religion und Kultus der Römer (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, Abt. 5, Bd. 4), 2. Auflage München 1912.
[...]
1 Die Berekyntes waren ein großphrygisches Volk, die Bezeichnung betont also die phrygische Herkunft der Göttin.
2 So vermutet jedenfalls F. Bömer, Kybele in Rom, S. 133.
3 Liv. XXIX, 10, 4-8.
4 F. Cumont, Die orientalischen Religionen, S. 43; M.J. Vermaseren, Cybele, S. 39; K. Schillinger, Untersuchungen, S. 5f.; E.S. Gruen, Studies, S. 33.
5 Nach F. Bömer, Kybele in Rom, S. 130f. waren weder Pessinus noch der Berg Ida, sondern Pergamon ,,mit ziemlicher Sicherheit" der Ausgangspunkt der Translation.
6 Liv. XXIX, 11, 1-4, nennt namentlich den zweimaligen Konsul M. Valerius Laevinus, den ehemaligen Prätor M. Caecilius Metellus, Ser. Sulpicius Galba (früherer Ädil) sowie die ehemaligen Quästoren Cn. Tremelius Flaccus und M. Valerius Falto.
7 E. Simon, Die Götter der Römer, S. 147; G. Wissowa, Religion und Kultus, S. 318; ob es sich wirklich um den Originalstein des Heiligtums von Pessinus handelte, wie Livius behauptet, ist nicht sicher. K. Latte, Römische Religionsgeschichte, S. 259, geht davon aus, dass der Stein ,,dem aufgeklärten hellenistischen Herrscher" nicht mehr gewesen sei als ,,ein Schmuck seiner Hauptstadt". Vgl. dazu auch M.J. Vermaseren, Cybele, S. 39f, 43 und G. Sanders, Kybele und Attis, S. 275f.
8 E. Simon, Die Götter der Römer, S. 149.
9 Ov. fast. IV, 343f.; Liv. XXIX, 14, 12; Vermaseren, Cybele, S. 41.
10 Liv. XXIV, 11, 6: ,,eam, qui vir optimus Romae esset, hospitio exciperet."
11 Liv. XXIV, 14, 6-9, Vermaseren, Cybele, S. 40f; T. Köves, Zum Empfang der Mater Magna in Rom, S. 321-347, stellt die Vermutung auf, die Wahl des jugendlichen und ämterlosen Mannes könnte als Symbol für den als knabenhaft dargestellten Attis verstanden worden sein. Dem widerspricht G. Thomas, Magna Mater and Attis, S. 1506, der darauf verweist, dass Attis in Rom zu dieser Zeit noch unbekannt war und - abgesehen davon - kein römischer Adliger einem Vergleich mit dem unrömischen Attis zugestimmt hätte.
12 Liv. XXIV, 14, 13f.
13 F. Bömer, Kybele in Rom, S. 132.
14 Vermaseren, Cybele, S. 41.
15 F. Cumont, Die orientalischen Religionen, S. 44; K. Schillinger, Untersuchungen, S. 5; G. Wissowa, Religion und Kultus, S. 318.
16 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, S. 259f.
17 F. Bömer, Kybele in Rom, S. 133f.; G. Thomas, Magna Mater and Attis, S. 1508f.
18 R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, S. 37.
19 M.J. Vermaseren, Cybele, S. 96f; R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, S. 37, G. Sanders, Kybele und Attis, S. 277f.
20 F. Bömer, Kybele in Rom, S. 133.
21 M.J. Vermaseren, Cybele, S. 177f., Attis` Selbstkastration war in den Augen der Römer eine Schande, ,,Attis in particular was too un-Roman", wie Vermaseren meint.
22 Dion. Hal. II, 19, 4-5; R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, S. 37
23 F. Bömer, Kybele in Rom, S. 136.
24 Dion Hal. II, 19, 5; K. Schillinger, Untersuchungen, S. 7.
25 F. Bömer, Kybele in Rom, S. 144f.
26 F. Bömer, Kybele in Rom, S. 139f.
27 M.J. Vermaseren, Cybele, S. 42, 177.
28 Ov. fast. IV, 345-360.
29 K. Schillinger, Untersuchungen, S. 333f; G. Wissowa, Religion und Kultus, S. 319.
30 K. Schillinger, Untersuchungen, S. 335-341, stellt allerdings klar, dass der offizielle Teil des Kultes trotz aller vereinzelter Wohltaten durch Augustus und seine Bemühungen, die Göttin als seine Ahnin darzustellen, nicht wirklich gefördert wurde. Die Diskriminierungen gegen Priesterkollegium und Anhänger seien zunächst bestehen geblieben.
31 G. Wissowa, Religion und Kultus, S. 319; Wissowa weißt allerdings ausdrücklich darauf hin, dass das Fest auch schon älter sein könnte, bis dahin nur noch nicht nachgewiesen ist.
32 M.J. Vermaseren, Cybele, S. 96; F. Cumont, Die orientalischen Religionen, S. 51f.
33 K. Schillinger, Untersuchungen, S. 342-346. Allerdings wurde Attis nach Schillingers Untersuchungen weiterhin nicht als Gott anerkannt und auch die weitgehend ausgegrenzte Situation der galli änderte sich nicht.
34 G. Wissowa, Religion und Kultus, S. 320f.
35 F. Bömer, Kybele in Rom, S. 144.
36 K. Schillinger, Untersuchungen, S. 352-373, wobei Schillinger trotzdem erneut zu dem skeptischen Schluss kommt, die Maßnahmen dienten eher dazu, den Kult ,,einzugrenzen und womöglich zu isolieren".
37 F. Cumont, Die orientalischen Religionen, S. 26f.
38 F. Bömer, Kybele in Rom, S. 132f.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit über die Magna Mater?
Diese Arbeit behandelt die Verehrung der Magna Mater (Kybele) in Rom, von ihrer Einführung 204 v. Chr. bis zum Wiedererstarken des Kultes in der Kaiserzeit. Sie untersucht staatliche Einschränkungen während der Republik und den Wandel der Akzeptanz des Kultes im Laufe der Zeit.
Wie kam die Magna Mater nach Rom?
Die Magna Mater wurde 204 v. Chr. nach Rom gebracht, nachdem die Sibyllinischen Bücher und das Orakel von Delphi verhießen, dass dies zum Sieg im Krieg gegen Hannibal führen würde. Das Symbol der Göttin, ein Meteorstein, wurde von König Attalos von Pergamon übergeben.
Wer empfing die Magna Mater in Rom?
Publius Cornelius Scipio Nasica, der als der beste Mann Roms galt, empfing den Stein der Magna Mater in Rom.
Welche staatlichen Einschränkungen gab es für den Kybele-Kult in der Republik?
Der römische Senat schränkte den Kult stark ein. Römischen Bürgern wurde die Teilnahme an Prozessionen mit Bettelei untersagt, und rituelle Selbstkastrationen waren verboten.
Warum gab es Ablehnung gegenüber dem Kybele-Kult?
Die Ablehnung kam aufgrund der fremdartigen Riten der Priester (Galli), ihrer lauten Prozessionen, dem Betteln in den Straßen und den rituellen Selbstkastrationen, die als unschicklich galten.
Wie änderte sich die Einstellung zum Magna Mater-Kult in der Kaiserzeit?
In der Kaiserzeit, besonders unter Augustus und Claudius, erlebte der Kult ein Wiedererstarken. Die Göttin wurde nun als Trojanerin betrachtet, was sie für die Römer akzeptabler machte, und der Aspekt der gütigen Muttergöttin wurde betont. Römischen Bürgern wurde erlaubt, Magna Mater-Priester zu werden, und die Feiern zum Todestag des Attis wurden in den Festkalender aufgenommen.
Welche Rolle spielte Augustus beim Wiederaufleben des Kultes?
Augustus ließ den niedergebrannten Tempel der Magna Mater auf dem Palatin wieder aufbauen und stellte die Göttin in seine Ahnreihe. Er legitimierte auch die Sammlung von Spenden durch die Kybele-Anhänger.
Was war die lavatio und wann wurde sie möglicherweise eingeführt?
Die lavatio war ein Fest, bei dem das Götterbild der Magna Mater jährlich am 27. März zu einer rituellen Waschung an den Almo gebracht wurde. Es wird vermutet, dass dieses Fest in der Kaiserzeit eingeführt wurde.
Wie versuchten die Römer, den Magna Mater-Kult anzupassen?
Die Römer versuchten, den Kult in eine originale, wilde Kybele (die im Verborgenen agieren durfte) und eine offiziell-römische, angepasste Magna Mater aufzuspalten. Sie veränderten den Kult durch staatliche Einflussnahme und passten ihn an die römische Staatsreligion an.
Welche Auswirkungen hatte der Magna Mater-Kult auf die römische Gesellschaft?
Der Magna Mater-Kult führte zu einer Hinwendung zu einer alles umfassenden Gottheit und die Rituale waren voll Hingabe. Dies könnte den Weg für das Christentum bereitet haben.
- Citar trabajo
- Arne Köhler (Autor), 1999, Der Wandel des Magna Mater-Kultes in Rom, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94798