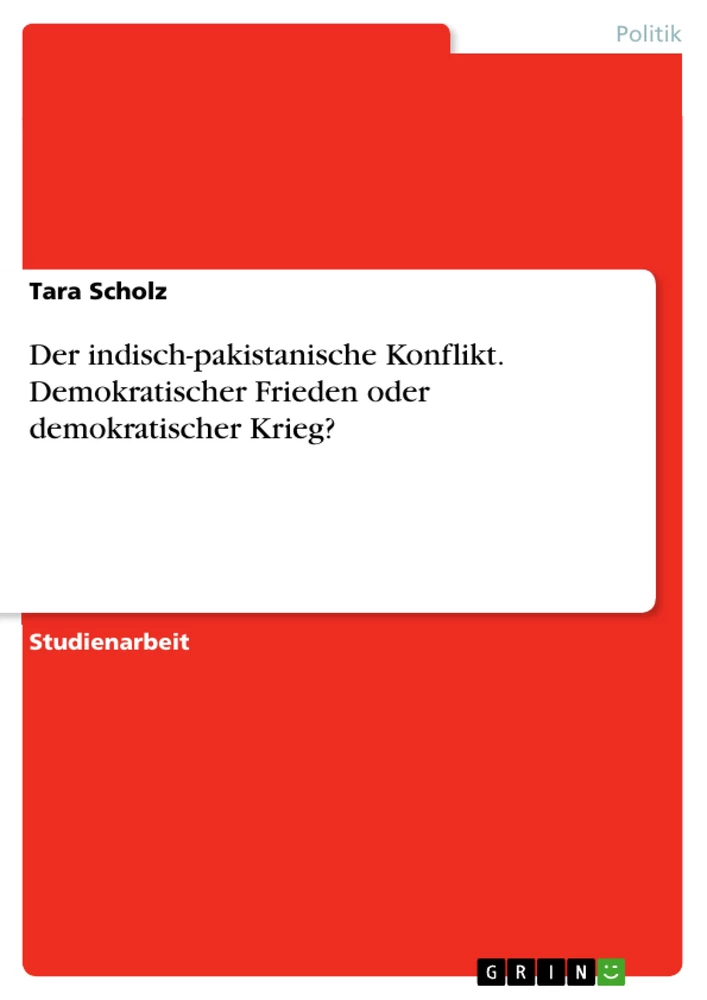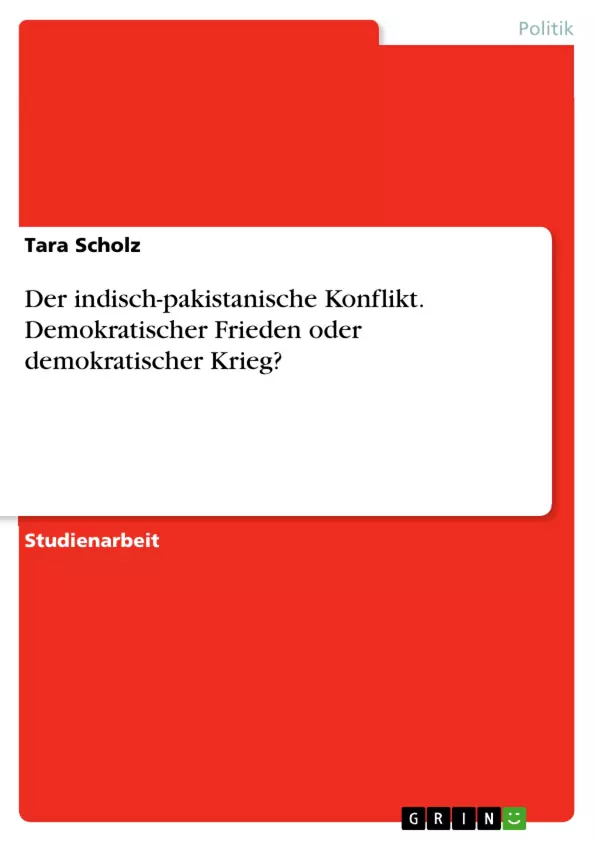Wie können Indien und Pakistan, die offiziell den Status einer Demokratie innehaben, schon vier Mal gegeneinander Krieg geführt haben? Mittels welcher Theorie aus der internationalen Politik kann dieser Befund erklärt werden? Und wie kann es sein, dass zwei Staaten, die seit über 70 Jahren im Konflikt miteinander stehen bis zum heutigen Tag keinen Lösungsansatz gefunden haben?
Seit nunmehr 70 Jahren steht Kaschmir im Mittelpunkt des bilateralen Konflikts zwischen Indien und Pakistan. Bis zum heutigen Tag beanspruchen beide Staaten das gesamte Gebiet für sich, ein Lösungsansatz für den langwierigen Konflikt scheint auch in näherer Zukunft eher aussichtslos. Am 5. August 2019 entzog Indien per Präsidentendekret, mit Kaschmir die Teilautonomie, verankert in Artikel 370 der indischen Verfassung. Kaschmir, welches bis zu diesem Zeitpunkt über eine eigene Verfassung, eine separate Staatsflagge und eine autonome Verwaltung verfügte, verlor all diese Sonderrechte mit sofortiger Wirkung. Die indische Regierung ließ daraufhin harte Maßnahmen folgen. In die ohnehin schon stark militarisierte Region wurden zehntausende weitere Soldaten entsandt und für die gesamte Bevölkerung eine Ausgangssperre verhängt. Kaschmirische Politiker wurden teilweise festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Sämtliche medialen Verbindungen und Kommunikationsmittel, wie Telefon, Internet, Fernsehen und Radio, wurden stillgelegt.
Derzeit ist die Bevölkerung Kaschmirs seit mehr als vier Monaten von der Außenwelt abgeschnitten und die komplette Region befindet sich im Ausnahmezustand. Mittlerweile wurde Kaschmir in zwei Unionsterritorien aufgeteilt, in Ladakh und in Jammu und Kaschmir. Auch an der Waffenstillstandsline, der Grenze zwischen Indien und Pakistan kam es vermehrt zu Unruhen und Auseinandersetzungen. Sollte die Lage in Kaschmir eskalieren könnte dies ein weiteren Krieg zwischen Indien und Pakistan auslösen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Literaturbericht
- 1.2 Methode der Arbeit
- 2. Deskription
- 2.1 Historische Entwicklung des Kaschmirkonflikts
- 2.2 Die Akteure des Konflikts im Vergleich
- 3. Der Demokratische Frieden
- 3.1 Die Variablen des Demokratischen Friedens
- 3.2 Der empirische Doppelbefund
- 3.3 Die liberalen Erklärungsansätze
- 4. Analyse und Auswertung des Kaschmirkonflikts im Sinne des Demokratischen Friedens
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den langjährigen Konflikt zwischen Indien und Pakistan, insbesondere im Hinblick auf den Kaschmirkonflikt. Ziel ist es, die wiederholten Kriege zwischen diesen beiden offiziell demokratischen Staaten zu erklären und zu analysieren, ob und inwiefern die Theorie des Demokratischen Friedens hierauf anwendbar ist. Die Arbeit sucht nach Antworten auf die Frage, warum trotz des demokratischen Status beider Länder ein langjähriger Konflikt ohne Lösungsansatz besteht.
- Historische Entwicklung des Kaschmirkonflikts und die beteiligten Akteure
- Die Theorie des Demokratischen Friedens und ihre zentralen Annahmen
- Analyse der indo-pakistanischen Kriege im Kontext des Demokratischen Friedens
- Bewertung der Anwendbarkeit der Theorie auf den Fall Kaschmir
- Suche nach Erklärungen für die andauernde Konfliktdynamik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in den seit 70 Jahren andauernden indo-pakistanischen Konflikt um Kaschmir ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Vereinbarkeit von Demokratie und wiederholten Kriegen. Sie benennt die Forschungslücke und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der einen historischen Überblick, die Vorstellung der Akteure und eine Analyse anhand der Theorie des Demokratischen Friedens beinhaltet. Der Literaturbericht beleuchtet existierende Studien zum Konflikt, insbesondere die Arbeiten von Chaudhry, Rothermund, Wolpert, Wynbrandt und Ganguly, welche die historischen Aspekte, die Kriegsgeschehnisse und die politischen Beziehungen zwischen Indien und Pakistan beleuchten. Die Methode beschreibt die Vorgehensweise: historische Einordnung, Länderbeschreibung und Anwendung der Theorie des Demokratischen Friedens zur Analyse der Kriege.
2. Deskription: Dieses Kapitel bietet einen deskriptiven Überblick über den Kaschmirkonflikt. Der Abschnitt zur historischen Entwicklung beleuchtet die Teilung Britisch-Indiens 1947 und die unterschiedlichen Besitzansprüche auf Kaschmir, basierend auf der säkularen Vision Indiens und dem islamischen Anspruch Pakistans. Der Konflikt wird als Folge unterschiedlicher nationalistischer Unabhängigkeitsbewegungen dargestellt. Der zweite Teil, "Die Akteure des Konflikts im Vergleich", vermutlich wird eine detaillierte Analyse der politischen und gesellschaftlichen Strukturen Indiens und Pakistans sowie deren Interessen in Bezug auf Kaschmir liefern, um ein fundiertes Verständnis der Konfliktparteien zu schaffen.
3. Der Demokratische Frieden: Dieses Kapitel stellt die Theorie des Demokratischen Friedens vor. Es erläutert die zentralen Variablen dieser Theorie, den empirischen Doppelbefund (Demokratien führen seltener Kriege gegeneinander und führen häufiger Kriege gegen Nicht-Demokratien) und die liberalen Erklärungsansätze, die versuchen, diesen Befund zu begründen. Es wird vermutlich auf institutionelle Faktoren, die Verbreitung von demokratischen Normen und die Rolle der Zivilgesellschaft eingegangen.
4. Analyse und Auswertung des Kaschmirkonflikts im Sinne des Demokratischen Friedens: Dieser Abschnitt analysiert die indo-pakistanischen Kriege (zweiten Kaschmirkonflikt, Bangladesch-Krieg, Kargil-Krieg) unter dem Blickwinkel der Theorie des Demokratischen Friedens. Die Analyse wird wahrscheinlich untersuchen, inwiefern die politischen Systeme Indiens und Pakistans die Kriegsentscheidungen beeinflusst haben und ob die Theorie des Demokratischen Friedens eine schlüssige Erklärung für den Konflikt liefert. Die Gesamtbewertung wird die Ergebnisse der Einzelanalysen zusammenfassen und bewerten. Es soll geprüft werden, ob ein direkter Zusammenhang zwischen den Regierungssystemen und den Kriegen besteht.
Schlüsselwörter
Indisch-Pakistanischer Konflikt, Kaschmirkonflikt, Demokratischer Frieden, Demokratie, Krieg, Internationale Beziehungen, Indien, Pakistan, Theorie der internationalen Politik, Historische Analyse, politische Systeme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Der Kaschmirkonflikt im Lichte des Demokratischen Friedens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den langjährigen Konflikt zwischen Indien und Pakistan, insbesondere den Kaschmirkonflikt. Im Fokus steht die Frage, ob und inwiefern die Theorie des Demokratischen Friedens diesen Konflikt zwischen zwei offiziell demokratischen Staaten erklären kann, trotz der wiederholten Kriege.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung (mit Literaturbericht und Methodenbeschreibung), 2. Deskription (historische Entwicklung des Kaschmirkonflikts und Vergleich der Akteure), 3. Der Demokratische Frieden (Variablen, empirischer Befund und liberale Erklärungsansätze), 4. Analyse und Auswertung des Kaschmirkonflikts im Sinne des Demokratischen Friedens, und 5. Fazit.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum besteht trotz des demokratischen Status beider Länder ein langjähriger Konflikt zwischen Indien und Pakistan um Kaschmir ohne Lösungsansatz? Die Arbeit sucht nach Antworten auf diese Frage.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine historisch-vergleichende Methode. Sie beinhaltet einen historischen Überblick über den Kaschmirkonflikt, eine Beschreibung der beteiligten Akteure (Indien und Pakistan) und eine Analyse unter Anwendung der Theorie des Demokratischen Friedens. Die Analyse umfasst die Untersuchung der indo-pakistanischen Kriege im Kontext dieser Theorie.
Welche Theorien werden herangezogen?
Die Arbeit stützt sich zentral auf die Theorie des Demokratischen Friedens. Diese Theorie wird vorgestellt, ihre zentralen Annahmen erläutert und auf den Kaschmirkonflikt angewendet, um dessen Dynamik zu erklären.
Welche Akteure werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Konflikt aus der Perspektive Indiens und Pakistans. Ein Vergleich der politischen und gesellschaftlichen Strukturen beider Länder sowie deren Interessen bezüglich Kaschmir soll ein fundiertes Verständnis der Konfliktparteien ermöglichen.
Welche Kriege werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Untersuchung der indo-pakistanischen Kriege (zweiten Kaschmirkonflikt, Bangladesch-Krieg, Kargil-Krieg) im Kontext des Demokratischen Friedens. Es wird geprüft, inwiefern die politischen Systeme Indiens und Pakistans die Kriegsentscheidungen beeinflusst haben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Indisch-Pakistanischer Konflikt, Kaschmirkonflikt, Demokratischer Frieden, Demokratie, Krieg, Internationale Beziehungen, Indien, Pakistan, Theorie der internationalen Politik, Historische Analyse, Politische Systeme.
Welche Literatur wird berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf existierende Studien zum Konflikt, insbesondere die Arbeiten von Chaudhry, Rothermund, Wolpert, Wynbrandt und Ganguly, die historische Aspekte, Kriegsgeschehnisse und die politischen Beziehungen zwischen Indien und Pakistan beleuchten.
Was ist das Fazit der Arbeit (voraussichtlich)?
Das Fazit wird die Ergebnisse der Analyse zusammenfassen und bewerten. Es wird untersucht, ob die Theorie des Demokratischen Friedens eine schlüssige Erklärung für den andauernden Kaschmirkonflikt liefert und ob ein direkter Zusammenhang zwischen den Regierungssystemen und den Kriegen besteht.
- Citar trabajo
- Tara Scholz (Autor), 2019, Der indisch-pakistanische Konflikt. Demokratischer Frieden oder demokratischer Krieg?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/948198