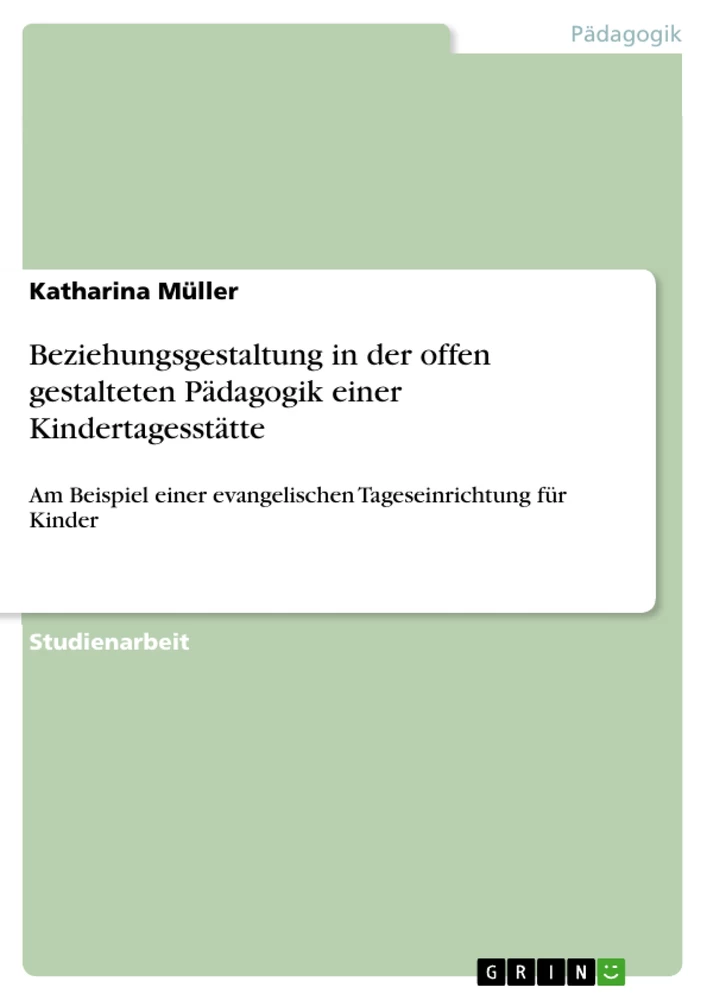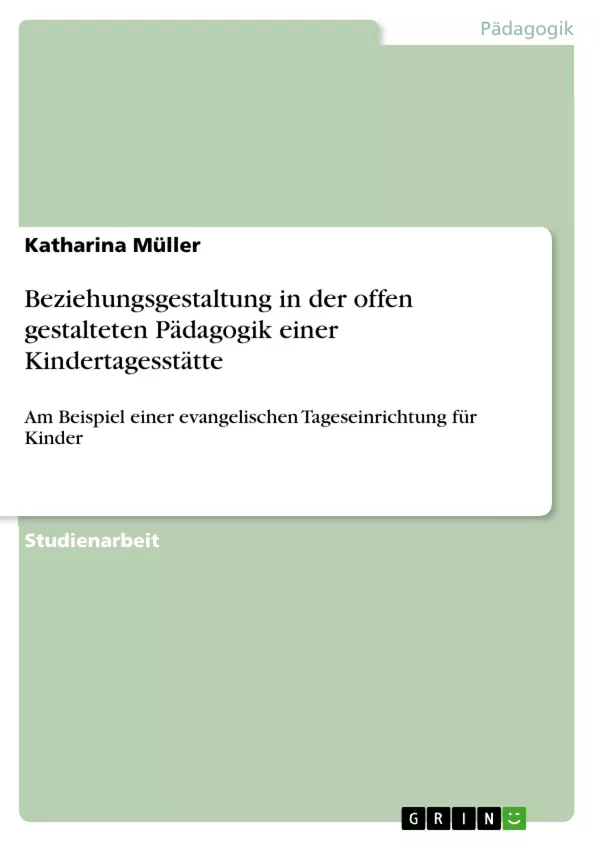In vielen Kindertagesstätten wird inzwischen auf das offene Konzept umgestellt. Doch vor allem vielen Erzieher*innen behagt die Umsetzung dessen im Alltag Sorge. Wie kann man den Überblick über die Gruppe behalten, obwohl sich doch alle Kinder frei bewegen können? Ist eine individuelle Förderungen im gleichen Maße möglich oder gehen ruhigere Kinder unter? Wie soll die Beziehungsgestaltung aussehen, wenn man einige der Kinder doch gar nicht zu Gesicht bekommt?
Die Arbeit setzt genau an dieser Stelle an. Dabei wird der Fokus auf die Beziehungsgestaltung gelegt und welche Erfolgsfaktoren dafür nötig sind. Dafür werden einerseits fachtheoretische Grundlagen und andererseits Beobachtungen aus der Praxis hinzugezogen. Eine Verknüpfung von Theorie und Praxis - zwei Seiten einer Medaille werden zusammen gebracht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorstellung der Einrichtung
- 2.1 Sozialraum, Räumlichkeiten und Gruppen
- 2.2 Pädagogischer Ansatz der Einrichtung
- 2.3 Mitarbeitende und Vorstellen des eigenen Tätigkeitsfelds
- 3. Theoretische Hintergründe
- 3.1 Bindung als Basis
- 3.2 Charakteristika, Funktionen und Faktoren von Beziehungsgestaltung
- 3.3 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
- 3.4 Konzept der offenen gestalteten Pädagogik
- 3.5 Konsequenzen für die Beziehungsgestaltung in Kindertagesstätten
- 4. Reflektion und Praxisbezug
- 4.1 Beziehungsgestaltung und Beziehungsaufrechterhaltung
- 4.2 Elternarbeit
- 5. Fazit und Ausblick
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der offen gestalteten Pädagogik für die Beziehungsgestaltung in einer evangelischen Kindertagesstätte. Sie analysiert die praktische Umsetzung des Konzepts und reflektiert dessen Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Erzieher*innen und Kindern sowie Erzieher*innen und Eltern. Die Arbeit basiert auf den Erfahrungen der Autorin in der Einrichtung.
- Beziehungsgestaltung in der offenen Pädagogik
- Herausforderungen und Bewältigungsstrategien im Kontext der offenen Gestaltung
- Die Rolle der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
- Der Einfluss des Sozialraums auf die Kita-Arbeit
- Die Bedeutung von Bindung in der pädagogischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Beziehungsgestaltung in Kindertagesstätten ein und betont deren zentrale Bedeutung für die pädagogische Arbeit. Sie thematisiert den gesellschaftlichen Wandel und dessen Einfluss auf Kindertagesstätten, insbesondere den Bedarf an U3-Betreuung und die zunehmende Bedeutung von Bildungseinrichtungen. Die Einführung der offenen gestalteten Pädagogik und die damit verbundenen Unsicherheiten bei Eltern werden als Ausgangspunkt für die Fragestellung der Arbeit genannt: Welche Herausforderungen ergeben sich aus der offen gestalteten Pädagogik für die Beziehungsgestaltung und wie sind diese zu bewältigen? Die Arbeit wird strukturiert und der methodische Ansatz skizziert.
2. Vorstellung der Einrichtung: Dieses Kapitel beschreibt die evangelische Kindertagesstätte, ihren Sozialraum (XY in XY), die räumlichen Gegebenheiten (zwei Etagen, Funktionsräume im Obergeschoss, Außengelände) und die Gruppenstruktur (Familiengruppe, T1-Gruppe, T3-Gruppe). Es werden die Öffnungszeiten und Schließzeiten der Einrichtung detailliert angegeben. Die Beschreibung betont die durch den Umbau im Jahr 2018 erfolgte Umstellung auf die offen gestaltete Pädagogik und die damit verbundenen Veränderungen der Raumgestaltung.
3. Theoretische Hintergründe: Dieses Kapitel bildet die theoretische Grundlage der Arbeit. Es beleuchtet die Bedeutung von Bindung als Basis für gelingende Beziehungsgestaltung, charakterisiert Beziehungsgestaltung und deren Funktionen sowie die Faktoren, die sie beeinflussen. Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft wird als bedeutsamer Aspekt der Beziehungsarbeit erläutert. Schließlich wird das Konzept der offenen gestalteten Pädagogik im Detail dargestellt und seine Konsequenzen für die Beziehungsgestaltung in Kindertagesstätten werden abgeleitet, die Herausforderungen und Chancen für die Beziehungsgestaltung werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Beziehungsgestaltung, Offene Pädagogik, Kindertagesstätte, Bindung, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, Sozialraum, Herausforderungen, Reflexion, Praxisbezug, Evangelische Kita.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Beziehungsgestaltung in einer evangelischen Kita mit offen gestalteter Pädagogik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der offen gestalteten Pädagogik für die Beziehungsgestaltung in einer evangelischen Kindertagesstätte. Sie analysiert die praktische Umsetzung des Konzepts und reflektiert dessen Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Erzieher*innen und Kindern sowie Erzieher*innen und Eltern. Die Arbeit basiert auf den Erfahrungen der Autorin in der Einrichtung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Beziehungsgestaltung in der offenen Pädagogik, Herausforderungen und Bewältigungsstrategien im Kontext der offenen Gestaltung, die Rolle der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, den Einfluss des Sozialraums auf die Kita-Arbeit und die Bedeutung von Bindung in der pädagogischen Praxis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Vorstellung der Einrichtung (inkl. Sozialraum, Räumlichkeiten, Gruppen, pädagogischer Ansatz und Tätigkeitsfeld der Autorin), Theoretische Hintergründe (Bindung, Beziehungsgestaltung, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, offenes Konzept), Reflektion und Praxisbezug (Beziehungsgestaltung und -aufrechterhaltung, Elternarbeit), Fazit und Ausblick sowie Literaturverzeichnis.
Wie wird die Einrichtung vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt detailliert die evangelische Kindertagesstätte, ihren Sozialraum, die räumlichen Gegebenheiten (zwei Etagen, Funktionsräume, Außengelände) und die Gruppenstruktur (Familiengruppe, T1-Gruppe, T3-Gruppe). Die Öffnungszeiten und Schließzeiten werden angegeben, ebenso die Umstellung auf offene Pädagogik durch einen Umbau im Jahr 2018.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die theoretischen Grundlagen umfassen die Bedeutung von Bindung, die Charakteristika, Funktionen und Einflussfaktoren von Beziehungsgestaltung, die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft und das Konzept der offenen gestalteten Pädagogik sowie deren Konsequenzen für die Beziehungsgestaltung in Kindertagesstätten.
Was sind die zentralen Herausforderungen der offenen Pädagogik für die Beziehungsgestaltung?
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die sich aus der offen gestalteten Pädagogik für die Beziehungsgestaltung ergeben, und diskutiert mögliche Bewältigungsstrategien. Dies umfasst die Beziehungen zwischen Erzieher*innen und Kindern sowie zwischen Erzieher*innen und Eltern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die zentralen Schlüsselwörter sind: Beziehungsgestaltung, Offene Pädagogik, Kindertagesstätte, Bindung, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, Sozialraum, Herausforderungen, Reflexion, Praxisbezug, Evangelische Kita.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten und umfasst alle Kapitel und Unterkapitel.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf den Erfahrungen der Autorin in der Einrichtung basiert.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Bereich der frühkindlichen Bildung.
- Quote paper
- Katharina Müller (Author), 2019, Beziehungsgestaltung in der offen gestalteten Pädagogik einer Kindertagesstätte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/948614