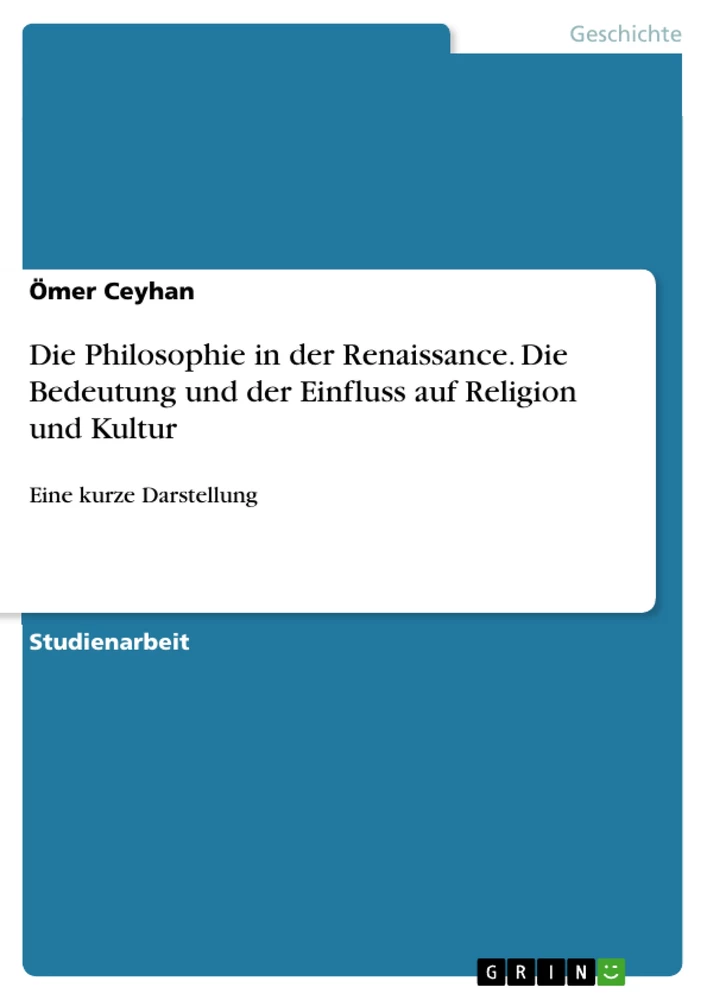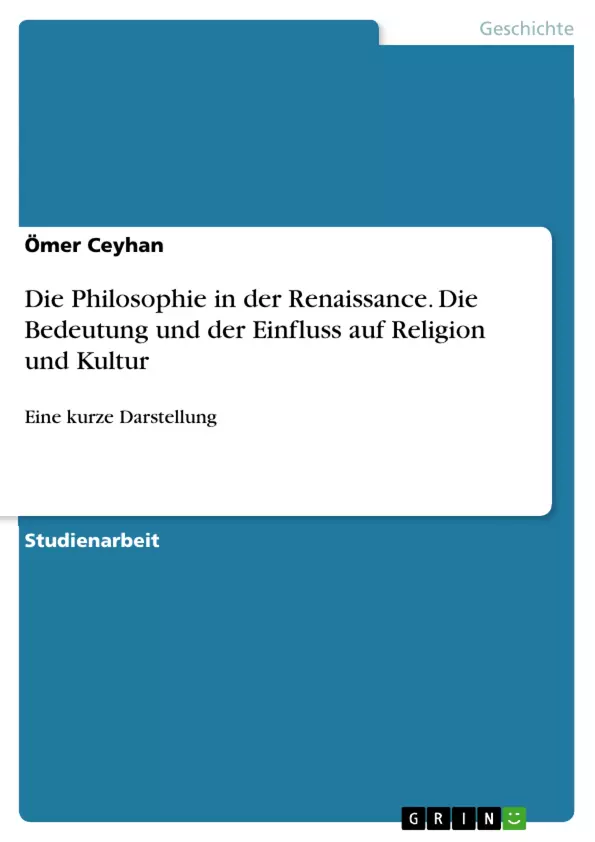Die Arbeit beschäftigt sich mit der Philosophie in der historischen Epoche der Renaissance. Zu Beginn wird dazu Renaissance definiert und auf den Menschen in der Renaissance eingegangen. Darauffolgend wird erläutert, welche Rolle die Philosophie in der Renaissance spielte. Im vierten Teil wird analysiert, welchen Einfluss die Zeitspanne der Renaissance auf die Religion hatte. Dazu werden beispielhaft Erasmus von Rotterdam und sein Bezug zur antiken Philosophie näher beleuchtet sowie die kulturellen Veränderungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist die Renaissance?
- 2.1 Begriffserklärung
- 2.2 Der Renaissance Mensch
- 3. Die Rolle der Philosophie in der Renaissance
- 4. Welchen Einfluss hat die Renaissance auf die Religion?
- 4.1 Erasmus von Rotterdam bedient sich aus der antiken Philosophie
- 4.2 War die Renaissance im Hinblick auf die Wiederentdeckung der Philosophie der Antike, ein Kulturbruch oder eine Kontinuität?
- 5. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Renaissance in Europa, insbesondere die Rolle der Philosophie in diesem Kontext und die Frage, ob sie einen Kulturbruch oder eine Kontinuität zum Mittelalter darstellt. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss antiker philosophischer Lehren auf die Renaissance-Philosophen und -Humanisten und analysiert das Verhältnis zwischen Philosophie und Religion in dieser Epoche.
- Begriffserklärung und Charakterisierung der Renaissance
- Die Rolle der Philosophie (Aristotelismus, Platonismus) in der Renaissance
- Das Verhältnis von Philosophie und Religion in der Renaissance (am Beispiel Erasmus von Rotterdam)
- Die Frage nach Kulturbruch oder Kontinuität
- Der Renaissancemensch und seine gesellschaftliche Einordnung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert die Forschungsfrage: Stellt die Renaissance einen Kulturbruch oder eine Kontinuität dar, insbesondere im Hinblick auf die Rolle der Philosophie und ihr Verhältnis zur Religion? Die Arbeit konzentriert sich auf die Rezeption der antiken Philosophie und die damit verbundenen Veränderungen und Kontinuitäten. Sie kündigt die Struktur der Arbeit an, die mit der Begriffsdefinition der Renaissance beginnt und über die Rolle der Philosophie in der Renaissance zur Frage des Kulturbruchs führt.
2. Was ist die Renaissance?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Begriffsbestimmung der Renaissance. Es wird der Begriff „Wiedergeburt“ im Kontext der Wiederentdeckung der Antike diskutiert, aber auch die problematische Vereinfachung dieses Begriffs angesprochen. Die Renaissance wird als ein Prozess und nicht als ein plötzlicher Bruch dargestellt, der weit über den Höhepunkt der Epoche zurückreicht. Die Arbeit verweist auf die komplexen Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Bereichen der Renaissance, wie Architektur, Kunst und Philosophie, und betont, dass die ästhetischen und intellektuellen Errungenschaften einen Schleier über die brutale Realität der Epoche warfen.
3. Die Rolle der Philosophie in der Renaissance: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss antiker philosophischer Schulen, wie des Aristotelikums und des Platonismus, auf die Renaissance-Philosophie. Es untersucht das Spannungsfeld zwischen Philosophie und Religion und beleuchtet, wie antike Jenseitsvorstellungen mit christlichen Vorstellungen in Beziehung gesetzt wurden. Die Arbeit vergleicht verschiedene Philosophen der Renaissance und skizziert deren unterschiedliche Positionen. Der Fokus liegt auf der komplexen Interaktion zwischen den philosophischen und religiösen Strömungen dieser Zeit.
4. Welchen Einfluss hat die Renaissance auf die Religion?: Dieses Kapitel untersucht am Beispiel Erasmus von Rotterdam, wie philosophische Lehren in die religiöse Argumentation integriert wurden. Die Analyse von Erasmus' Werk dient dazu aufzuzeigen, wie philosophische Prinzipien, wie der Stoizismus, für die Legitimation religiöser Positionen eingesetzt wurden. Es geht darum, die vielfältigen Beziehungen zwischen Philosophie und Religion aufzuzeigen und die Frage nach deren gegenseitigem Einfluss zu untersuchen. Es wird deutlich gemacht, dass nicht alle Philosophen der Renaissance einen Bruch mit der Religion suchten, sondern dass es auch Versuche der Versöhnung gab.
Schlüsselwörter
Renaissance, Philosophie, Religion, Kulturbruch, Kontinuität, Antike, Humanismus, Erasmus von Rotterdam, Aristoteles, Platon, Mittelalter, Moderne, Rationalisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Renaissance-Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der europäischen Renaissance, insbesondere der Rolle der Philosophie in diesem Kontext und der Frage, ob die Renaissance einen Kulturbruch oder eine Kontinuität zum Mittelalter darstellt. Schwerpunkt ist der Einfluss antiker philosophischer Lehren auf Renaissance-Philosophen und -Humanisten sowie das Verhältnis zwischen Philosophie und Religion in dieser Epoche.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffserklärung und Charakterisierung der Renaissance; die Rolle der Philosophie (Aristotelismus, Platonismus) in der Renaissance; das Verhältnis von Philosophie und Religion (am Beispiel Erasmus von Rotterdam); die Frage nach Kulturbruch oder Kontinuität; und der Renaissancemensch und seine gesellschaftliche Einordnung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Was ist die Renaissance?, Die Rolle der Philosophie in der Renaissance, Welchen Einfluss hat die Renaissance auf die Religion?, und Schlussteil. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Wie wird die Renaissance in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert die Renaissance nicht als einen plötzlichen Bruch, sondern als einen Prozess der Wiederentdeckung der Antike. Sie betont die komplexen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Bereichen wie Architektur, Kunst und Philosophie und weist darauf hin, dass die ästhetischen und intellektuellen Errungenschaften die brutale Realität der Epoche teilweise verdeckten.
Welche Rolle spielt die Philosophie in der Renaissance laut der Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Einfluss antiker philosophischer Schulen (Aristotelismus und Platonismus) auf die Renaissance-Philosophie. Sie untersucht das Spannungsfeld zwischen Philosophie und Religion und die Beziehung zwischen antiken Jenseitsvorstellungen und christlichen Vorstellungen. Es werden verschiedene Renaissance-Philosophen verglichen und deren unterschiedliche Positionen skizziert.
Wie wird das Verhältnis zwischen Philosophie und Religion in der Renaissance dargestellt?
Die Arbeit untersucht am Beispiel Erasmus von Rotterdam, wie philosophische Lehren in die religiöse Argumentation integriert wurden. Sie zeigt auf, wie philosophische Prinzipien (z.B. Stoizismus) zur Legitimation religiöser Positionen eingesetzt wurden und analysiert die vielfältigen Beziehungen zwischen Philosophie und Religion, einschließlich der Frage nach deren gegenseitigem Einfluss. Es wird deutlich gemacht, dass nicht alle Renaissance-Philosophen einen Bruch mit der Religion suchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Renaissance, Philosophie, Religion, Kulturbruch, Kontinuität, Antike, Humanismus, Erasmus von Rotterdam, Aristoteles, Platon, Mittelalter, Moderne, Rationalisierung.
Stellt die Renaissance einen Kulturbruch oder eine Kontinuität dar?
Diese Frage ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit. Die Arbeit untersucht, ob die Renaissance einen Bruch mit dem Mittelalter darstellt, insbesondere im Hinblick auf die Rolle der Philosophie und ihr Verhältnis zur Religion. Die Antwort wird im Laufe der Arbeit erarbeitet und diskutiert.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Renaissance in Europa, insbesondere die Rolle der Philosophie und die Frage, ob sie einen Kulturbruch oder eine Kontinuität zum Mittelalter darstellt. Sie beleuchtet den Einfluss antiker philosophischer Lehren und analysiert das Verhältnis zwischen Philosophie und Religion.
- Quote paper
- Ömer Ceyhan (Author), 2019, Die Philosophie in der Renaissance. Die Bedeutung und der Einfluss auf Religion und Kultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/948950