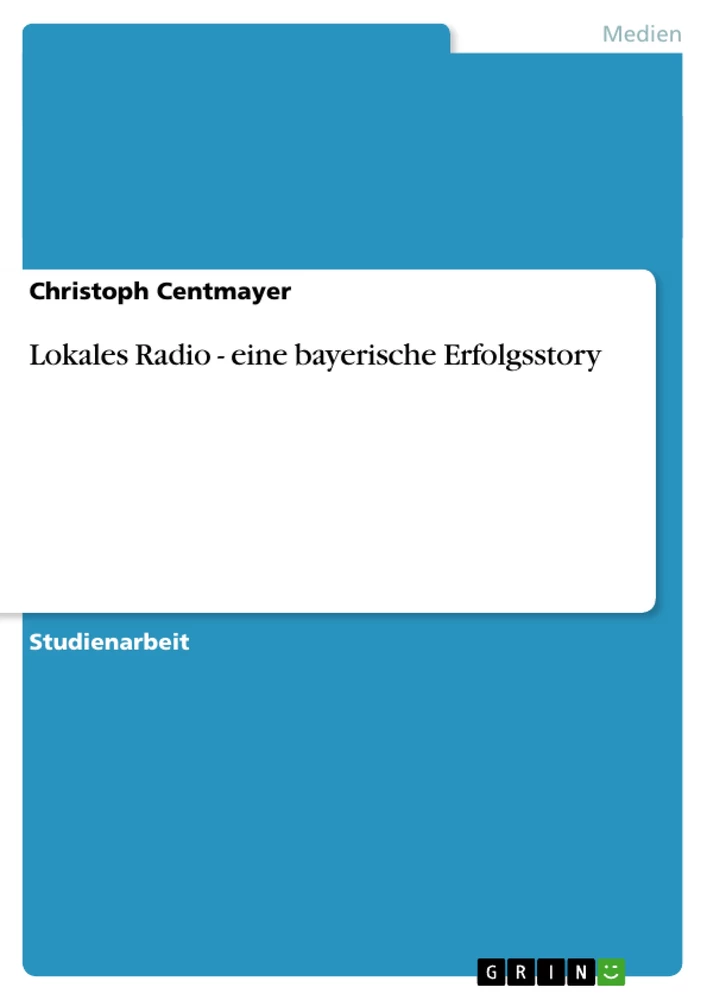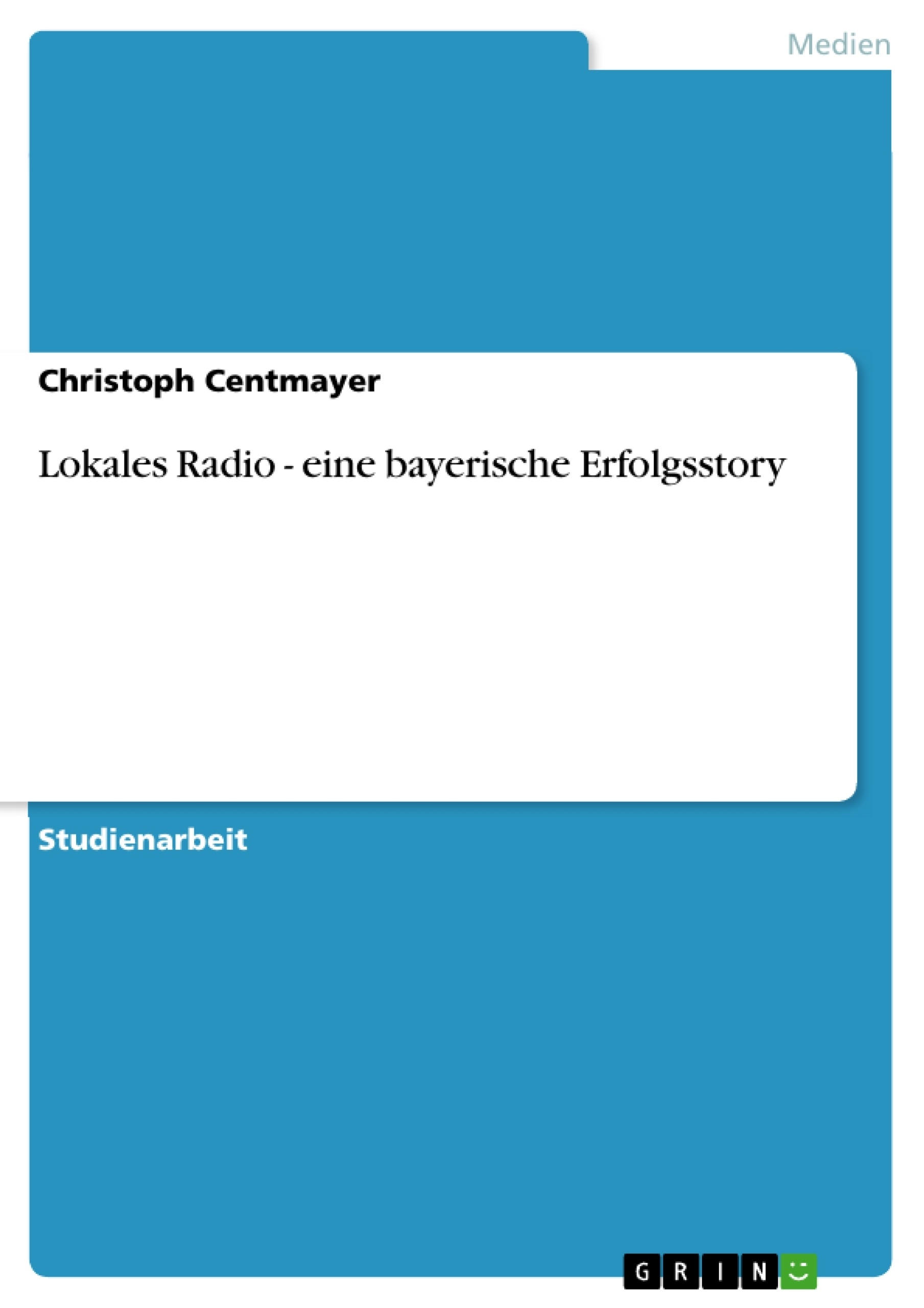Wie Bayerns Radiolandschaft zur Erfolgsgeschichte wurde: Tauchen Sie ein in die faszinierende Entwicklung des lokalen Hörfunks in Bayern, einer Pionierleistung, die bis heute Maßstäbe setzt. Diese aufschlussreiche Analyse beleuchtet die Entstehung und Etablierung des Privatradios in Bayern, von den ersten zaghaften Versuchen bis zum flächendeckenden Netz lokaler Radiostationen, die heute fester Bestandteil des bayerischen Medienangebots sind. Entdecken Sie die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die diese Entwicklung prägten, einschließlich der Rolle der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und der verfassungsrechtlichen Grundlagen, die den öffentlich-rechtlichen Charakter des privaten Rundfunks in Bayern sichern. Erfahren Sie mehr über die Funkanalyse Bayern (FA), das wichtigste Instrument zur Messung der Reichweite und Akzeptanz der Radioprogramme, und gewinnen Sie Einblicke in die wirtschaftliche Situation der lokalen Hörfunkanbieter, die sich trotz anfänglicher Schwierigkeiten zu stabilen Unternehmen entwickelt haben. Das Fallbeispiel Radio Oberland in Garmisch-Partenkirchen veranschaulicht die Programmstruktur, die Zielgruppen und die Erfolge eines typischen bayerischen Lokalradios. Die Untersuchung der Qualitätssicherung im Hörfunkmarkt gibt eine Ausblick auf die Herausforderungen der Zukunft, insbesondere im Hinblick auf Konzentrationsgrenzen, Meinungsvielfalt und den journalistischen Anspruch an ein eigenständiges Radioprogramm. Diese umfassende Darstellung bietet nicht nur einen detaillierten Überblick über die Geschichte und Gegenwart des lokalen Hörfunks in Bayern, sondern wirft auch wichtige Fragen nach der Zukunft der Medienlandschaft in einer sich ständig verändernden Welt auf. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Medienpolitik, Rundfunkgeschichte und die Erfolgsfaktoren regionaler Medien interessieren. Die Analyse der Hörerzahlen, Marktanteile und wirtschaftlichen Kennzahlen bietet wertvolle Einblicke für Medienexperten, Werbetreibende und alle, die die bayerische Radiolandschaft besser verstehen möchten.
Inhaltsverzeichnis
1. Lokales Radio - eine bayerische Erfolgsstory
2. Lokaler Hörfunk in Bayern
2.1 Das Lokalfunkkonzept
2.2 Entstehung und Entwicklung
2.3 Rechtliche Situation
2.3.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen
2.3.2 Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien
2.4 Zahlen und Fakten
2.4.1 Die Funkanalyse
2.4.2 Wirtschaftliche Situation
3. Fallbeispiel Radio Oberland
3.1 Allgemeines
3.2 Entstehungsgeschichte und Entwicklung
3.3 Programmstruktur
3.4 Ergebnisse der Funkanalyse
5. Qualitätssicherung in der Zukunft Literaturverzeichnis
1. Lokales Radio - eine bayerische Erfolgsstory
Das sogar deutschlandweit erste terrestrisch empfangbare Privatradio ist heute noch in München auf der Frequenz 96,3 MHz zu hören - Radio Gong, das damals noch Radio Gong 2000 hieß und als einer der ersten Anbieter eine Lizenz zur Ausstrahlung eines lokalen Hörfunkprogramms erhielt. Bis zu dieser "Geburtsstunde" des privaten Rundfunks war es aber ein langer Weg, unendliche, teilweise hitzige Diskussionen über die Tragfähigkeit und die Rechtmäßigkeit von lokalem Hörfunk und privatem Rundfunk im allgemeinen wurden geführt. Schließlich gab es Pilotversuche und erste zaghafte Anfänge, Bayern stand dabei jedesmal in erster Reihe. Schließlich verschrieb man sich hierzulande vollends der Idee eines eigenständigen und unabhängigen lokalen Rundfunks, der der Vielseitigkeit der einzelnen Regionen Bayerns gerecht werden sollte.
Das heutige Ergebnis, ein flächendeckendes Netz einzelner lokaler Radiostationen, kann sich somit sehen lassen - und ist überdies auch noch erfolgreich, sowohl wirtschaftlich wie auch in der Akzeptanz bei den Hörern, wie es die Ergebnisse der Funkanalyse Jahr für Jahr aufs Neue zeigen. Das Konzept des lokalen Radios kann man so durchaus auch als eine "bayerische Erfolgsstory" bezeichnen, die sich allen Zweifeln zum Trotz ihren Weg bahnte. Wie sich diese genau begibt, möchte ich in der vorliegenden Arbeit darstellen.
2. Lokaler Hörfunk in Bayern
2.1 Das Lokalfunkkonzept
Beim Konzept des Privaten Hörfunks in Bayern, wie es von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), die ich später noch genauer vorstellen möchte, entwickelt, aufgebaut und heute kontrolliert wird, spricht man auch vom Dualen System. Dies bedeutet, daß fast flächendeckend in ganz Bayern je zwei private Hörfunkfrequenzen existieren. Eine davon fällt einem landesweiten Privatprogramm zu, dies ist seit 1989 ANTENNE BAYERN. Die andere Senderkette wird an lokale Hörfunkanbieter vergeben, so daß es also in allen Regionen über den ganzen Freistaat hinweg neben dem landesweiten Sender jeweils ein privates lokales Radio zu hören gibt. Eine Ausnahme hiervon bilden lediglich die sechs Mehrfrequenzstandorte München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg und Hof, bei denen sich mehrere lokale Radioprogramme um die Gunst der Hörer streiten. Den lokalen Radios fällt dabei ein besonderer Programmmauftrag zu, der von der BLM vorgegeben und überwacht wird und der sie gegenüber dem übrigen Hörfunkangebot, ob landes- oder bundesweit, hervorhebt. So sollen sie die Hörerschaft vor allem auch mit lokalen Nachrichten und Informationen versorgen, die diese bei den anderen Hörfunksendern ja unmöglich bekommen könnten. Diese "...umfassende Lokal-berichterstattung wird von den Hörern (...) als eine exklusive Leistung der Lokalradios erkannt und honoriert.", so das BLM- Jahrbuch 1993/941. Auf programmliche Strukturen der Lokalradios, auch anhand des gewählten Fallbeispiels Radio Oberland in Garmisch-Partenkirchen, werde ich aber später noch näher eingehen.
2.2 Entstehung und Entwicklung
Ein erster Meilenstein in der Entstehung des lokalen Hörfunks in Bayern war sicherlich das 1982 angegangene Kabelpilotprojekt in München, zurückgehend auf einen Beschluß der Ministerpräsidenten der Länder von 1978 über Versuche mit Breitbandkabeln und anderen Kommunikationstechniken. Sendebeginn dieses Pilotversuches, bei dem 11 Hörfunkanbieter zum Zuge kamen, war April 1984. Durch das Inkrafttreten des bayerischen Medienerprobungs- und -entwicklungsgesetzes (MEG) am 1.12.1984 und die ebenfalls 1984 in Genf abgehaltene internationale Frequenzkonferenz, bei der die Audehnung des Radiobereichs um 8MHZ auf die Frequenzen von 100 MHz bis 108 MHz beschlossen wurde und diese unter den Ländern verteilt wurden, "...kam es zur entscheidenden technologischen Innovation" für den Hörfunk. Nun "...waren genügend Frequenzen für die Realisierung zweier zusätzlicher landesweiter Hörfunkketten (...) geschaffen."2 Somit war schließlich auch eine Ausweitung auf terrestrische Übertragung der Radioprogramme möglich. Im Frühjahr 1985 wurden dafür drei Frequenzen für München zur Verfügung gestellt, die von der damaligen Münchner Pilot-Gesellschaft für Kabelkommunikation mbH (MPK), deren Aufgaben später die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) übernahm, an drei Anbietergemeinschaften vergeben wurde, die sie aus ursprünglich 23 Lizenzbewerbern ausgewählt hatte. München war damit in der Bundesrepublik Deutschland die erste Stadt, in der es terrestrische Frequenzen für Lokalradios gab.
1986 wurde dann die Etablierung des lokalen Hörfunks in Bayern planmäßig angegangen. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) stellte einen Frequenzplan auf, der auf die Dauer von acht Jahren, also bis 1994, die Inbetriebnahme von insgesamt 127 flächendeckend über ganz Bayern verteilte Frequenzen vorsah. Dies entspräche dann dem Endausbau des lokalen Hörfunks in Bayern. 1990 waren dafür bereits 91 Frequenzen geschaffen, auf denen 42 verschiedene Radioprogramme ca. 73% des bayerischen Publikums versorgten.3
Heute sind dies schließlich 57 verschiedene Lokalradioprogramme,die über 127 Frequenzen in 38 Sendegebieten ausgestrahlt werden - wobei die Mehrfrequenz-standorte München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg und Hof hier hervorzuheben sind - was eine fast flächendeckende Versorgung des Landes Bayern bedeutet, nämlich 90% der bayerischen Bevölkerung, was insgesamt, also mit den Hörern in den an Bayern angrenzenden Gebieten in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, Sachsen, Österreich und der Schweiz, etwa 10 Millionen Zuhörern entspricht.4 Bayern ist damit in Deutschland in Sachen Privatfunk auch das am vielfältigsten erschlossenste Bundesland.
2.3 Rechtliche Situation
2.3.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen
Die besondere rechtliche Situation des privaten Rundfunks in Bayern ist die der öffentlich- rechtlichen Trägerschaft. Diese "raffinierte Rechtskonstruktion"5 ist vor allem eine Folge des erfolgreichen Rundfunkvolksbegehrens in Bayern von 1973, das, damals von SPD, F.D.P und Gewerkschaften initiiert, die dem "...wachsenden Einfluß des Staates im Bayerischen Rundfunk (BR) sowie den möglichen Privatfunkplänen der CSU langfristig ,einen Riegel vor(...)schieben´"6 wollten, eine Änderung der Bayerischen Verfassung zur Folge hatte. Artikel 111a, Absatz 2 schreibt seither die öffentliche Verantwortung und die Pluralität für den Rundfunks in Bayern vor:
"Rundfunk wird in öffentlicher Verantwortung und in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft betrieben. An der Kontrolle des Rundfunks sind die in Betracht kommenden bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen angemesen zu beteiligen. Der Anteil der von der Staatsregierung, dem Landtag und dem Senat in die Kontrollorgane entsandten Verteter darf ein Drittel nicht übersteigen. Die weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen wählen oder berufen ihre Vertreter selbst."7
Ein Folgeprodukt dieser Bestimmmung ist die Existenz der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), die als Anstalt des öffentlichen Rechts die Trägerschaft für alle privaten Programme in Bayern übernimmt. Zwar gibt es auch in den anderen Bundesländern Medienanstalten zur Kontrolle des privaten Rundfunks. Die Besonderheit in Bayern ist aber die öffentlich-rechtliche Trägerschaft der BLM für die privaten Programme, die ihr eine "...eindeutige Programmgestaltungskompetenz..." zuweist. Damit tragen die Privaten nicht selber die Verantwortung für die von ihnen produzierten Programme (diese liegt bei der BLM), und sind daher offiziell auch nicht Veranstalter, sonder nur Anbieter ihrer Programme.
Diese programmlichen Aufgaben der BLM sind zudem noch auf 19 auf ganz Bayern verteilte örtliche Kabelgesellschaften übertragen, die eine Vorauswahl der Bewerber um eine Lizenz als Programm-Anbieter vornehmen. Die genaue Struktur und die Aufgaben der BLM werden im folgenden Kapitel dargestellt.
2.3.2 Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)
Im folgenden Abschnitt möchte ich die Struktur und die Aufgaben der Bayerishcen Landeszentrale für neue Medien (BLM) etwas näher erläutern. Auf die besondere Stellung der BLM als öffentlich-rechtlicher Träger des privaten Rundfunk in Bayern, die durch Artikel 111a der Bayerischen Verfassung gewährleistet wird, habe ich ja im vorangegangenen Kapitel schon hingewiesen. Das Bayerische Mediengesetz (BayMG), das, im November 1992 verabschiedet, die Nachfolge des oben schon erwähnten Medienerprobungs- und - entwicklungsgesetzes (MEG) darstellt, regelt die Aufgaben der BLM näher. Art. 11 führt hier unter anderem die Zulassung von Rundfunkanbietern, die Kontrolle der verbreiteten Programme, die Aus- und Fortbildung, die Forschung und die Programmförderung an.8 Wie bereits erwähnt stehen unter dem Dach der BLM die 19 regionalen Medien- Betriebsgesellschaften (MBG), die mit den einzelnen Hörfunkanbietern, die ihre Genehmigung zur Verbreitung eines Radioprogramms von der BLM erhalten, einen Vertrag über die Produzierung dieses Programms schließen.
Die BLM, der ein Präsident vorsteht, der die Medienzentrale nach außen vertritt und die Verantwortung für die Geschäftsführung übernimmt, ist unter dem Geschäftsführer in die fünf Bereiche Recht, Verwaltung, Technik, Programm und Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Medienwirtschaft aufgeteilt. Der BLM beigeordnet ist der Vewaltungsrat, der vor allem für haushaltliche Angelegenheiten zuständig ist, und schließlich der Medienrat, der wiederum untergliedert ist in Hörfunk-, Fernseh-, Programm-, Technik-, Grundsatz- und beschließenden Ausschuß.
Dem Medienrat ,gleichzeitig das höchste Entscheidungsgremium der BLM, wird alle vier Jahre gewählt und ist nach dem gleichen Prinzip wie der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks zusammengesetzt, nämlich nach dem ständisch-parlamentarischen Prinzip. Ihm gehören insgesamt 50 Vetreter des Parlaments, der Bayerischen Staatsregierung und des Bayerischen Senats sowie gesellschaftlich relevanter Gruppen an. Mit letzteren soll auch die Bevölkerung repräsentiert werden, die ja schließlich die ausgestrahlten Programme empfängt und rezipiert. Diese hat auch die Möglichkeit, sich mit eventuellen Beschwerden über diese Programme direkt an die BLM zu wenden, die ja aufgrund der erwähnten öffemtlichrechtlichen Trägerschaft für den Privatfunk für die ausgestrahlten Programme verantwortlich ist.
Der Medienrat hat hierbei weitreichende Kompetenzen in Bezug auf Auswahl und Lizenzierung von privaten Programmanbietern, sowie auch bei der Kontrolle der von ihnen verbreiteten Programme, im Konkreten über die Einhaltung der Regelungen des Bayerischen Mediengesetzes (BayMG) und des Rundfunkstaatsvertrages. Hier sind speziell die Vielfaltsbestimmungen wichtig, die eine Obergrenze von 30% Marktanteil für einen Rundfunkanbieter vorsehen. Außerdem wird natürlich die Einhaltung der von der BLM genehmigten Programmschemata der privaten Anbieter überwacht. Zum Zwecke der Aus- und Fortbildung wurde die AFK GmbH, was für Aus- und Fortbildungskanal steht, gegründet, bei der die BLM Gesellschafterin ist und an der auch die Medienunternehmen mit 37%beteiligt sind. Unter ihrem Dach laufen der AFK-Kanal in Nürnberg und zwei zur Ausbildung genutzte Radiostationen in München und Nürnberg. Der Aufgabe Forschung wird die BLM vor allem mit der jährlich von ihr in Auftrag gegebenen Funkanalyse gerecht, die die Rezeption aller in Bayern ausgestrahlten Hörfunk- und Fernsehprogramme untersucht und somit verläßliche Daten über die Reichweiten und den Marktanteil der einzelnen Programme liefert, die auch aufschlußreich für die werbetreibende Wirtschaft sind, die auf diesen privatwirtschaftlich finanzierten Programmen wirbt und somit diese schließlich auch finanziert. Auf die Funkanalyse, ein sehr wichtiger Baustein in der Arbeit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien werde ich im nun folgenden Kapitel näher eingehen.
2.4 Zahlen und Fakten
2.4.1 Die Funkanalyse
Die Funkanalyse Bayern (FA) wird jährlich von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) bei der Infratest Burke Kommunikationsforschung in Auftrag gegeben. Finanziell beteiligen sich auch die Medienbetriebsgesellschaften un ddie bayerischen Programmmanbieter hieran, nicht ohne Grund, schließlich sind diese auch an verläßlichen Zahlen über den Erfolg und die Akzeptanz ihrer Programme interessiert, was ihnen wieiederum die benötigten Werbeeinnahmen sichert. Die Funkanalyse gilt hierbei als der Bewertungsschlüssel für die Marktpreise der Werbung in den Programmen. Ausschlaggebend ist hierbei vor allem die Tagesreichweite der Sender, sie mißt alle Hörer, die am entsprechenden Tag das betreffende Programm mindestens eine Viertelstunde lang gehört haben. Die Untersuchung wird jährlich von Januar bis März bei ca. 24.000 Personen ab 10Jahren (Zahlen von 1997) nach der Tagebuchmethode durchgeführt.
Die Lokalradios zeichnen sich hierbei durch einen stetigen Anstieg der Hörer aus, was sie mittlerweile als absolutes Erfolgsprodukt auf dem bayerischen Radiomarkt kennnzeichnet - und den anfänglichen Skeptikern, die sich bei der Einführung des privaten Hörfunks zu Wort meldeten, Lügen straft. Die Funkanalyse macht es so möglich, die Leistungsfähigkeit der bayerischen Programme zu belegen, und erfüllt somit auch die gesetzliche Aufgabe der BLM, mittels dieser Forschungsergebnisse auf positive wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Sender hinzuwirken.
Nach der aktuellen Funkanalyse Bayern 1997 haben die Lokalradios ihre Spitzenstellung unter den bayerischen Programmen, die sie seit 1994 innehaben, als sie das erstemal Bayern 1 überrunden konnten, behauptet, wobei sie jedoch gegenüber 1996 leicht verloren haben. Mit 28,3% Tagesreichweite bei den über 14jährigen erreichen sie aber mehr Hörer als die landesweiten Programme. An zweiter Stelle in der Hörergunst liegt Bayern 1 mit 27,5%, darauf folgt das einzige landesweite private Programm ANTENNE BAYERN, das mit 21.8% den Abstand zum öfentlich-rechtlichenKonkurrenzprodukt Bayern 3 vergrößern konnte, welches nur noch 18,7% der Hörer erreicht. Bei den Spartenprogrammen liegt B5 aktuell mit 4,7% vor Bayern 2 Radio mit 4,4% und Bayern 4 Klassik mit 2,9%. Spitzenreiter unter den Lokalradios ist nach der neuesten Funkanalyse Radio Plassenburg mit 42% Reichweite. Insgesamt wurde an einem durchschnittlichen Tag 1997 166 Minuten Radio gehört. Die Lokalsender besetzen dabei mit 40 Minuten einen Marktanteil von 24% hinter Bayern 1 mit 45 Minuten und einem Marktanteil von 27%. Dahinter folgen ANTENNE BAYERN mit 20 % oder 34 Minuten und Bayern 3 mit 13% oder 22 Minuten. Bei der Untersuchung werden die Befragten auch regelmäßig nach ihrer Bewertung der einzelnen Radioprogramme gefragt. Bei den Lokalradios wird hier vor allem eine sehr hohe Einschätzung der Bürgernähe durch die Hörer deutlich.9
Bei den sechs Mehrfrequenzstandorten liegen die Reichweiten der Lokalsender natürlich über dem landesweiten Durchschnitt, so etwa in München bei 34,3% oder in Nürnberg bei 40,3%, teilen sich allerdings logischerweise auf mehrere Anbieter auf verschiedenen Frequenzen auf, so daß deren einzelne Reichweiten in fast allen Fällen niedriger als der Durchschnitt liegen. Natürlich muß hier aber erwähnt werden werden, daß die Einzugsgebiete dieser Sender wiederum mehr Einwohner beherbergen, womit dann letztendlich auch diese Sender, gemessen an der absoluten Hörerzahl, relativ viele Menschen erreichen. Insgesamt haben sich aber die Lokalradios, wie aus den Zahlen ersichtlich, als stabile Größe in der bayerischen Hörfunklandschaft etabliert. Dabei ist zu bemerken, daß die erfolgreichen Zahlen der lokalen Anbieter kontinuierlich seit den Anfängen eine relativ stetig ansteigende Kurve bilden.
2.4.2 Wirtschaftliche Situation der lokalen Hörfunkanbieter
Anfänglich gestaltete sich die wirtschaftliche Situation der lokalen Hörfunkanbieter sehr schwierig und schien den vielen Skeptikern, die sich in der Diskussion um die Einführung des privaten lokalen Hörfunks immer wieder zu Wort meldeten, Recht zu geben. In den ersten fünf Jahren gab es veilerorten Verluste, da das lokale Radio auch erst sehr spät als Werbemedium akzeptiert wurde. Benachteiligend wirkte sich hierbei auch die bayerische Konstellation der der BLM untergeordneten Medienbetriebsgesellschaften aus, die wiederum Kosten verursachten und Gebühren verlangten, sowie - so schien es zumindest anfangs - auch der relativ kleine Zuschnitt der Sendegebiete.
Der Kostendeckungsgrad stieg dabei jedoch kontinuierlich an, und seit 1993 werden insgesamt gesehen schwarze Zahlen geschrieben. ¾ der lokalen Anbieter senden heute in der Gewinnzone. Hiermit wurde dann schließlich doch noch nachgewiesen, daß die kleinen Einzugsgebiete nicht für die anfangs schlechte Ertragslage der Sender verantwortlich gemacht werden konnten. "Erfolg oder Mißerfolg der Lokalradios hängt damit nicht primär von der Größe des Einzugsgebietes ab."10
Beigetragen zum Aufschwung haben aber auch finanzielle Hilfen der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, die natürlich von Anfang an darauf bedacht war, "ihre" Lokalradios in wirtschaftlich sichere Unternehmen zu verwandeln. Um Kosten zu sparen, wurde etwa die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Anbietern forciert, als Beispiel sei hier nur das Funkhaus in Nürnberg genannt, in dem verschiedene Anbieter auf unterschiedlichen Frequenzen unter dem gleichen Dach produzieren. Schließlich wurde im April 1991 die Bayerische Lokalradio GmbH (BLR), eine Gründung der einzelnen Anbieter, mit dem Ziel gestartet, kleinere Anbieter bei der Programmproduktion zu entlasten. Sie liefert seitdem ein Zulieferprogramm an 41 Sender, das diese in "schwächeren" Zeiten wie etwa nachts oder am Wochenende übernehmen, produziert aber auch überegionale Nachrichten und Beiträge, die danneinzeln übernommen werden können. Parallel zur BLR entstand 1990 die Bayerische Lokal-Radiowerbung GmbH, die sich um Vermarktungsverträge bemüht, um auch den überregionalen Werbemarkt bedien zu können, teilweise auch in Verbund mit dem landesweiten privaten Programm von ANTENNE BAYERN. Dabei muß erwähnt werden, daß die Genehmigungen zu diesen überregionalen Gesellschaften schon eine Trendwende in der Politik der BLM bedeuteten, die anfangs jegliche solche kooperativen Bestrebungen aus Angst um die Meinungsvielfalt und die Eigenständigkeit des lokalen Hörfunks verhinderte. Für die Zukunft werden allerdings für die Anbieter weiter Investitionen nötig. So werden einerseits Kostensteigerungen bei Personal und Technik erwartet, auf der anderen Seite muß man sich neuer Konkurrenz wie Digital Audio Broadcasting (DAB) oder dem Digitalen Satelliten Radio (DSR) stellen. Schließlich und nicht zuletzt muß auch auf den Wirtschaftsfaktor Lokalfunk hingewiesen werden, der insgesamt immerhin um die 1700 neue Arbeitplätze geschaffen hat.
Damit zeigt sich das lokale Radio vor allem in Bayern sehr erfolgreich, wobei durchaus noch Steigerungen möglich wären, da das Werbepotential noch nicht volkommen ausgeschöpft ist. So liegt der Anteil der Radios am lokalen Werbemarkt bei nur 3% - gegenüber der Tageszeitung mit 45%.11
3. Fallbeispiel Radio Oberland
3.1 Allgemeines
Radio Oberland, das ich im folgenden letzten Teil dieser Arbeit als ein Beispiel für ein bayerisches Lokalradio vorstellen möchte, sendet vom Standort Garmisch-Partenkirchen aus über das bayerische Oberland, genauer gesagt über die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Teile der Landkreise Landsber/Lech, Starnberg und Bad Tölz und der Ammersee-Region. Ausgestrahlt wird das Programm über die vier Sender Garmisch- Partenkirchen, Peißenberg, Oberammergau und Mittenwald und natürlich auch die Kabelnetze in dieser Region. Damit erzielt Radio Oberland ein Empfangspotential von 180.000 bis 220.000 Menschen. Anzumerken gilt es hierbei, daß das Sendegebiet zugleich "Deutschlands Ferienregion Nr.1" ist, was zusätzlich etwa sechs Millionen Touristen jährlich als "potentielle Hörer" bedeutet.
Das Hauptstudio von Radio Oberland liegt in Garmisch-Partenkirchen, ein weiteres Studio gibt es in Weilheim. Da die Region Garmisch-Partenkirchen ein sogenannter Einfrequenzstandort ist, Radio Oberland also der einzige lokale Hörfunkfunkanbieter hier ist, besteht praktisch "nur" die Konkurrenz zu den Programmen des Bayerischen Rundfunks und zu ANTENNE BAYERN.
Der Veranstalter des Programms ist die Radio Oberland Programmanbieter GmbH&Co, Vermarktungs KG mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen. Die Gesellschafter-Struktur dieser GmbH sieht wie folgt aus: 50% hält die Radio und TV GAP GmbH, 33% der Zeitungsverlag Oberbayern Gmbh&Co und weitere 17% die Schongauer Nachrichten Gmbh, Karl Motz GmbH&Co KG. Hier sieht man also das auch andernorts typische Engagement der Zeitungsverleger im lokalen Hörfunk. Radio Oberland beschäftigt neun feste und 15 freie Mitarbeiter.12
3.2 Entstehungsgeschichte und Entwicklung
Bereits im April 1992 wurde von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) die Genehmigung für die Radio Oberland Programmanbietergesellschaft erteilt. Damals war das Sendegebiet noch für die vier Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Bad Tölz und Miesbach vorgesehen, um eine ausreichende Hörerreichweite zu gewährleisten. Das Radio sollte im Sommer´ 92 auf Sendung gehen. Schließlich wurde aber der Sendebeginn doch bis zum Jahresende verschoben und das Sendegebiet auf die zwei Landkreise Garmisch- Partenkirchen und Weilheim reduziert.13 Start des Senders war dann schließlich der 31.12.1992.
"Regionale Gruppen und Vereine sollen im Oberlandradio ein Sprachrohr finden, und Berichte über Landwirtschaft und Brauchtum regelmäßige Programmittelpunkte bilden. Auch über sportliche Ereignisse in der Region wird zu hören sein. Einen "intensiven Hörerdialog" streben die Radiomacher an, um auch auf diese Weise ein "signifikantes Profil mit hohem Wiedererkennungswert" zu erreichen.", schrieb die Süddeutsche Zeitung vor Sendebeginn im Frühjahr 1992.14
Ein recht gutes Beispiel für den teilweise doch recht erbittert geführten Konkurrenzkampf mit den öffentlich-rechtlichen Sendern war der Streit um die Senderfrequenz in Garmisch- Partenkirchen Anfang der Neunziger Jahre. Radio Oberland sendete damals noch auf 99,4 MHz, was sehr nah an der Frequenz von Bayern 3 am Peissenberg (99,2 MHz) lag. Für Radio Oberland ging es dabei um die wichtigste Frequenz, sozusagen das Herzstück der Region, in Garmisch-Partenkirchen leben schließlich di meisten Einwohner des Sendegebietes. Ein besserer Empfang hätte mehr Stammhörer binden können und damit wiederu auch mehr Werbekunden angelockt. Eineinhalb Jahre lang kämpften die Verantwortlichen von Radio Oberland folglich mit der BLM und der Telekom um eine günstigere Frequenz. Erst im Januar 1995 hatte das Tauziehen ein Ende und der Sender konnte mit der neuen Garmischer Frequenz 106,2 MHz den Erfolg für sich verbuchen. "Für Knoll (Anm.d.Verf.: Leiter von Radio Oberland) ist das Verhalten der Landeszentrale für neue Medien und der Telekom ein "Skandal". Monatelang seien Unterlagen überhaupt nicht bearbeitet worden. Er vermutet hinter der Verzögerung eine allzu große Rücksicht auf den Bayerischen Rundfunk.", so der Münchner Merkur im Januar 1995.15
3.3 Programmstruktur
Das Format von Radio Oberland wird Adult Contemporary - Oldie-based genannt, es herrscht auch ein großer Anteil an deutschen Titeln vor. Sendezeit ist 24 Stunden rund um die Uhr, allerdings wird nur tagsüber von 6.00Uhr bis 20.00Uhr (Montag bis Freitag), am Wochenende von 8.00Uhr bis 18.00Uhr (Samsatg) bzw. von 8.00Uhr bis 19.00 oder 22.ooUhr (Sonntag) ein eigenproduziertes Programm gesendet. In der restlichen Zeit, also abends und nachts, übernimmt Radio Oberland das oben schon angesprochene Zulieferprogramm der Bayerischen Lokalradio GmbH (BLR).
Der Schwerpunkt des Programms liegt natürlich auf lokalen Informationen, so lautet auch der Slogan von Radio Oberland "total lokal". Nach einer vom Sender selbst durchgeführten (nicht-repräsentativen) Umfrage vom Oktober 1996 ist das auch der Hauptgrund für die meisten Hörer, das Programm einzuschalten. Damit ist bereits der wichtigste Auftrag der Lokalradios, die Hörer mit lokalen Informationen aus der Region zu versorgen (siehe Kap. 2.1), erfüllt. Diese Informationen kommen vor allem morgens und mittags, also zu Zeiten, in denen viele Zuhörer erreicht werden; in nachfrageschwächeren Zeiten wie beispielsweise vormittags gibt es dagegen auch Nonstop-Musikstrecken. Ansonsten kann man von einem ausgewogenen und eher gemischten Programm sprechen, wie auch die Hörerschaft relativ ausgewogen zusammmengesetzt ist. So werden einerseits zwar Hits und Oldies gespielt, aber andererseits am Abend und Sonntag morgens auch Volksmusik. Laut der bereits zitierten Umfrage kommt diese Mischung aber anscheinend auch recht gut beim Publikum an. So gab es bei der Frage nach der bevorzugten Musik im Programm viele unterschiedliche Meinungen, wie etwa Rock, Charts, Pop, Schlager, deutscher Pop oder eben auch Volksmusik. Hierbei wird wohl nochmals deutlich, wie sehr bei diesen unterschiedlichen Vorlieben doch die lokalen Informationen einer der aus-schlaggebenden Gründe für die Rezeption des Programms sind. Man muß dabei aber auch bedenken, daß es für ein Lokalradio unklug wäre, musikalisch eine spezielle Nische zu besetzen, da es an den Einfrequenzstandorten ja nur ein Programm gibt, das somit auch versuchen sollte, alle Hörer im Sendegebiet anzusprechen. Auch dies ist ein Grund für die vielfältige Mischung in der Musikauswahl bei vielen lokalen Stationen, wie eben auch bei Radio Oberland. Eine Spezialität des Senders sind schließlich die ausführlichen Berichte von den Eishockey- Spielen des örtlichen Vereins SC Riessersee, die auch regelmäßig sonntags live übertragen werden. Hiermit wird einerseits der lokale Bezug hergestellt und andererseits wiederum viele unterschiedliche Hörerschichten angesprochen.
Die Zielgruppe von Radio Oberland wird mit 25 bis 50 Jahren angegeben, die Kernzielgruppe mit 25 bis 39 Jahren.
3.4 Ergebnisse der Funkanalyse
Auch für Radio Oberland zeigt die Erfolgskurve nach oben. Die Tagesreichweite verbesserte sich 1997 auf 16,3% gegenüber 15% (1996) und 12% (1995) in den Vorjahren. 1993 hatte sie noch bei 7% gelegen. Damit liegt Radio Oberland in seinem Sendegebiet auf Platz 4 hinter Bayern 1 (31%), ANTENNE BAYERN (27%), und Bayern 3 (19%). Beim Marktanteil liegt Radio Oberland mit 12% hinter Bayern 1 und ANTENNE BAYERN mit je 29% und Bayern 3 mit 18 % (Zahlen von 1996).
Unterschiedliche Zahlen ergeben sich wiederum, wenn man sich die einzelnen Altersschichten genauer ansieht. So hat hier Radio Oberland - seiner Zielgruppe entsprechend - die größte Hörerschaft unter den 30 bis 49jährigen. Mit 23,1% liegt es in dieser Gruppe bereits auf Platz zwei hinter ANTENNE BAYERN.16
5. Qualitätssicherung in der Zukunft
Das Lokalradiokonzept, wie es in den Achtziger Jahren für Bayern entwickelt wurde, ist heute praktisch vollendet. Das ganze Land ist überzogen mit örtlichen Radiostationen, in naher Zukunft wird es wohl keinen weiteren größeren Ausbau geben, von einigen zusätzlichen Sendern einmal abgesehen. Allein die heutige Frequenzknappheit spricht dagegen. Somit ist der heutige Stand der bayerischen Rundfunklandschaft sozusagen als Status Quo anzusehen. Diese Situation verlangt aber gerade, ein noch stärkeres Augenmerk auf die gesendeten Programme, auf deren Qualität, deren Vielseitigkeit und Ausgewogenheit zu richten, um den Standard im Hörfunkmarkt zu erhalten. Ein wichtiger Punkt und folglich bis auf weiteres in der Diskussion werden hier vor allem Konzentrationsgrenzen sein. Die Verflechtungen, auch im lokalen Rundfunkmarkt, sind immens, und hier wird es die Aufgabe sein, die Meinungsvielfalt und Pluralität in diesen Medien zu sichern.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der sich aufdrängt, ist aber auch der Anspruch und die Qualität der Programme. Zwar liegen diese natürlich außerhalb der Möglichkeit von Bestimmungen und Richtlinien, und orientieren sich selbstverständlich, wie in der freien Wirtschaft üblich, überwiegend am Markt, also auch an den Hörgewohnheiten. Und doch sehe ich hier Anlaß, sich darüber kritische Gedanken zu machen. So hat die Realität im Äther oft nichts mehr mit den ursprünglichen Idealen der Väter des Lokalfunks gemein. Wenn der lokale Bezug der Sender, der ja durchaus eine Vorgabe bei der Erteilung einer Sendelizenz ist, und auch von der BLM überwacht wird, völlig verlorengeht und sich die einzelnen Stationen nur noch als reine Musikabspielstationen - unterbrochen durch Werbung - darstellen, die sich, wie in München, eigentlich durch nichts anderes als die Programmerkennungsjingles unterscheiden, dann ist wohl der journalistische Anspruch, ein eigenständiges Radioprogramm für den Zu hörer zu produzieren, vollends dem rein finanziellen Interesse geopfert.
Literaturverzeichnis
Arbeitsgemeinschaften der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland (ALM) (Hrsg.) (1996): Jahrbuch der Landesmedienanstalten 1995/1996. München
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) (Hrsg.) (1994): BLM-Jahrbuch 1993/94. München
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) (Hrsg.) (1996): Hörfunk- und Fernsehnutzung in Bayern 1996. Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 1996. München
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) (Hrsg.) (1996): Private Rundfunkangebote in Bayern. Rechtsgrundlagen. München
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)/Infratest Burke Kommunikationsforschung (Hrsg.) (1997): Funkanalyse Bayern 1997. Präsentation der Ergebnisse. Nürnberg
Kors, Johannes (1996): Bayerische Lokalradios: Positive wirtschaftliche Bilanz. In: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) (Hrsg.): Tendenz Nr. I/1996. München
Schick, Paul (1991): Privater Hörfunk in Bayern. Kompetenzregelungen, medienpolitische Konflikte, gesellschaftliche Verflechtungen. München.
Schmitz-Borchert, Heinz-Peter (Hrsg.) (1988): Lokalfunk. Anmerkungen und Statements zur Hörfunkentwicklung. Köln
Schumann, Michael (1993): Neue Medien und privater Rundfunk in Bayern. Das bayerische Medienerprobungs- und -entwicklungsgesetz als Paradigma einer medienpolitischen Strategie. Frankfurt
http://www.blm.de/hoerfunk/fab
Informationsmaterial von Radio Oberland
[...]
1 Bayer. Landeszentrale f. neue Medien: BLM-Jahrbuch 1993/94, S. 141
2 Schick: Privater Hörfunk in Bayern, S. 16
3 vgl. Bayer. Landeszentrale f. neue Medien: BLM-Jahrbuch 1993/94, S. 138
4 vgl. Bayer. Landeszentrale f. neue Medien: BLM-Jahrbuch 1993/94, S. 137
5 Schick: Privater Hörfunk in Bayern, S. 15
6 Schick: Privater Hörfunk in Bayern, S. 14
7 zit. nach: Bayer. Landeszentrale f. neue Medien: Rechtsgrundlagen: Bayer. Verfassung
8 vgl. Bayer. Landeszentrale f. neue Medien: Rechtsgrundlagen, BayMG
9 vgl. Bayer. Landeszentrale f. neue Medien: Funkanalyse 1997
10 Kors: Bayer. Lokalradios: Positive wirtschaftliche Bilanz, in: Tendenz Nr I/1996, S. 41ff
11 vgl. Bayer. Landeszentrale f. neue Medien: BLM-Jahrbuch 1993/94, S. 147
12 vgl. Bayer. Landeszentrale f. neue Medien: BLM-Jahrbuch 1993/94, S. 254f
13 in den Landkreisen Bad Tölz und Miesbach startete später Radio Alpenwelle
14 Süddeutsche Zeitung vom 3.4.1992
15 Münchner Merkur vom 17.1.1997
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit über lokales Radio in Bayern?
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Entwicklung und dem Erfolg des lokalen Radios in Bayern, unter besonderer Berücksichtigung des Lokalfunkkonzepts, der rechtlichen Situation, der wirtschaftlichen Aspekte und der Ergebnisse der Funkanalyse. Ein Fallbeispiel, Radio Oberland, wird ebenfalls detailliert untersucht.
Was ist das Duale System im bayerischen Hörfunk?
Das Duale System bedeutet, dass in fast ganz Bayern je zwei private Hörfunkfrequenzen existieren. Eine Frequenz ist für ein landesweites Privatprogramm (wie ANTENNE BAYERN) reserviert, die andere für lokale Hörfunkanbieter.
Welche Rolle spielt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)?
Die BLM ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die die Trägerschaft für alle privaten Radioprogramme in Bayern übernimmt. Sie lizenziert Anbieter, kontrolliert Programme, fördert Aus- und Fortbildung und führt Forschungsprojekte wie die Funkanalyse durch.
Was ist die Funkanalyse Bayern (FA)?
Die Funkanalyse Bayern ist eine jährlich von der BLM in Auftrag gegebene Studie, die die Rezeption aller in Bayern ausgestrahlten Hörfunk- und Fernsehprogramme untersucht. Sie liefert Daten über Reichweiten, Marktanteile und die Bewertung der Programme durch die Hörer.
Wie hat sich die wirtschaftliche Situation der lokalen Hörfunkanbieter entwickelt?
Anfänglich war die wirtschaftliche Situation schwierig, aber seit 1993 schreiben die lokalen Anbieter insgesamt schwarze Zahlen. Kooperationen, finanzielle Hilfen der BLM und die Gründung der Bayerischen Lokalradio GmbH (BLR) trugen zum Aufschwung bei.
Was ist Radio Oberland und was macht es aus?
Radio Oberland ist ein lokaler Radiosender im bayerischen Oberland (Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau u.a.). Es zeichnet sich durch seinen Fokus auf lokale Informationen ("total lokal"), eine ausgewogene Programmstruktur (Adult Contemporary - Oldie-based mit deutschem Anteil) und Berichte über lokale Ereignisse (z.B. Eishockey) aus.
Welche Ergebnisse erzielte Radio Oberland in der Funkanalyse?
Radio Oberland konnte seine Tagesreichweite in den Jahren 1993-1997 steigern und erreichte 1997 16,3% in seinem Sendegebiet. Besonders stark ist es in der Zielgruppe der 30- bis 49-Jährigen.
Welche rechtlichen Grundlagen gelten für den privaten Rundfunk in Bayern?
Artikel 111a der Bayerischen Verfassung schreibt die öffentliche Verantwortung und Pluralität für den Rundfunk vor. Die BLM übernimmt als Anstalt des öffentlichen Rechts die Trägerschaft für alle privaten Programme.
Welche Bedeutung haben die regionalen Medien-Betriebsgesellschaften (MBG)?
Die 19 regionalen MBGs stehen unter dem Dach der BLM und schließen Verträge mit den einzelnen Hörfunkanbietern über die Produktion der Radioprogramme.
Welche Herausforderungen stehen dem lokalen Radio in Bayern in der Zukunft bevor?
Wichtige Aspekte sind die Sicherung der Meinungsvielfalt, die Überprüfung von Konzentrationsgrenzen, der Erhalt der Programmqualität und der Umgang mit neuer Konkurrenz wie Digital Audio Broadcasting (DAB).
- Arbeit zitieren
- Christoph Centmayer (Autor:in), 1998, Lokales Radio - eine bayerische Erfolgsstory, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94899