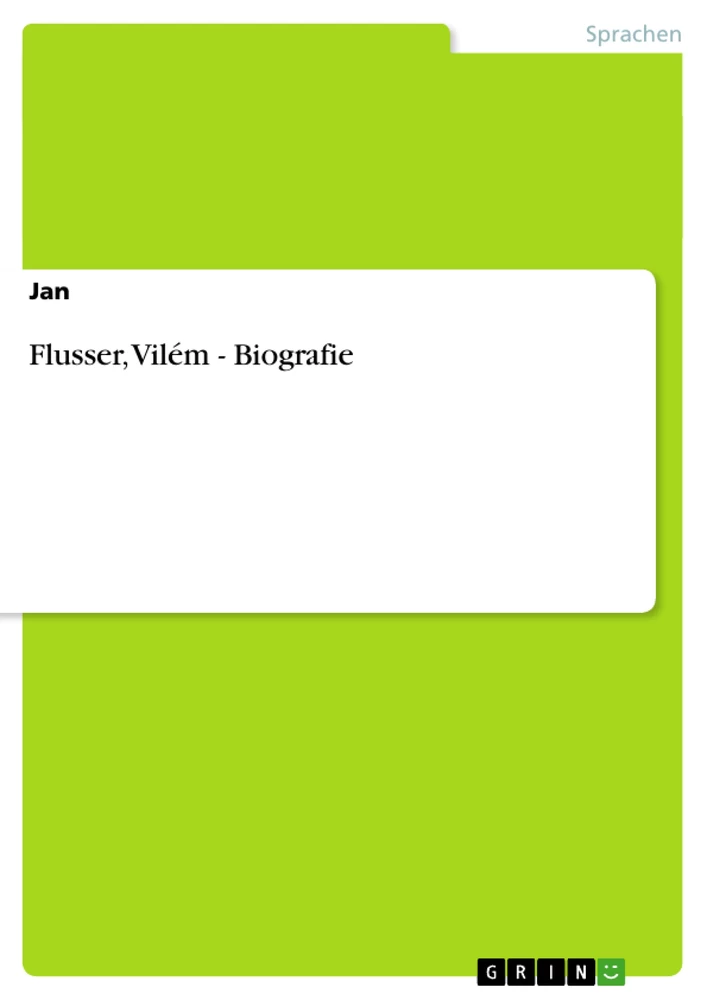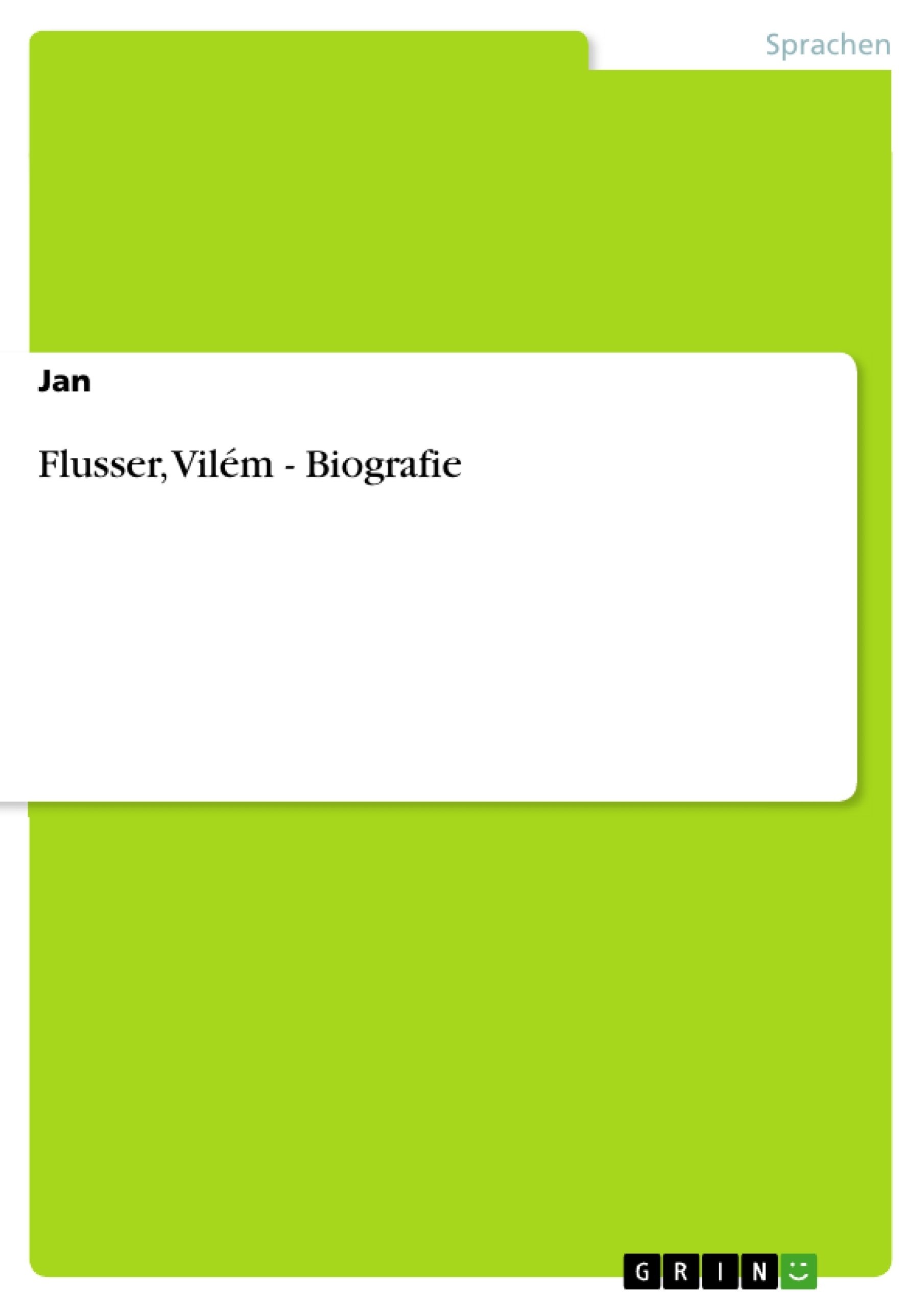Philosophieren heißt für Flusser: Schreiben. Doch der Erfolg läßt auf sich warten: Erst im April 1961 erscheint Flussers erste Veröffentlichung in der Revista Brasileira de Filosofia, ab September folgen kurze Texte in der Zeitung Estado de São Paulo. Dann jedoch beginnt eine rasche und steile Karriere als Publizist, aber auch als Dozent an verschiedenen Paulistaner Universitäten. 1962 wird Flusser Mitglied des Brasilianischen Philosophischen Instituts, 1963 Professor für Philosophie der Kommunikation, im selben Jahr erscheint auch sein erstes Buch: Lingua e Realidade.
Flusser wird in den Beirat der Kunstbiennale von São Paulo berufen, 1966/67 reist er als Emissär des brasilianischen Außenministeriums nach Europa und Nordamerika und knüpft zahlreiche Kontakte, u.a. zu deutschen Zeitungen und Zeitschriften. Von einer der zahlreichen Europareisen, die sich anschließen, kehrtFlusser trotz der großen Popularität, die er mittlerweile in São Paulo genießt, nicht mehr nach Brasilien zurück, sondern läßt sich gemeinsam mit seiner Frau zuerst in Meran, dann an der Loire und schließlich in der Provence nieder.
Vilém Flusser - Biografie
Kommunikations- und Medienphilosoph, der über Fundamente und Perspektiven der "Kommunikationsrevolution" nachdachte.
Vilem Flusser kam am 12. Mai 1920 in Prag auf die Welt und wuchs in einer jüdischen Gelehrtenfamilie auf (der Vater war Professor für Mathematik an der Karlsuniversität).
1939 beginnt Flusser ein Studium der Philosophie. Noch im selben Jahr flieht er mit Edith Barth, seiner späteren Frau, und deren Familie nach London; von dort wandert er 1940 nach Brasilien aus. Flussers Vater wird in Buchenwald zu Tode geprügelt, Mutter und Schwester werden in Auschwitz ermordet.
In Rio de Janeiro heiratet er Edith Barth; das Paar läßt sich in São Paulo nieder. Drei Kinder werden geboren. Durch Tätigkeiten als Sekretär und Repräsentant in Import-Export-Firmen, später als Mitgesellschafter einer kleinen Fabrik für Radios muß Flusser bis Ende der fünfziger Jahre den Lebensunterhalt für seine Familie verdienen. ,,Das bedeutete, daß man am Tag Geschäfte trieb und in der Nacht philosophierte."
Philosophieren heißt für Flusser: Schreiben. Doch der Erfolg läßt auf sich warten: Erst im April 1961 erscheint Flussers erste Veröffentlichung in der Revista Brasileira de Filosofia, ab September folgen kurze Texte in der Zeitung Estado de São Paulo. Dann jedoch beginnt eine rasche und steile Karriere als Publizist, aber auch als Dozent an verschiedenen Paulistaner Universitäten. 1962 wird Flusser Mitglied des Brasilianischen Philosophischen Instituts, 1963 Professor für Philosophie der Kommunikation, im selben Jahr erscheint auch sein erstes Buch: Lingua e Realidade.
Flusser wird in den Beirat der Kunstbiennale von São Paulo berufen, 1966/67 reist er als Emissär des brasilianischen Außenministeriums nach Europa und Nordamerika und knüpft zahlreiche Kontakte, u.a. zu deutschen Zeitungen und Zeitschriften. Von einer der zahlreichen Europareisen, die sich anschließen, kehrtFlusser trotz der großen Popularität, die er mittlerweile in São Paulo genießt, nicht mehr nach Brasilien zurück, sondern läßt sich gemeinsam mit seiner Frau zuerst in Meran, dann an der Loire und schließlich in der Provence nieder.
Flusser fängt neu an und hält in Aix und Marseille Vorlesungen über Kommunikation, entdeckt die neuen Medien und Technologien als ,,sein" Thema, publiziert weiterhin in Brasilien, aber auch in Frankreich, Amerika und zunehmend im deutschsprachigen Raum, doch auch hier läßt der Erfolg lange auf sich warten.
1983 erscheint die erste deutschsprachige Buchveröffentlichung Für eine Philosophie der Fotografie, und auch dieses Mal geht es dann Schlag auf Schlag: Vorträge, Zeitschriftenpublikationen, Bücher, Reisen, Gastdozenturen und immer wieder Vorträge.
1991, nach einem Auftritt vor 800 Zuhörern in Essen, spricht er zum erstenmal davon, daß er den "Durchbruch" geschafft habe. Nur wenige Wochen später, am 27. November 1991, wird er Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls nahe der deutsch-tschechischen Grenze; am Tag zuvor hatte er, auf Deutsch, seinen ersten und einzigen Vortrag in seiner Heimatstadt Prag gehalten: Paradigmenwechsel lautete das Thema.
Im November 1997 wird Vilém Flusser posthum der Siemens Medienkunstpreis verliehen.
Obwohl Flusser seine Themen rund um den Begriff "Krise" fand (den er dann meistens nicht als Krise im negativen Sinn, sondern vielmehr als Kultur- und Kommunkationsrevolution darstellt) hat er sich immer auf ermutigende Weise geweigert, Pessimist zu sein. Er sah die Menschen in der Situation, sich darüber aufgeklärt zu haben, ein Nichts im Nichts zu sein. Die moderne Wissenschaft habe gezeigt, daß das Objekt nicht etwas Solides sei, sondern eine Ausbuchtung einander kreuzender Beziehungsfelder. Die moderne Psychologie und Existenzanalyse legten nahe, daß es im Menschen keinen "harten Kern" gebe.
Wer aber nicht mehr an die Dinge glauben könne, glaube auch nicht mehr an das Heil, an ein Ziel der Geschichte und an die technische Herstellbarkeit des Glücks. Die hieraus folgende Krise sei so umfassend, daß der herrschende Code menschlicher Kommunikation, das lineare Alphabet, mit in den Abgrund gerissen werde.
Flusser beschreibt den neuen "Code der technischen Bilder", der dabei ist, das Alphabet abzulösen. Er arbeitet den Unterschied zwischen technischen Bildern als "Bilder von Begriffen" und traditionellen Bildern heraus, die noch eine Realität abbilden. Und er beleuchtet die verzweifelte Lage der menschlichen Kommunikationsstrukturen: Im Zuge des Umbruchs der Codes geraten die Methoden menschlicher Verständigung zu wirkungslosem Leerlauf (z.B. in der Politik) und bewußtlosem programmiert-werden durch die Massenmedien, die sich der neuen Technobilder (Fotografie, Filme, Fernsehen) bedienen. Es drohe ein vollautomatisierter totalitärer Techno-Staat.
Dabei will Flusser auf keinen Fall allein "die Sender" für das Geschehen verantwortlich machen. Wir alle seien (noch) nicht in der Lage, mit Technobildern und neuen Medien angemessen umzugehen, weil wir - noch alphabetisch konditioniert - mit unserem geschichtlichen Bewußtsein hilflos in einer Welt herumruderten, die schon längst einen neuen Code schreibe.
Unverzichtbar sei jedenfalls eine änderung der Kommunikationsstrukturen weg von der Amphitheater-Struktur "Großer Sender - Massenpublikum" hin zu einer dialogischen Struktur, bei der jeder Teilnehmer gleichzeitig Sender und Empfänger ist. Mit dem Internet ist also eines der Flusserschen Hauptanliegen Realität geworden - und wir alle werden darüber mitbestimmen, ob es zu einem "Amphitheater" degeneriert oder nicht.
Auch wenn immer wieder behauptet wird, Flusser eigne sich nicht zum ,,Prophet" des bevorstehenden Multimediazeitalters, ist seine visionäre und durchaus optimistische Vorstellung von der Entwicklung und sozialen/politischen Auswirkungen der Vernetzungsmedien, lange bevor das Internet im heutigen Sinn überhaupt entwickelt wurde, bemerkenswert.
MEDIENKULTUR
Sammlung von repräsentativen Schriften und Vorlesungen
Wenn man die westlichen Industrienationen heute betrachtet so fällt im Vergleich zu früheren Zeiten (Vorkriegszeit) und etwa den (ehem.) Ostblockstaaten auf, daß nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens um ein vielfaches farbiger gestaltet sind. Diese ,,Farbexplosion" um uns herum hat ästhetische Gründe, mehr jedoch hat sie die Funktion einer immer bedeutender werdenden, mehr oder weniger neuartigen Kommunikationsform. Eine rote Ampel signalisiert etwas wichtiges einzig und allein durch ihre Farbe, die Farbenpracht von Werbeplakaten hat die gleiche Funktion wie Pflanzen, die durch ihre leuchtenden Blütenfarben die Aufmerksamkeit (von Werbeklientel/bestäubenden Insekten) auf sich zieht.
Neuartige Kommunikationsformen: Bildersprache, ,,Technocodes":
Werbung (Fernsehen, Plakat, Print, Produktverpackung, ...)
Verkehrssystem, andere ,,Reglements"
Kleidung
Comics
Fotografie, Fernsehen, Multimedia, Video, Kino
Flusser nennt diese mal kronketeren, mal verschlüsselteren Botschaften ,,Technocodes".
Diese sind sowohl Auswirkung wie auch Verursacher einer allgemeinen Entwicklung unserer Kultur weg von den ,,klassischen" Kommunikationscodierungen (Sprache, Schrift, Gestik), die weniger ,,handfest" aber dafür ,,geschmeidiger" sind als die neuen, hin zu einer technisch produzierten und reproduzierenden Bildersprache. Diese ist im Vergleich zur Schriftkommunikation mehrdimensionaler, d.h. es können synchron mehrere Informationen vermittelt und aufgenommen werden, während ein Text nur einen linearen Informationsfluß erlaubt. Diese Form der Übermittlung von Informationen ist nicht wirklich neu, da sie vergleichbar mit derjenigen ist, die vor der Entwicklung des Alphabets üblich war (Höhlenmalereien, Fresken, Kirchenfenster...). Der Unterschied liegt darin, daß diese Bildersprache ein Werk künstlerischer Handlungen war, die Technocodes jedoch mit technischen Mitteln hergestellt werden, aber beide publizieren durch selektive Reproduktion von Bildern und Geschehnissen Theorien, ´Modelle´ unserer Welt. Elemente aus allen Epochen der Weltgeschichte werden in den neuen Medien mit immer aufwendigen technischen Mitteln der Technik reproduziert, ge-,,themed".
THEMING: ´Ziel jedes Theming ist die Kontrolle des ästhetischen Erlebnisses, die Eliminierung alles Zufälligen und damit damit die gezielte Produktion von Erfahrung. Was in der Wirklichkeit komplex und verwirrend ist, eine Großstadt etwa, wird symbolisch verknappt: zum ,,Thema" kondensiert. Denn das läßt sich in seiner artifiziellen Reduktion anstrengungsloser genießen als die facettenreichere Realität.´
(Aus: )
Man kann also sowohl von einer Rückbesinnung sprechen als auch von einer innovativen, ja revolutionären Kommunikationsform, die anderes und mehr vermag als die schriftliche. Es ist jedoch nötig, diese Codes ,,lesen", entschlüsseln zu lernen. Diejenigen, die mit ihnen aufwachsen, erlernen diese Fähigkeit mehr oder weniger automatisch, während es für Menschen, die allein mit der Schriftkultur aufgewachsen sind, eine mehr oder weniger aktive Anstrengung darstellt. Flusser meint, daß diejenigen, die nicht in der Lage sind oder sich weigern, die Codierung der Bildersprache zu entschlüsseln, zu Analphabeten in einer neuen Definition werden, während die ,,neue Generation" von Mediennutzern die zunächst virtuellen Welten auf dem Bildschirm in den realen weltgeschichtlichen Kontext einzuordnen vermögen. Er geht sogar so weit, von einem Ende der Geschichte im ursprünglichen Sinn zu sprechen, da unsere Kultur aus der Welt der ´Erklärungen´ herausschreite in die Welt der ´Modelle´. Diese Entwicklung (,,Krise der Werte") bewirkt jedoch nicht das Aussterben der Texte, vielmehr wird das Lesen und Schreiben wieder zum Luxus, der hauptsächlich von einer intellektuellen Elite (wie groß diese auch sein mag) praktiziert wird, trotz oder gerade wegen ihrer langwierigeren, anstrengenderen und ,,farblosen" Informationsvermittlung.
- Texte erlauben es, Bilder in Begriffe aufzul ö sen. (Erkl ä rungen)
Die Erfindung und Entwicklung des Alphabets machten es möglich, aus ´Ereignissen´ ´Geschehnisse´ zu machen und die Sprache und das Denken zu ,,disziplinieren" , ,,linerarisieren", indem es in eine genormte Codierung gefasst wird. Das Lesen und Schreiben ist ,,anstrengender" als das Erfassen von Technocodes, der Vorteil liegt nach F. darin, daß es ,,ein unkritisches Empfangen von Informationen unmöglich" macht.
- Technocodes erlauben es, sich Bilder von Begriffen zu machen. (Modelle)
Sie können zum Bespiel neben dem Gesprochenen auch die Gestik und Mimik des Sprechenden vermitteln und sind damit nicht nur leichter zu ´konsumieren´, sondern auch mehrdimensionaler als die Alphabetcodes. Sie vermitteln eine Form der Imagination, die die Texte nicht erreichen können.
Die menschliche Gesellschaft und Kultur stellt F. dar als ein Gewebe aus Informationen. Es gibt das universelle Einzelbewußtsein und eine Art kollektives Gedächtnis, das sämtliche Informationen der Menschheit beinhaltet (Kultur, Wissenschaft, ...) und das diese direkt und in zunehmendem Maße auch mittels technischer Geräte und Wege intern austauscht. Der Mensch definiert sich innerhalb dieses Gewebes gewissermaßen als die Summe der Informationen die er aufnimmt, speichert und mittels unterschiedlicher Codierungen weitergibt, aber auch selbst erzeugt. Dazu kommt ihm in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Computer ein Werkzeug zu Hilfe, das sowohl den Alphabetcode verarbeiten kann (und damit hilft, die ,,Textinflation", die nach Flusser dafür verantwortlich ist, daß kaum mehr jemand ´richtig´liest) als auch die Technocodes (Bilder&Töne). Mit ihm wird es möglich, unterschiedlichste Informationen aus der Welt und der Kultur festzuhalten, zu verformen, miteinander zu kombinieren und, zumindest theoretisch, mit jedem Menschen auf der Welt auszutauschen. Dies setzt der Linearität des auf Papier Geschriebenen eine ´chaotische´, fraktale Informationsstruktur entgegen, die weitaus demokratischer und universeller ist. F. spricht von einer radikalen Veränderung, die die elektronischen Medien auf die menschliche Informations- und Kommunikationskultur und, da diese sich immer mehr als wichtigstes Element der zivilisatorischen Entwicklung herausstellt, auf alle Bereiche der menschlichen Gesellschaft ausüben. Dabei unterscheidet er aber grundlegend zwischen dem ´Einbahnstraßen-Medium´ Fernsehen, das ausschließlich das Konsumieren von Informationen ermöglicht. Dadurch wird Demokratie und aktive Kritik (außer durch um- oder abschalten) ausgeschlossen. Das ganz neue, ´reversible´ Medium World Wide Web (das Flusser mehr visionär sieht als wirklich schon kennt, die Bezeichnung fällt jedenfalls nicht), das über den Computer zugänglich ist hat dagegen die Fähigkeit, mit dem technocode- oder textproduzierenden Gegenüber einen emanzipierten Austausch zu praktizieren. Während es beim Fernsehen die ´Sender´ auf der einen Seite und den ´Empfänger´ am anderen Ende des Kabels gibt, die Informationsstruktur also gebündelt und monopolisiert ist, so sind wir nach F. auf dem Weg in die ,,telematische Informationsgesellschaft", in der durch ,,Zerstäubung" der Informationserzeugung jeder sowohl Empfänger als auch Sender ist und der sich vorher nie dagewesene Perspektiven eröffnen: die neuen Apparate bedeuten nicht nur technische Neuerungen, sondern bewirken eine regelrechte Kulturrevolution. Die ,,klassischen" Technocodes wie z.B. das Kino werden von dieser Gesellschaft mehr oder weniger bewußt benutzt als Mittel zum eskapieren, der programmierende Effekt von nicht beeinflußbaren, dafür um so farbigeren und bombastischen Technobildern wird ausdrücklich gewählt, um für ein paar Stunden in diesen versinken zu können. Eine echte Programmierung findet dadurch, daß dieser Effekt ausdrücklich erwünscht ist, jedoch nicht statt. Die einzige Möglichkeit, sich von den Apparaten und Bildern nicht ungewollt beeinflussen zu lassen, ist daher nicht etwa das Vermeiden des Kontaktes, sondern im Gegenteil die ausgeprägte, konsequente Auseinandersetzung mit ihnen, das Ausbilden einer guten ,,Techno-Imagination".
Techno-Imagination: Die F ä higkeit, die mit technischen Apparaten produzierten und reproduzierten Bilder in den richtigen Kontext einzuordnen und bewu ß t zu verarbeiten.
Dem Fernsehen räumt F. eine Rolle ein, die mit Sicherheit längst nicht in allen Fällen zutrifft. Er vergleicht die Programmkonsumenten, die gemeinsam vor dem Bildschirm sitzen (normalerweise eine Familie), mit Zuschauern eines Theaterstücks, die sich jedoch noch untereinander über das Vorgeführte kritisch austauschen und widerspricht damit der weitverbreiteten Position, das Fernsehen sei zwangsläufig ein stumpfer, einsamer Prozeß. Der Apparat funktionert als ,,Fenster" zum Blicken auf die ,,Bühne" Welt", dem jedoch die Tür fehlt, um selbst über das Medium am Geschehen teilnehmen zu können. Diese Tür, die einen Dialog aller mit allen zumindest theoretisch ermöglicht, stellen die aufkommenden Vernetzungsmedien dar. Schon 1974 (!!) hat Flusser eine klare Vorstellung von der Entwicklung des Internet, von der Entstehung eines globalen virtuellen Forums, in der jeder mit jedem auf dem Planeten kommunizieren kann und das eine globalisierte und politisierte Gesellschaft ermöglicht. Das Internet schafft zur realen Lebenswelt eine neue, virtuelle Dimension, in der jeder Mensch gleichgestellt ist und auf einer globalen Ebene das ist, was er zu sagen hat. Über kurz oder lang finden die Ideen, Pläne, Bewegungen, die auf elektronischem Weg entstanden sind, den Weg in die materielle Welt, wo F. räumt der telematischen Informationsgesellschaft große neue Eigenschaften ein, lange bevor des Internet/WWW überhaupt entwickelt wurde.
Wir befinden uns nach F. also auf der Schwelle zur letzten Entwicklungsstufe der technikkulturellen Evolution:
Handmensch - Werkzeugmensch - Maschinenmensch - Apparatemensch (oder Informationsmensch).
Auch hier also wieder die These, die Geschichte der Menschheit in ihrer eigentlichen Bedeutung sei gewissermaßen an ihrem Ende oder zumindest an einem bedeutenden Wendepunkt angelangt.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Vilém Flusser?
Vilém Flusser war ein Kommunikations- und Medienphilosoph, der über die Grundlagen und Perspektiven der "Kommunikationsrevolution" nachdachte.
Wo und wann wurde Vilém Flusser geboren?
Vilém Flusser wurde am 12. Mai 1920 in Prag geboren.
Was geschah mit Flussers Familie während des Zweiten Weltkriegs?
Flussers Vater wurde in Buchenwald zu Tode geprügelt, seine Mutter und Schwester wurden in Auschwitz ermordet.
Wo lebte Flusser nach seiner Flucht aus Prag?
Flusser floh mit seiner späteren Frau Edith Barth und deren Familie nach London und wanderte 1940 nach Brasilien aus.
Womit verdiente Flusser seinen Lebensunterhalt in Brasilien?
Flusser arbeitete als Sekretär und Repräsentant in Import-Export-Firmen und später als Mitgesellschafter einer kleinen Fabrik für Radios.
Wann begann Flusser zu publizieren?
Flussers erste Veröffentlichung erschien im April 1961 in der Revista Brasileira de Filosofia.
Wann erschien Flussers erstes Buch?
Flussers erstes Buch, Lingua e Realidade, erschien 1963.
Wo lebte Flusser in seinen späteren Jahren?
Flusser lebte mit seiner Frau zuerst in Meran, dann an der Loire und schließlich in der Provence.
Wann erschien Flussers erste deutschsprachige Buchveröffentlichung?
Flussers erste deutschsprachige Buchveröffentlichung, Für eine Philosophie der Fotografie, erschien 1983.
Wann und wie starb Vilém Flusser?
Vilém Flusser starb am 27. November 1991 bei einem Verkehrsunfall nahe der deutsch-tschechischen Grenze.
Was war Flussers Sicht auf die Krise?
Flusser betrachtete die Krise nicht unbedingt negativ, sondern eher als Kultur- und Kommunikationsrevolution.
Was beschreibt Flusser als den neuen "Code der technischen Bilder"?
Flusser beschreibt den neuen "Code der technischen Bilder", der dabei ist, das Alphabet abzulösen, und arbeitet den Unterschied zu traditionellen Bildern heraus.
Was war Flussers Vision für die Kommunikationsstrukturen?
Flusser befürwortete eine Änderung der Kommunikationsstrukturen weg von der Amphitheater-Struktur hin zu einer dialogischen Struktur, bei der jeder Teilnehmer gleichzeitig Sender und Empfänger ist.
Was versteht Flusser unter "Technocodes"?
Flusser nennt die Botschaften, die durch Bildersprache, Werbung, Verkehrssysteme, Kleidung, Comics, Fotografie, Fernsehen, Multimedia, Video und Kino vermittelt werden, "Technocodes".
Was bedeutet "Theming" nach Flusser?
Theming bedeutet die Kontrolle des ästhetischen Erlebnisses, die Eliminierung alles Zufälligen und damit die gezielte Produktion von Erfahrung.
Was sind die Vor- und Nachteile von Texten (Alphabetcodes) nach Flusser?
Texte erlauben es, Bilder in Begriffe aufzulösen (Erklärungen), disziplinieren und linearisieren das Denken, machen aber unkritisches Empfangen von Informationen unmöglich.
Was sind die Vor- und Nachteile von Technocodes nach Flusser?
Technocodes erlauben es, sich Bilder von Begriffen zu machen (Modelle), sind mehrdimensional und leichter zu konsumieren, können aber auch Imagination vermitteln, die Texte nicht erreichen.
Was versteht Flusser unter "Techno-Imagination"?
Techno-Imagination ist die Fähigkeit, die mit technischen Apparaten produzierten und reproduzierten Bilder in den richtigen Kontext einzuordnen und bewusst zu verarbeiten.
Welche Entwicklungsstufen der technikkulturellen Evolution sieht Flusser?
Flusser sieht die folgenden Entwicklungsstufen: Handmensch - Werkzeugmensch - Maschinenmensch - Apparatemensch (oder Informationsmensch).
Welche Rolle spielt der Computer in Flussers Theorie?
Der Computer ermöglicht es, unterschiedlichste Informationen aus der Welt und der Kultur festzuhalten, zu verformen, miteinander zu kombinieren und, zumindest theoretisch, mit jedem Menschen auf der Welt auszutauschen.
- Quote paper
- Jan (Author), 1999, Flusser, Vilém - Biografie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94914