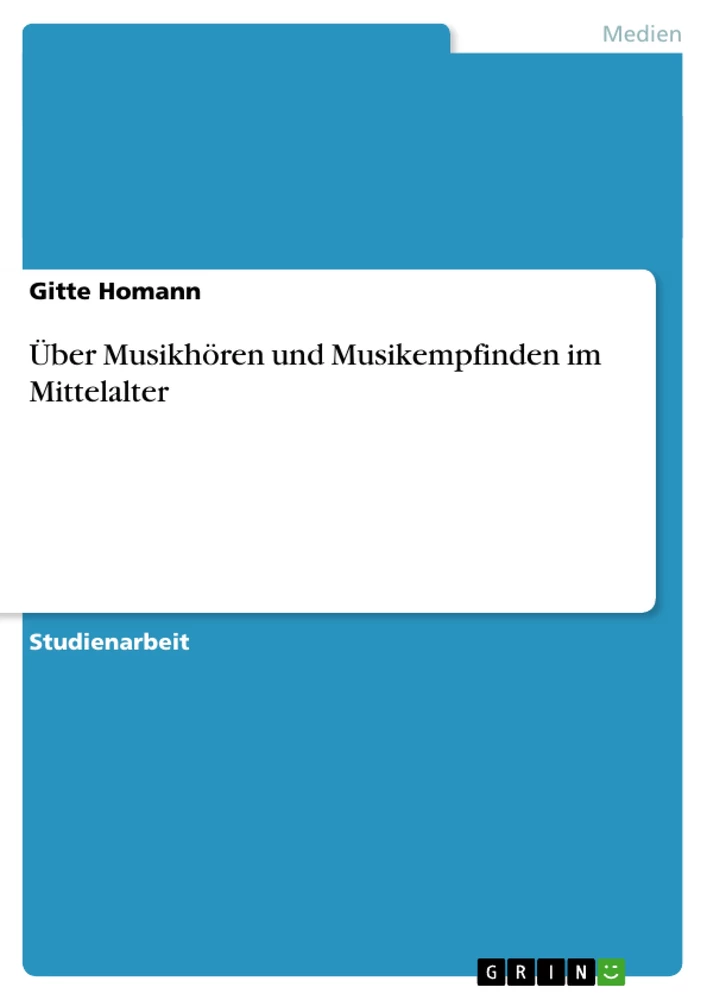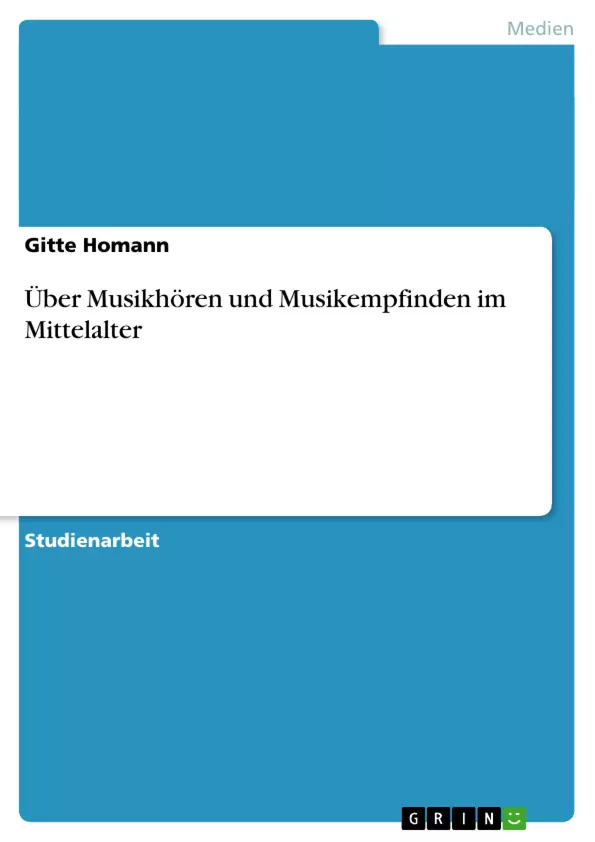Laut Begriffsformung ist die Art von Musik; die man heute gewohnt ist, zu hören; erst vor 300 Jahren entstanden. Denn erst ab 1500 sind Formen und Techniken entstanden, deren Allgemeingültigkeit über Jahrhunderte hinweg geprägt wurde. Diese Formen und Techniken können heute als klassische Regeln angesehen werden.
Doch wie wurde die Musik vor 1500 aufgefaßt?
Dem Fachmann wird nach jeder Analyse bewußt, daß sein Ergebnis nicht zuletzt aus seiner künstlerischen Einfühlung entstanden ist. Die Notenreihen weisen keine nähere Bestimmung über Besetzung und Aufführungsart auf, das heißt, daß sich der Betrachter auf seine Tonphantasie verlassen muß, und diese ist sicherlich so manches mal lebhafter als es im Original gedacht wurde.
Die Musik vor 1500 zeigte Kälte und Ausdruckslosigkeit. Und sollte doch an einer Stelle eine Art seelischen Lebens auftauchen, wird diese sofort wieder durch absonderliche Klänge, verschrobene Stimmführungen und Haltlosigkeit genommen.
Jedem Betrachter wird schnell klar, daß im Gesamtbild der Kompositionen der Ausdruck fehlt. Er kann sich zwar auf die Gliederung, die Melodik, die Rhythmik und den Zusammenklang verlassen, kennt aber den lebendig ausgeübten Klang nicht. Es wäre also die Frage zu klären, ob es eine Beziehung zwischen der uns so fremd erscheinenden Musik und dem Musikempfinden tatsächlich gibt. Gibt es Anzeichen, daß das Musikempfinden und Musikhören derart gestaltet waren, daß nur diese Musik entstehen konnte?
Um diese Frage zu beantworten, reicht nicht nur, sich auf das Einfühlungsbedürfnis zu verlassen, sondern bedarf es auch dem Abstraktionsdrang. Der Einfühlungsprozeß unterstreicht durch das Hervorheben des Organischen, Lebendigen, Naturhaften und Zufälligen die Beglückungswerte. Beim Abstraktionsprozeß hingegen wird das Bleibende, Absolute und rein Gesetzmäßige betont und hebt somit die Beruhigungswerte hervor. Wenn man nun beide Betrachtungsweisen anwendet, um ein Musikstück aus der Zeit vor 1500 zu betrachten, bekommt man ein recht anschauliches Bild vom Charakter und von der Absicht, die das Musikstück bezwecken sollte.
Wenn man Musik aus früherer Zeit untersucht oder vielleicht auch nur hören und verstehen möchte, darf man einen ganz wichtigen Punkt nicht aus den Augen verlieren: Die Musik war nicht zu allen Zeiten Ausdruck und klingende Gefühlsdialektik. Man muß sich auch die sozialen, religiösen, magischen und ethischen Anschauungen der entsprechenden Epoche bewußt machen, um die Musik als wirkliches Ganzes verstehen zu können. Und wenn nicht bekannt ist, ob Musik in den betreffenden Kulturstufen auch eine Geltung hatte, dann kann man sie nicht Kunst nennen. Fest steht, daß die Menschen damals die Musik unterschiedlich rezeptiert haben müssen, als sie es heute tun, denn nicht umsonst hat man so große Probleme, die Musik zu verstehen und teilweise eben auch zu mögen.
Die damalige soziale Stellung der Musiker ist mit der heutigen Situation der Musiker überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Musiker zu sein war damals ein normaler Berufsstand wie auch Schuster oder Schmied. Der Künstler nannte sein Schaffen Arbeit und sein Finden Wissen. Der mittelalterliche Musikschreiber kannte in Bezug auf sein Schaffen die Begriffe Inspiration und Intuition nicht. So stellte er auch nicht sein Werk als sein ureigenes Selbst dar, sondern sah es als Leistung des gesamten Menschentyps. Es fehlte ihm sogar der Ehrgeiz, sich mit Namen zu nennen. Teilweise ist es heute nun nicht möglich, in einem Tonstück das Herz des Schöpfers zu erkennen und eine Ich-Beziehung zum Werk herzustellen.
Da heute viel über den Instrumentenapparat der alten Zeit bekannt ist, können einige Rückschlüsse über das Musikhören gezogen werden.
Die Instrumente waren aus heutiger Sicht nicht sehr qualitativ gearbeitet worden, was bestätigt, daß sie nur ihren Zweck erfüllen sollten. Sämtliche Instrumente waren klanglich und technisch einer Musikauffassung unterstellt, die mit unserer romantischen Auffassung des Klanges nicht übereinstimmen.
Neben den Instrumenten hatte die einstimmige Gesangsmusik einen besonderen Stellenwert.
Beim Vortrag kam es zuerst auf den Textinhalt an. Dann wurde auf die Art des Vortrages geachtet und erst zum Schluß war die Qualität der Musik interessant. Das heißt also, daß der Haupteindruck vom Text und vom Vortrag abhing, und die Musik nur als Würze hingenommen wurde.
Ganz anders muß man nun an die Betrachtung des einstimmigen gregorianischen Chorals rangehen. Denn die Melodien wurden auch damals als eindrucksvoll empfunden. Das heilige Wort wurde in streng vorgeschriebene uralte und unverletzliche Formeln gebannt. Damit nahm die Kirche die Affekte der Trauer, Freude, Zerknirschung und Angst und zielte somit auf die Beruhigungswerte.
Noch problematischer war im Mittelalter die Entwicklung der Mehrstimmigkeit. Dafür entscheidend war der gesamte Apparat der Lebenszusammenhänge. Die Entwicklung der Mehrstimmigkeit war eine Veränderung, die den ganzen musikalischen Menschen neu formte. Noch nie gedachte Elementarprobleme wurden innerhalb kürzester Zeit gehandhabt. Zuerst entwickelte sich das Parallelorganum. Jedoch blieb die Erkenntnis nicht lange aus, daß ein Gesang mit parallelen reinen Intervallen nur ein Gefärbter einstimmiger Gesang ist. Eine Hauptstimme mit einer 2. Oder gar 3. Stimme zu verkoppeln, bedurfte einer kompletten Veränderung und Steigerung des Tonvorstellungsvermögens.
Der Hörer hatte nun die Wahl, entweder jede der beiden Stimmen für sich zu verfolgen oder das klangliche Doppelwesen auf als Ganzes auf sich wirken zu lassen. Nach einer Prüfung von überlieferten Dokumenten kann man davon ausgehen, daß der Hörer die linearen Vorgänge als das Wesentliche empfand. Das Harmonische wurde eher als sekundäre Erscheinung aufgefaßt.
Das Hören der zwei Stimmen in sich kann als horizontales Hören bezeichnet werden. Das heißt, zu einer fixen Grundstimme mit einer melodischen Einheit konnte die kontrapunktierende Gegenstimme entweder darüber oder darunter erfaßt werden. Erst einige Zeit später fanden die Terzen und mit ihnen die Dreiklänge ihre Bedeutung. Man erkannte, daß man mit diesen Tonabständen und Tonverbindungen die Aufmerksamkeit automatisch auf die Oberstimme lenken konnte. Somit trat die Oberstimme nun führend auf und alles andere wurde als reiner Klang wahrgenommen.
Einige Fragen werden jedoch immer offen bleiben:
- Wie ist der mittelalterliche Mensch in die Mehrstimmigkeit gewachsen?
- Welche spezifischen Klanggefühle hatte der mittelalterliche Mensch beim Hören mehrstimmiger Musik?
- Wie wurde das Zeitmaß behandelt?
- Inwieweit bestimmten Räumlichkeiten, Besetzung und Gruppierung der Chöre den Charakter und Eindruck der Musik mit?
Häufig gestellte Fragen
Worüber handelt dieser Text?
Dieser Text erörtert die Entwicklung der Musik vor 1500 und wie sich die Wahrnehmung und das Verständnis von Musik im Laufe der Zeit verändert haben. Er untersucht die Unterschiede zwischen der heutigen Musikerfahrung und der im Mittelalter, wobei soziale, religiöse und ethische Aspekte berücksichtigt werden.
Wie unterschied sich die Musik vor 1500 von der Musik, die wir heute kennen?
Musik vor 1500 hatte oft einen anderen Charakter als die heutige Musik. Sie wurde als kälter und ausdrucksloser wahrgenommen, wobei ein Fokus auf Struktur und Form statt auf emotionalem Ausdruck lag. Die Notenreihen enthielten oft keine detaillierten Angaben zu Besetzung und Aufführungsart, was den Interpreten mehr Interpretationsspielraum ließ.
Welche Rolle spielte die soziale Stellung der Musiker im Mittelalter?
Im Mittelalter war der Musikerberuf ein normaler Beruf, vergleichbar mit dem eines Schusters oder Schmieds. Die Musiker betrachteten ihre Arbeit als Handwerk und ihr Können als Wissen. Inspiration und Intuition spielten eine geringere Rolle als heute. Es gab oft keinen Ehrgeiz, sich namentlich zu nennen, und die Werke wurden nicht als persönlicher Ausdruck des Künstlers angesehen.
Wie unterschied sich die Instrumentierung im Mittelalter von der heutigen?
Die Instrumente im Mittelalter waren oft weniger hochwertig verarbeitet als die heutigen. Sie dienten primär ihrem Zweck. Klanglich und technisch waren sie einer Musikauffassung unterstellt, die sich von unserer romantischen Klangvorstellung unterscheidet.
Welchen Stellenwert hatte die Gesangsmusik im Mittelalter?
Einstimmige Gesangsmusik hatte im Mittelalter einen besonderen Stellenwert. Beim Vortrag stand der Textinhalt im Vordergrund, gefolgt von der Art des Vortrags. Die Qualität der Musik war von nachrangiger Bedeutung. Der gregorianische Choral wurde jedoch als eindrucksvoll empfunden, da er das heilige Wort in streng vorgeschriebene Formeln bannte und auf Beruhigungswerte abzielte.
Wie entwickelte sich die Mehrstimmigkeit im Mittelalter?
Die Entwicklung der Mehrstimmigkeit war ein entscheidender Schritt, der den gesamten musikalischen Menschen veränderte. Zuerst entwickelte sich das Parallelorganum, jedoch erkannte man bald, dass ein Gesang mit parallelen reinen Intervallen lediglich ein gefärbter einstimmiger Gesang ist. Die Verkopplung einer Hauptstimme mit einer zweiten oder dritten Stimme erforderte eine komplette Veränderung und Steigerung des Tonvorstellungsvermögens.
Wie wurde die Mehrstimmigkeit von den Hörern wahrgenommen?
Der Hörer hatte die Wahl, entweder jede der beiden Stimmen einzeln zu verfolgen oder das klangliche Doppelwesen als Ganzes auf sich wirken zu lassen. Vermutlich empfand der Hörer die linearen Vorgänge als das Wesentliche, während das Harmonische eher als sekundäre Erscheinung aufgefasst wurde.
Welche Fragen bleiben unbeantwortet bezüglich der mittelalterlichen Musikwahrnehmung?
Es bleiben Fragen offen, wie der mittelalterliche Mensch in die Mehrstimmigkeit hineinwuchs, welche spezifischen Klanggefühle er beim Hören mehrstimmiger Musik hatte, wie das Zeitmaß behandelt wurde und inwieweit Räumlichkeiten, Besetzung und Gruppierung der Chöre den Charakter und Eindruck der Musik mitbestimmten.
- Citar trabajo
- Gitte Homann (Autor), 1999, Über Musikhören und Musikempfinden im Mittelalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94929