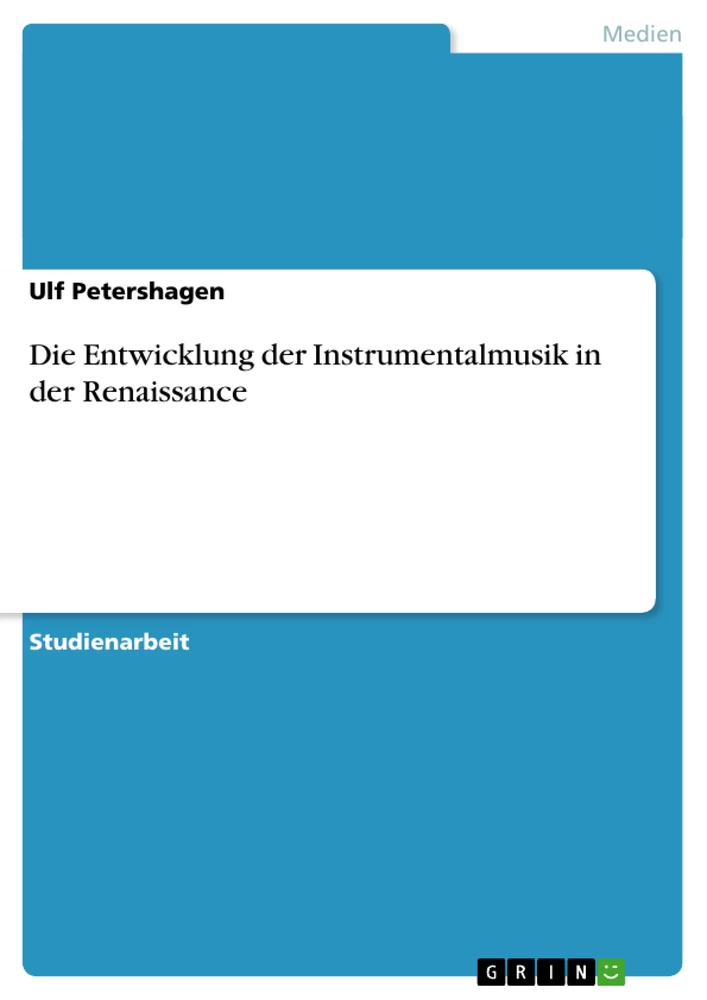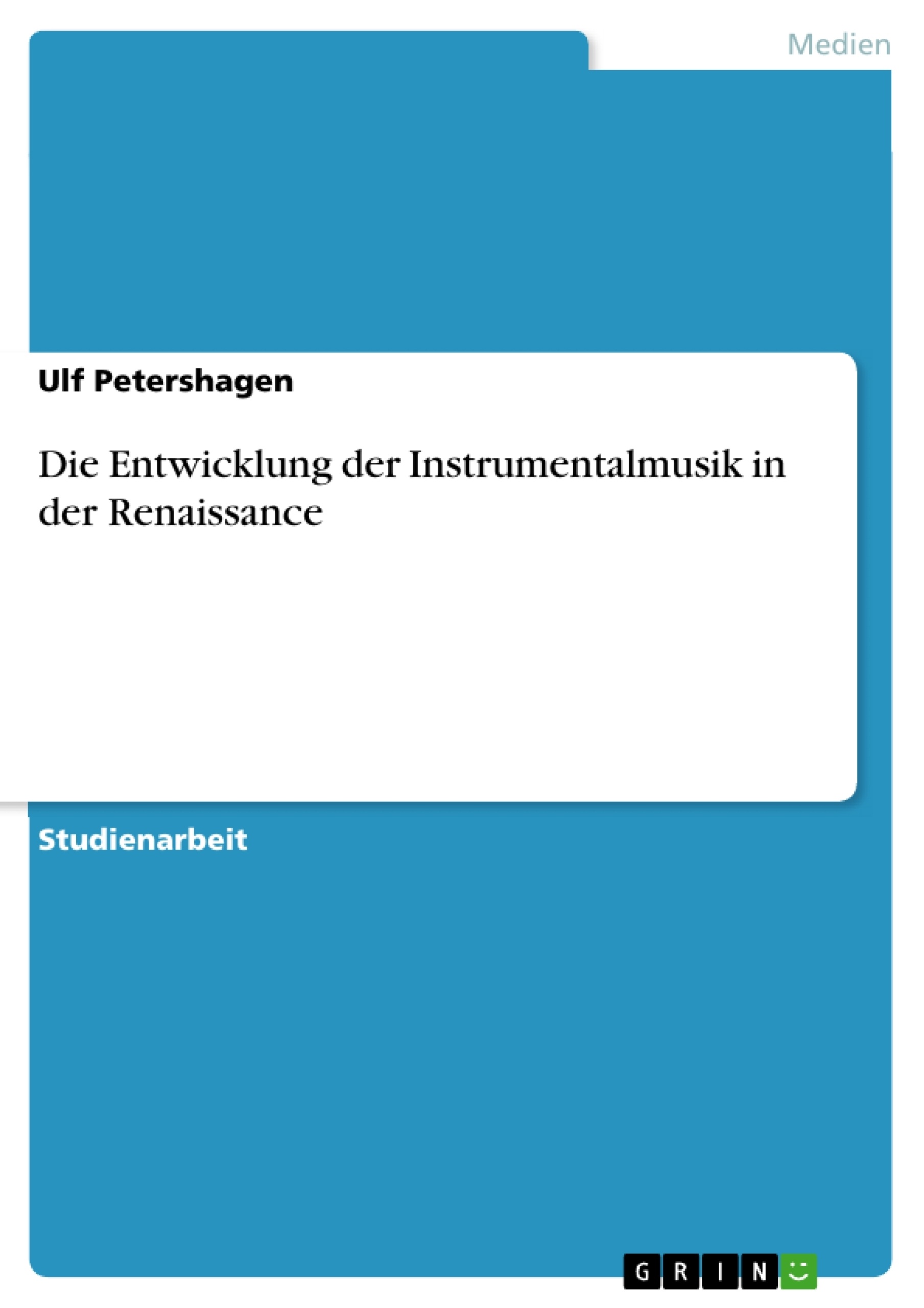Stellen Sie sich vor, Sie reisen zurück in die Zeit der Renaissance, eine Epoche des Umbruchs und der künstlerischen Blüte, in der die Instrumentalmusik aus dem Schatten der Vokalmusik trat und eine eigene, faszinierende Stimme entwickelte. Dieses Buch enthüllt die verborgenen Pfade dieser musikalischen Revolution, beginnend mit dem überraschenden Gegensatz zwischen der Häufigkeit von Instrumentaldarstellungen in der bildenden Kunst und dem Mangel an schriftlichen Quellen reiner Instrumentalmusik. Es beleuchtet, wie die Instrumentalmusik, einst primär als Gebrauchs- und Begleitmusik für Tanz und Gesang existierte, sich allmählich emanzipierte und zu einer eigenständigen Kunstform heranwuchs, getragen von den Innovationen des Notendrucks und der wachsenden Bedeutung des Bürgertums als Kulturträger. Ein besonderes Augenmerk gilt der Laute, einem der populärsten Instrumente der Zeit, deren Entwicklung von den bescheidenen Anfängen bis hin zum virtuosen Soloinstrument detailliert nachgezeichnet wird, inklusive der Transformation der Spieltechnik vom Zupfen mit dem Plektrum zum differenzierten Fingeranschlag. Erfahren Sie, wie Venedig mit seinen prunkvollen Festlichkeiten und der Mehrchörigkeit in San Marco zu einem wichtigen Zentrum der instrumentalen Entwicklung wurde, und wie Komponisten begannen, die spezifischen klanglichen Möglichkeiten der Instrumente zu nutzen. Entdecken Sie die bahnbrechende Erfindung des Notendrucks durch Ottaviano Petrucci, die es ermöglichte, musikalische Werke in großem Umfang zu verbreiten und somit eine neue Ära für die Instrumentalmusik einzuleiten, indem Zunftgeheimnisse gelüftet und der Grundstein für den Bedarf an Lehrwerken für Laienmusiker gelegt wurde. Tauchen Sie ein in die Welt der Lautentabulaturen, einer speziellen Notationsform für die Laute, und erleben Sie den Aufstieg der Lautenisten zu gefeierten Virtuosen. Dieses Buch ist eine fesselnde Reise durch die Welt der Renaissance-Instrumentalmusik, die nicht nur die Entwicklung der Musik selbst, sondern auch die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen beleuchtet, die sie ermöglichten. Es ist eine Hommage an die Kreativität und den Innovationsgeist einer Epoche, die den Grundstein für die nachfolgende Blütezeit des Barock legte. Ein Muss für jeden Musikliebhaber, der die Wurzeln der abendländischen Musiktradition verstehen möchte, mit einem besonderen Fokus auf die Rolle der Instrumentalmusik und der Laute in dieser spannenden Zeit des Wandels, von den ersten Lautenbauern bis zu den einflussreichsten Komponisten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Bei der Betrachtung der Instrumentalmusik in der Renaissance im 15. Jahrhundert stößt man auf einen bemerkenswerten Gegensatz zwischen der bildlichen Darstellung von Musik im weitesten Sinne und der musikalischen Quellenlage. Auf nahezu allen Darstellungen kirchlicher oder weltlicher Feste dieser Zeit ist mindestens eine Gruppe von Instrumentalisten zu sehen.1
Die musikalischen Quellen hingegen, in denen fast ausschließlich Vokalmusik überliefert ist, vermitteln einen gänzlich anderen Eindruck. Die Instrumentalmusik des frühen 15. Jahrhunderts ist bis auf wenige Ausnahmen unbekannt.
Die Diskrepanz zwischen bildlicher und musikalischer Überlieferung ergibt sich aus der Tatsache, daß die Instrumentalmusik bis dato mehr als Gebrauchsmusik existierte. Sie wurde von Berufsmusikern ausgeübt und durch sie untereinander weitergegeben. Auch diente die Instrumentalmusik erst noch hauptsächlich als Begleitung für Tanz und Gesang und wurde bis in den Barock hinein in großen Teilen improvisiert.2 Erst in der Mitte des 15. Jahrhunderts begann allmählich auch die schriftliche Fixierung von instrumentaler Musik. Dies mag ein Indiz für die immer größer werdende Beliebtheit der Instrumentalmusik sein, aber vor allem das aufstrebende Bürgertum stellte sich als Kulturträger neben den Adel und sorgte so für einen größeren Bedarf an Spielmusik. Auch das Virtuosentum erfuhr während der Renaissance einen ersten Aufschwung. International berühmte Instrumentalisten fanden an vielen Fürstenhöfen in ganz Europa als reich beschenkte Gäste Aufnahme. Neben der Darstellung der Entwicklung der Instrumentalmusik stelle ich die Erfindung des Notendrucks dar, der für eine viel größere und einfachere Verbreitung von Musik gesorgt hat. Eines der wichtigsten Instrument in der Renaissance war zweifelsohne die Laute, auf deren Entwicklung ich ebenfalls näher eingehen werde.
2. Die Entwicklung der Instrumentalmusik
Die Instrumentalmusik entwickelte sich aus der Tanzmusik in dem sie ihre Bindung zum Tanz, also ihre Funktionalität, lößte und nach Eigenständigkeit strebte. Sie hatte zu Beginn des 15. Jahrhunderts schon vielfältige Formen wie u.a. Motetten, Präludien oder Intabulierungen von polyphonen Liedsätzen. Aber sie war noch stark an das gesungene Wort gebunden und eigentlich emanzipierte sie sich erst im 16. Jahrhundert als eigenständige Kunstform. Die Orgel und die Laute waren dabei die entscheidenden Instrumente. Zwei Tendenzen sind bei der Entwicklung der Instrumentalmusik bis zum Jahr 1600 festzuhalten: Die Loslösung von der Vokalmusik und in der praktischen Ausübung der Weg von der ,,freien Improvisation" zur ,,strengen Komposition".3 Grundsätzlich bestand die Instrumentalmusikpraxis darin, über einem ,,cantus firmus" in langen Notenwerten ( Begleitung ) eine Oberstimme ( Melodie ) mit den Tönen aus dem ,,cantus firmus" mehr oder weniger virtuos zu spielen.
In der Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden die ersten Lehrwerke für das Orgelspiel, sowie die ersten Werksammlungen wie das ,,Fundamentum organisandi" von Conrad Paumann aus dem Jahr 1452. Es faßte die damalige Kompositionspraxis systematisch und didaktisch zusammen. In der Zeit von 1455 bis 1470 entstand das ,,Buxheimer Orgelbuch". Es umfaßte 256 Kompositionen und beinhaltete im Kern schon alle Gattungen und Formen der nachfolgenden Instrumentalstücke. Die Orgelmusik orientierte sich an der Durchimitation der Chorpolyphonie und war damit noch eng an die Vokalmusik gebunden. Fast die gesamte überlieferte Instrumentalmusik des 15. Jahrhunderts ist für Tasteninstrumente bestimmt. Dies belegt die große Bedeutung der Orgel für das häusliche und besonders für das kirchliche Musizieren.
Einen ersten Höhepunkt erlangte die Entwicklung der Orgelmusik in Venedig. Adrian Willaert, aber vor allem Andrea und Giovanni Gabrieli wirkten am Dom von ,,San Marco" und prägten die ,,venezianische Schule". Einen entscheidenden Impuls zur Eigenständigkeit erlangte die Instrumentalmusik durch die Mehrchörigkeit der Musikpraxis an ,,San Marco".4 Die Pracht der Festlichkeiten im Dogenpalast aber vor allem im Dom ,,San Marco" führten zu einem Mitwirken von Zinken und Posaunen am musikalischen Geschehen. Es entstanden eigene Instrumentalchöre, die den Vokalchören gegenübergestellt waren. Später entstanden reine Instrumentalwerke, wie z.B. das ,,Sacrae symphoniae" von 1597, mit denen sich die Instrumentalmusik neben der Vokalmusik etabliert hatte.
Um 1500 wandelte sich das Klangideal der solistischen Instrumentalmusik indem das Orgelspiel von der Laute in den kirchlichen Bereich zurückgedrängt wurde. Die Laute wurde zum beliebtesten Instrument bei gesellschaftlichen Anlässen und für das häusliche Musizieren. Ebenso wie für die Tasteninstrumente wurde für die Laute eine eigene Tabulaturschrift erfunden, die von Land zu Land ein wenig verändert wurde. Das Repertoire der Laute orientierte sich, wie vorher die Orgelmusik, zunächst am vorhandenen Vokalmusikmaterial. Es bestand aus ,,Intavolierungen von Vokalkompositionen". Im unmittelbaren Zusammenhang zu der Erweiterung des Lautenrepertoires mit polyphonen Liedsätzen steht eine spieltechnische Neuerung. Ikonographische Studien ergaben daß die Laute bis ca. 1400 als Begleitinstrument mit einem Zupfblättchen angeschlagen wurde.5 Dies läßt auf eine größtenteils nicht polyphone Spielweise schließen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gingen die Lautenisten dazu über, den Fingeranschlag zu praktizieren. Hans Judenkünig (1523) betonte als einer der ersten den Wert dieser technischen Neuerung, denn nun war ein polyphones und virtuoses Solospiel erst möglich geworden. Die Laute wandelte sich vom Melodieinstrument im Ensemble zum akkordischen Begleitinstrument zum Gesang, als auch zum virtuosen Soloinstrument. Sie hatte aber auch ganz praktische Qualitäten, denn sie war leicht zu transportieren und in der Anschaffung auch von nicht so gut ,,betuchten" Zeitgenossen zu bezahlen.
3. Der Notendruck
Der Venezianer Ottaviano Petrucci erfand um 1507 den Notendruck mit beweglichen Typen und war zugleich der erste Verleger der Musikgeschichte. Diese Erfindung, die zeitgleich mit dem vermehrten Interesse an instrumentaler Musik zusammenfiel, bedeutete für die Geschichte der Instrumentalmusik eine starke Zäsur. Stärker noch als für die Vokalmusik, denn um ihre schriftliche Aufzeichnung hatte man sich schon seit jeher bemüht.6 Es entwickelte sich ein starker Markt und eine große Nachfrage nach Noten- bzw. Lautentabulaturen. Petruccis ,,Harmonice Musices Odhecaton" aus dem Jahr 1501 war ein Sammelsurium aus Vokal- und Instrumentalsätzen für Ensembles und hatte innerhalb weniger Zeit gleich mehrere Auflagen. Die Tatsache, daß nun zum ersten Mal Zunftgeheimnisse des Berufsmusikertums an eine breiteöffentlichkeit gelangten ist daran wohl nicht ganz unbeteiligt. Mit der Verbreitung von Noten wuchs parallel auch der Bedarf an Lehrwerken für die Laienmusiker und ihre jeweiligen Instrumente. Erfolgreicher noch als die Ensemblepublikationen waren die Lautentabulaturen.7 Die erste von Francesco Spinacino erschien 1507 bei Petrucci. Ein bedeutender Unterschied zu den Ensemblepublikationen bestand in der Benennung der Komponisten der Lautenmusik. Während bis weit über die Mitte des 16. Jahrhunderts kaum eine Ensemblepublikation den Namen des Komponisten enthielt, traten mit den Erscheinungen der Lautentabulaturen erstmals die Lautenisten als Individuen in das ,,Rampenlicht".Lehrwerke für das Lautenspiel entstanden in den jeweiligen Landessprachen, so z.B. 1523 von Hans Judenkünig in Deutschland oder 1535 von Don Luys de Milan in Spanien. Im Jahr 1536 übertrug Francesco da Milano französische Chansons, italienische Madrigale und Motetten auf die Laute. Es kam im Laufe der Zeit nicht nur zu einer Verfeinerung der Spieltechnik, sondern damit war auch ein intensiviertes Studium der polyphonen Verpflechtungen und Spieltechniken verbunden.Das Virtuosentum befand sich in seiner Entstehungsphase.
Auch Lehrwerke für andere Instrumente wurden nun publiziert. Der Lautenist und Instrumentenbauer Hans Gerle veröffentlichte 1532 in Nürnberg in seinem Lehrwerk über das Lautenspiel auch jeweils Kapitel über die ,,Viola da Gamba" und die ,,Viola da braccio". 1535 veröffentlichte der Flötenvirtuose Silvestro Ganassi in Venedig die Flötenschule ,,La Fontegara".
4. Die Laute
4.1. Entwicklung und Ursprung der Laute
Die Laute zählt zu den ältesten Musikinstrumenten der Menschheit. Die erste Entwicklungsform, der Tanbûr, ist im 2. Jahrtausend v.Chr. auf babylonisch-assyrischen Denkmälern nachgewiesen.8 Schon damals besaß diese Instrumentenfamilie viele Formen, so daß die Forschung davon ausgeht, daß die Erfindung der Saiteninstrumente noch eher in der Menschheitsgeschichte zu datieren ist, und auch parallel an verschiedenen Orten stattfand. Man vermutet den Ursprung der Saiteninstrumente bei den vorderasiatischen Völkern der Vorzeit.
Die Araber vervollkommneten und verbreiteten den bis zu 4-saitigen Tanbûr und entwickelten aus ihm in den ersten Jahrhunderten n.Chr. den 5-saitigen Ud, der noch heute in dessen Zentren Bagdad und Kairo gespielt wird. Der Ud war die Laute der islamischen Völker und aus seinem Namen entstanden die Bezeichnungen der Laute in den europäischen Ländern. Laute (dt), Lute (eng), Luth (fra), Liuto (ita), Laud (esp) und im portugiesischen Alaude vom arabischen ,,al-ud", was übersetzt Holz-instrument bedeutet.
In der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts gelangte die arabische Laute, der Ud, durch die Eroberung Spaniens und Siziliens durch die Mauren nach Europa. Von hier aus verbreitete sich die Laute in ganz Europa und spielte jahrhundertelang eine bedeutende Rolle im kulturellen Leben.
Am Anfang des 16. Jahrhunderts kristalisierte sich ein eigener Lautenstil heraus. Es war der erste wirkliche Instrumentalstil, der z.B. auch die Entwicklung des späteren Klavierstils beeinflußt hat.9
Die Träger der Lautenmusik waren im Mittelalter die Heimat- und besitzlosen Spielleute, deren rechtliche und soziale Stellung sehr niedrig war. In der Renaissance traten die Spielleute zunehmend in den höfischen Dienst, um ihre soziale Stellung zu verbessern. In größeren höfischen Instrumentalensembles hatten Lautenisten bis in das 18. Jahrhundert hinein ihren festen Platz. Bis zum 17. Jahrhundert war die Laute sogar das Lieblingsinstrument aller gesellschaftlichen Schichten.10
4.2. Die Notation der Laute
„Einen Strich oder Schlag muß man schlagen, dass er weder länger noch kürzer klingt als der Glockenschlag der Kirchturmuhr, oder wie man gemächlich Geld zählt: eins - zwei - drei - vier, eins so lang wie das andere ...“, so eine zeitgenössische Tempoangabe über das Lautenspiel.11
Die Kunst des Lautenspiels wurde bis ca. 1500 mündlich überliefert. Danach wurde die gesamte Lautenmusik vom 16. Bis zum 18. Jahrhundert mit wenigen Ausnahmen, darunter Bachs Lautenwerke, in Tabulaturschrift aufgezeichnet. Diese Griffschrift war in vier Typen in Gebrauch, die man je nach der Herkunft in eine deutsche, französische, italienische und spanische Tabulatur unterschied. Jede Saite des Instruments wurde durch eine Linie gekennzeichnet, auf der weitere Informationen zum „Greifen“ notiert waren wie z.B. der Finger oder in welchem Bund. Die Dauer der Töne ist über den Griffzeichen angegeben. Der Ursprung dieses Liniensystems liegt wohl auch in der arabischen Lautenpraxis.12 Die älteste Lautentabulatur stammt aus dem Jahr 1507 und wurde in Venedig gedruckt. Der älteste französische Tabulaturdruck stammt von Pierre Attaignant aus Paris aus dem Jahr 1529.
5. Schlußbetrachtung
Um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert ist die Instrumentalmusik nicht mehr unvollkommen oder nur eine Nebenbeschäftigung neben der Vokalmusik, sondern wartet mit eigenen Formen und Strukturen auf. Die musikalische Sprache ist oft schon von der Idiomatik der einzelnen Instrumente geprägt.
Hat die Renaissance mit ihrer Zentriertheit auf den Menschen als Individuum die Instrumentalmusik beeinflußt oder gar erst selbst entstehen lassen? Zumindest wurden die gesellschaftlichen Schichten, welche sich an der Reproduktion von Musik beteiligten immer größer. Der Mensch entdeckte sich als Persönlichkeit im Musizieren, im Spielen und im bewußten Nachvollziehen des Instrumentalklanges .
Nun, nach der Etablierung der Instrumentalmusik in der Renaissance, begann ihr goldenes Zeitalter : der Barock.
Literatur
-
Dahlhaus, Carl (Hg)
„Neues Handbuch der Musikwissenschaft" Bd.3 - Die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts Laaber-Verlag ; Wiesbaden 1989
-
Eggebrecht, Hans Heinrich
„Musik im Abendland. Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart." 2. Auflage 1998
-
Pohlmann, Ernst
„Laute, Theorbe, Chitaronne. Die Lauteninstrumente: ihre Musik und Literatur von 1500 bis zur Gegenwart." Eres Verlag 5. Auflage; Bremen 1982
-
Ragossnig, Konrad
„Handbuch der Gitarre und Laute" Schott Verlag; Mainz 1978
- Quote paper
- Ulf Petershagen (Author), 1999, Die Entwicklung der Instrumentalmusik in der Renaissance, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94931