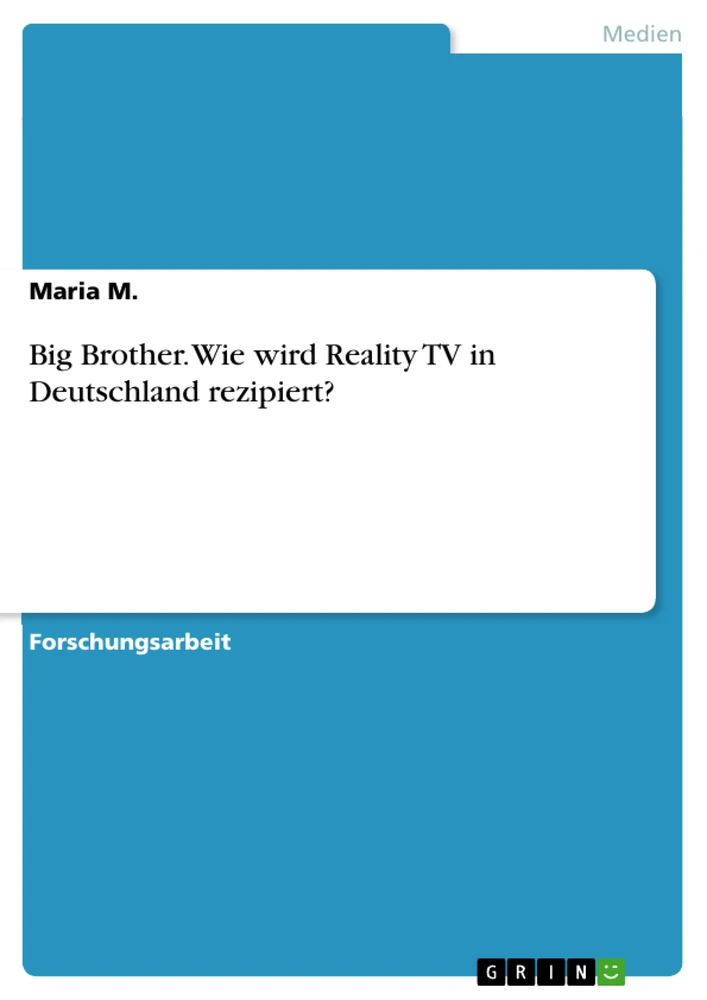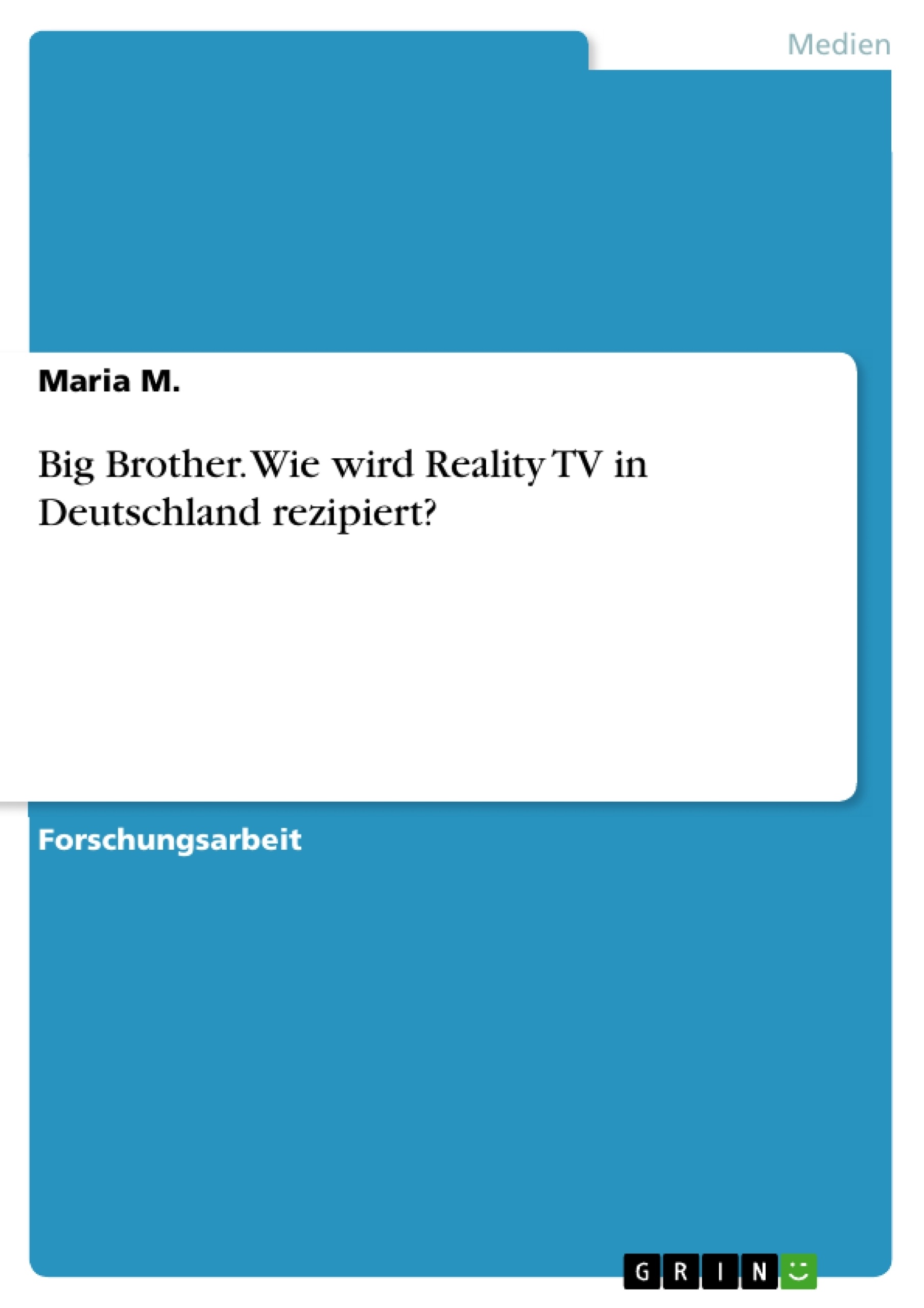In dieser Arbeit wird die Frage behandelt, welchen Stellenwert in der deutschen Medienlandschaft heutzutage die Show Big Brother einnimmt. Und: wird diese immer noch rezipiert oder ist der Erfolg der Big Brother Ära mit der Auswahl an anderen Reality-TV Formaten erloschen? Um unser Erkenntnissinteresse zu untermauern, werden wir die Entwicklung der Rezeption von Big Brother untersuchen, sowie damit verbundene Rezeptionsgründe. Wer sieht sich heute Big Brother immer noch an und welche Motivation steckt dahinter? Wer hat aufgehört die Show zu sehen und aus welchem Anlass?
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 1.1 Hinführung
- 1.2 Darstellung der Fragestellung und theoretische Vorüberlegungen
- 1.3 Stand der wissenschaftlichen Arbeit
- 1.4 Überblick über den Aufbau der Arbeit
- 2.0 Methode
- 2.1 Darstellung der Methoden
- 2.1.1 Methode der medienbiografischen Fallrekonstruktion
- 2.1.2 Datenerhebung mittels narrativer Interviews
- 2.1.3 Methode der Grounded Theory
- 2.2 Die methodische Vorgehensweise
- 2.2.1 Medienbiografie
- 2.2.2 Grounded Theory
- 3.0 Ergebnisse
- 3.1 Realitätsnähe
- 3.1.1 Interesse an den Kandidaten als „echten“ Menschen
- 3.1.2 Ausdrückliche Abneigung gegenüber der B-Prominenz
- 3.2 Realitätsferne
- 3.2.1 Isolation und Besonderheit des Settings
- 3.3 Lebenssituation der befragten Personen
- 3.3.1 Veränderung der Lebenssituation
- 3.3.2 Typisches Zuschauerbild
- 3.3.3 Persönliche Sehmotive
- 3.3.4 Nutzungsweisen
- 4.0 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Rezeption von Big Brother in der deutschen Medienlandschaft seit seiner ersten Staffel im Jahr 2000. Ziel ist es, den Stellenwert der Show im heutigen Fernsehprogramm zu ermitteln und die Rezeptionsgründe der Zuschauer zu analysieren. Die Studie fragt nach den Motiven derjenigen, die Big Brother weiterhin schauen, und den Gründen für den Abbruch der Rezeption bei anderen Zuschauern. Die Ergebnisse sollen helfen, etablierte Bilder von Big Brother-Zuschauern zu hinterfragen.
- Entwicklung der Popularität von Big Brother seit der ersten Staffel
- Rezeptionsmotive der Zuschauer und Gründe für den Abbruch der Rezeption
- Der Einfluss von Cross-Medien-Techniken auf den Erfolg der Show
- Die Rolle von Alltags- und Medienwelten in der Sendung Big Brother
- Vergleich der Einschaltquoten verschiedener Staffeln
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Reality-TV und die besondere Bedeutung von Big Brother als Meilenstein der deutschen Fernsehgeschichte ein. Sie beschreibt die anfängliche Euphorie um die Sendung und stellt die Forschungsfrage nach dem aktuellen Stellenwert von Big Brother und den zugrundeliegenden Rezeptionsgründen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und erläutert die theoretischen Vorüberlegungen.
2.0 Methode: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Studie. Es erläutert die verwendeten Methoden, wie die medienbiografische Fallrekonstruktion, die Datenerhebung mittels narrativer Interviews und die Grounded Theory. Detailliert wird die methodische Umsetzung im Kontext der Untersuchung der Big Brother Rezeption dargestellt.
3.0 Ergebnisse: Die Ergebnisse präsentieren die Analyse der Zuschauerreaktionen auf Big Brother. Sie untersuchen Aspekte der Realitätsnähe und -ferne, beleuchten die Lebenssituationen der Befragten und analysieren deren persönliche Sehmotive und Nutzungsweisen im Zusammenhang mit der Sendung. Der Kapitel gliedert sich in Untersuchungen zu "Realitätsnähe" (mit Fokus auf Zuschauerinteresse an "echten" Menschen und Ablehnung von B-Prominenz) und "Realitätsferne" (mit Fokus auf Isolation und Setting). Zusätzlich wird die Lebenssituation der Befragten hinsichtlich Veränderungen, typischen Zuschauerbildern, Sehmotiven und Nutzungsweisen untersucht.
Schlüsselwörter
Big Brother, Reality-TV, Rezeption, Medienlandschaft, Zuschauermotive, Einschaltquoten, Cross-Medien-Techniken, Medienbiografie, Grounded Theory, narrative Interviews, Alltagswelt, Medienwelt, Popularität, Performatives Reality-TV, parasoziale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Big Brother-Rezeption
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der Rezeption von Big Brother in der deutschen Medienlandschaft seit dem Jahr 2000. Im Fokus steht die Ermittlung des Stellenwerts der Show im heutigen Fernsehprogramm und die Analyse der Rezeptionsgründe der Zuschauer. Es wird untersucht, warum manche Zuschauer Big Brother weiterhin verfolgen und andere die Rezeption abbrechen.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welchen Stellenwert hat Big Brother im heutigen deutschen Fernsehprogramm und welche Rezeptionsmotive liegen dem Zuschauerverhalten zugrunde? Zusatzfragen befassen sich mit den Gründen für den Abbruch der Rezeption und der Hinterfragung etablierter Bilder von Big Brother-Zuschauern.
Welche Methoden werden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet eine multimethodische Herangehensweise. Es kommen die medienbiografische Fallrekonstruktion, die Datenerhebung mittels narrativer Interviews und die Grounded Theory zum Einsatz. Diese Methoden werden detailliert im Kapitel 2.0 beschrieben.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung (mit Hinführung, Fragestellung, Stand der Forschung und Überblick), Methode (mit Beschreibung der angewandten Methoden und Vorgehensweise), Ergebnisse (mit Analysen zur Realitätsnähe, Realitätsferne und Lebenssituation der Befragten) und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis gibt einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte.
Welche Ergebnisse werden in der Studie präsentiert?
Die Ergebnisse präsentieren eine Analyse der Zuschauerreaktionen auf Big Brother. Untersucht werden Aspekte der Realitätsnähe und -ferne, die Lebenssituationen der Befragten, deren persönliche Sehmotive und Nutzungsweisen. Es wird zwischen Aspekten der Realitätsnähe (Interesse an "echten" Menschen und Abneigung gegenüber B-Prominenz) und Realitätsferne (Isolation und Setting) unterschieden. Zusätzlich wird die Lebenssituation der Befragten hinsichtlich Veränderungen, typischen Zuschauerbildern, Sehmotiven und Nutzungsweisen analysiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Popularität von Big Brother, die Rezeptionsmotive der Zuschauer und Gründe für den Abbruch der Rezeption, den Einfluss von Cross-Medien-Techniken auf den Erfolg der Show, die Rolle von Alltags- und Medienwelten in der Sendung und vergleicht die Einschaltquoten verschiedener Staffeln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Big Brother, Reality-TV, Rezeption, Medienlandschaft, Zuschauermotive, Einschaltquoten, Cross-Medien-Techniken, Medienbiografie, Grounded Theory, narrative Interviews, Alltagswelt, Medienwelt, Popularität, Performatives Reality-TV, parasoziale Beziehungen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von Themen im Bereich Medienwissenschaft und Kommunikationsforschung.
- Citation du texte
- Maria M. (Auteur), 2010, Big Brother. Wie wird Reality TV in Deutschland rezipiert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/949975