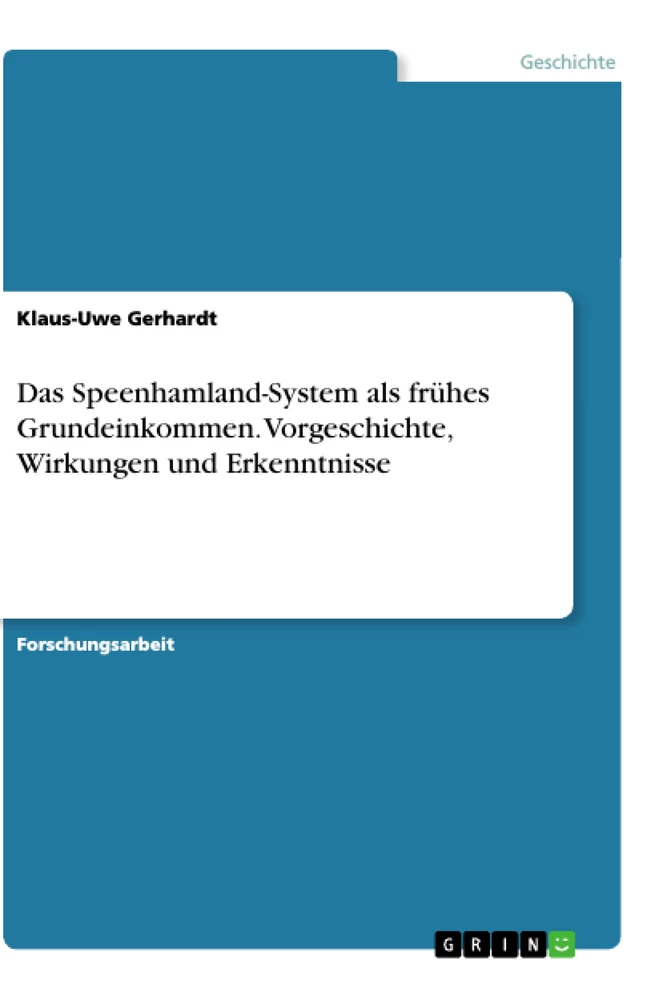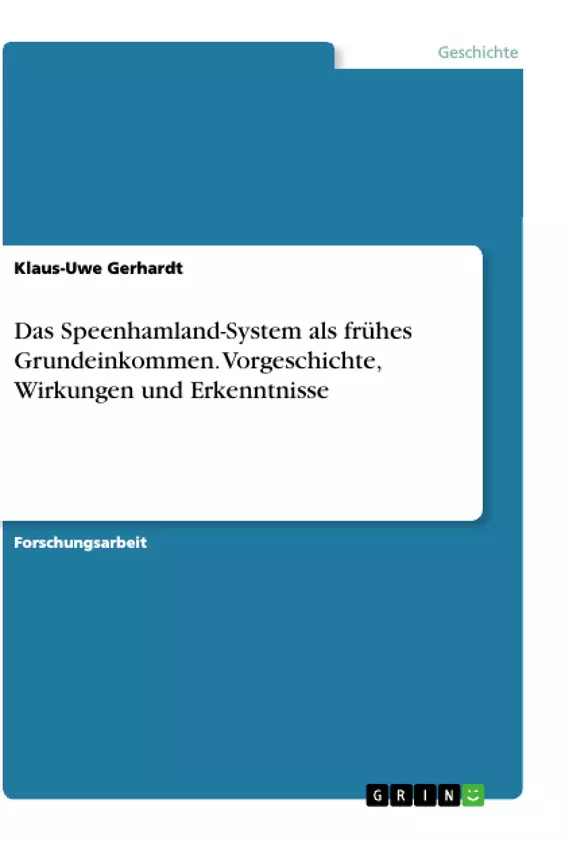Das Buch soll dazu beitragen, die Debatte über die Hauptkritikpunkte gegen das Speenhamland-System mit Blick auf das Mindesteinkommen möglichst sachlich und gut informiert zu führen. Die Fragen die dabei im Zentrum stehen sind Folgende: Welche Vorgeschichte hat das Speenhamland-System der Armenhilfe, wie war es konstruiert, welche Wirkungen gingen davon aus und warum wurde es wieder abgeschafft? Vor allem: Welche Erkenntnisse für eine heutige Sozialpolitik lassen sich aus dem historischen Grundeinkommen ziehen?
Unbestritten war die Zeit zu Anfang des 19. Jahrhunderts nicht für alle Gesellschaftsschichten eine glückliche Zeit. Unbestritten ist auch, dass das Speenhamland-System der Armenhilfe zwischen 1795 und 1834 bei der Umwandlung zur Marktwirtschaft eine Rolle spielte. Wie aber kann ein Fürsorgesystem einerseits das Leben der arbeitsfähigen Armen und ihrer Familien verbessern und ihnen andererseits damit schaden? Nach dem heutigen Wissensstand waren die Auswirkungen der Poor Laws auf die industrielle Revolution nicht annähernd so negativ, wie behauptet wurde.
Meine Hauptthese lautet, dass die behauptete demoralisierende Wirkung des Speenhamland-Systems nicht konsistent nachzuwiesen ist. Speenhamland war allerdings kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern eher ein Kombilohn bzw. ein garantiertes Mindesteinkommen. Dazu werden eine Reihe von mir sozio-ökonomische Fragestellungen, historische Hintergründe, ökonomische Wirkungsmechanismen und politische Folgewirkungen analysiert. Zunächst geht es um Menschenbilder, dann um Hintergründe, Aufbau und Funktion des Speenhamland-Systems. Es folgen mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen, sozio-ökonomische Fragestellungen und eine abschließende Bewertung der Kritik an dem historischen Speenhamland-System. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich Zukunftsfragen nicht ohne historisches Wissen beantworten, aber ebenso wenig alte Problemstellungen eins-zu-eins auf neue Herausforderungen übertragbar lassen.
Die Themen Verarmung und Krise am Arbeitsmarkt sind aktuell, die Kritik an den deutschen Arbeitsmarktreformen nach der Jahrtausendwende ist seit der Einführung der Hartz-Gesetze nicht abgeebbt und viele Probleme im Zusammenhang eines gesellschaftlichen Strukturwandels muten aktuell an. Ein Ausblick auf das Grundeinkommen braucht den Rückblick auf seine Wurzeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung des Marktes für die Arbeit
- Menschliche Arbeit und modernes Menschenbild
- Arbeit als Quelle des gesellschaftlichen Reichtums
- Die „,freie“ Lohnarbeit
- Das Speenhamland-System der Sprengelhilfe
- Historische Einordnung des Speenhamland-Systems (1795-1834)
- Speenhamland-System - ein frühes Grundeinkommen?
- Arbeitsangebot und Erziehung durch Arbeit
- Wirkungen und Gegenwirkungen
- Soziale Gegensätze und ökonomische Interessensgegensätze
- Arbeitskosten, Technikwahl und Inflation
- Lohnzuschüsse und Arbeitsproduktivität
- Transformation und die Rolle des Speenhamland-Systems
- Was an der Kritik des Speenhamland-Systems falsch ist
- Was an der Kritik des Speenhamland-Systems zutrifft
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Speenhamland-System, ein frühes Grundeinkommenssystem, das im späten 18. Jahrhundert in England eingeführt wurde. Sie befasst sich mit den historischen Hintergründen des Systems, seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Gründe für seine Abschaffung. Das Buch will die Frage klären, ob das Speenhamland-System ein erfolgreiches und sozialverträgliches Modell für die Armutsbekämpfung war.
- Historische Einordnung des Speenhamland-Systems
- Das Speenhamland-System als frühes Grundeinkommen
- Die Auswirkungen des Systems auf Arbeit und Wirtschaft
- Die Kritik am Speenhamland-System und die Gründe für seine Abschaffung
- Die Relevanz des Speenhamland-Systems für heutige Debatten über Grundeinkommen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt eine Einleitung zum Thema und stellt den historischen Kontext des Speenhamland-Systems dar. Es beleuchtet die Entstehung des Arbeitsmarktes im 18. Jahrhundert und die Rolle der Arbeit im gesellschaftlichen Reichtum. Das zweite Kapitel untersucht die Entwicklung des Speenhamland-Systems und stellt die unterschiedlichen Perspektiven auf das System vor. Das dritte Kapitel analysiert die Auswirkungen des Speenhamland-Systems auf die Wirtschaft, das Arbeitsangebot und die Sozialstruktur. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Kritik am System und den Gründen für seine Abschaffung. Das fünfte Kapitel betrachtet das Speenhamland-System im Kontext der heutigen Debatten über Grundeinkommen.
Schlüsselwörter
Speenhamland-System, Grundeinkommen, Armut, Sozialpolitik, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsgeschichte, England, 18. Jahrhundert, historische Einordnung, Auswirkungen, Kritik, Debatten.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Speenhamland-System?
Ein 1795 in England eingeführtes System der Armenhilfe, das Lohnzuschüsse gewährte, wenn das Einkommen unter ein bestimmtes Existenzminimum fiel.
Kann man Speenhamland als "frühes Grundeinkommen" bezeichnen?
Es war eher ein garantiertes Mindesteinkommen oder Kombilohn, da es an die Bedürftigkeit und die Brotpreise gekoppelt war.
Warum wurde das System 1834 abgeschafft?
Kritiker behaupteten, es wirke demoralisierend, senke die Arbeitsproduktivität und halte die Löhne künstlich niedrig, was zur Einführung strengerer Armengesetze führte.
Welche Erkenntnisse liefert das System für die heutige Sozialpolitik?
Die Arbeit zeigt, dass historische Debatten über Lohnzuschüsse (wie Hartz IV) verblüffende Parallelen zu den Argumenten des 19. Jahrhunderts aufweisen.
War die Wirkung von Speenhamland wirklich negativ?
Die Hauptthese der Arbeit lautet, dass die behauptete demoralisierende Wirkung wissenschaftlich nicht konsistent nachzuweisen ist.
- Arbeit zitieren
- Dr. Klaus-Uwe Gerhardt (Autor:in), 2020, Das Speenhamland-System als frühes Grundeinkommen. Vorgeschichte, Wirkungen und Erkenntnisse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950034