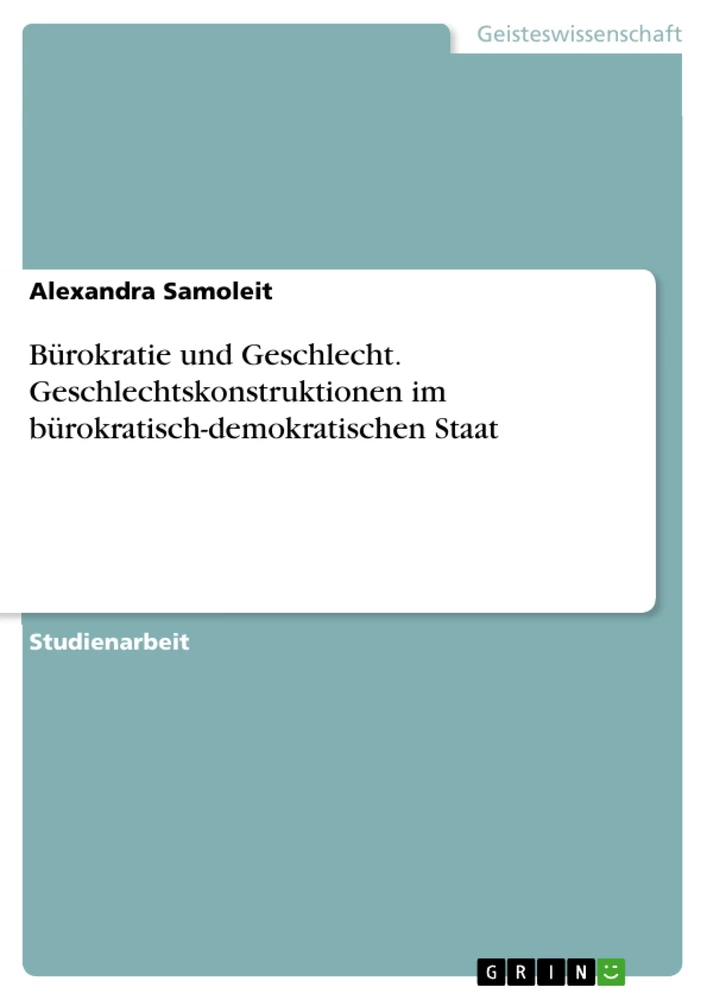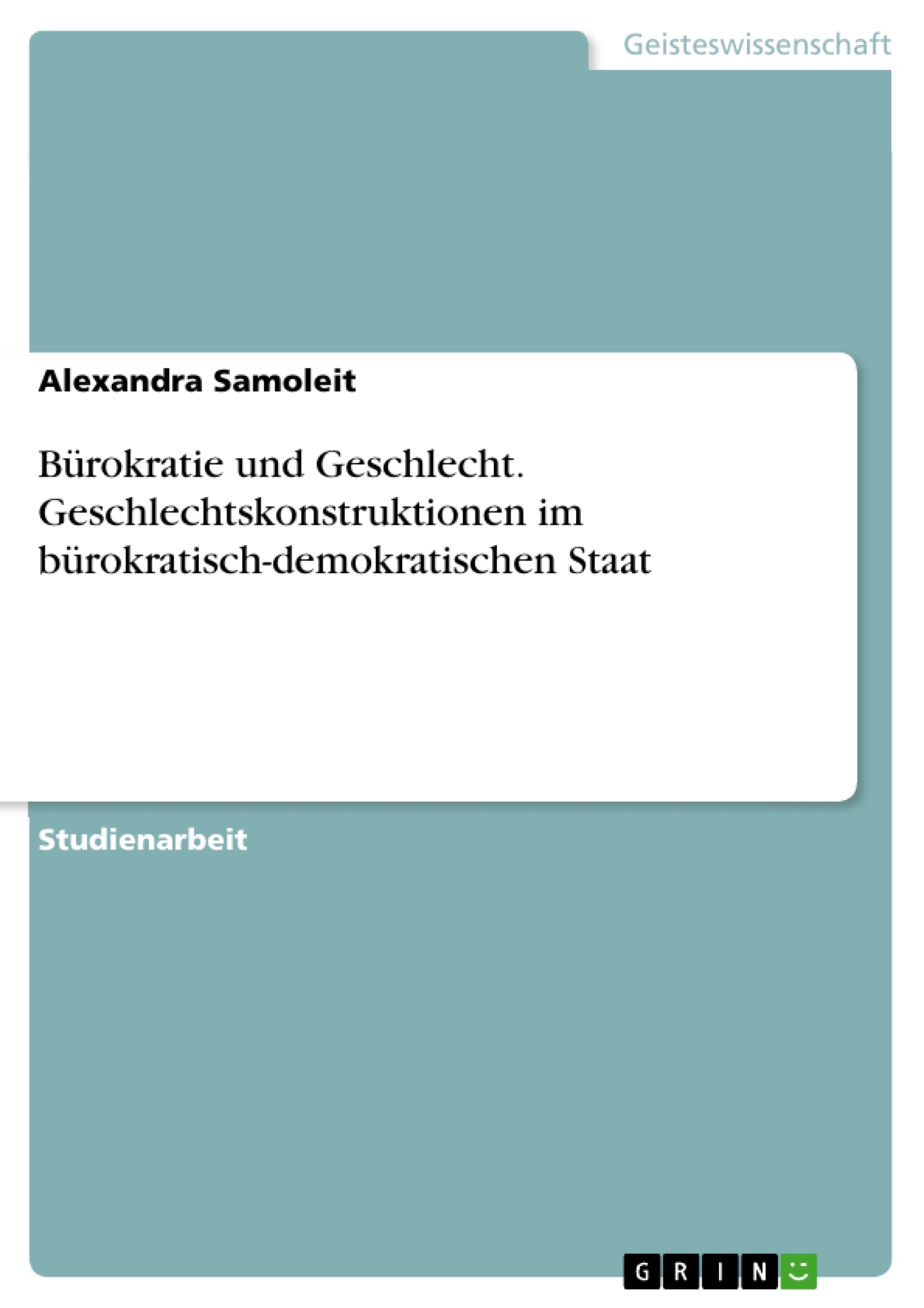Diese Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Fragen: Welches Beziehungsgefüge besteht zwischen Staat und Geschlecht? Inwieweit reproduziert der Staat tatsächlich Normen einer männerdominierten Gesellschaft? Wie wirkt sich das Geschlechterverhältnis in seiner theoretischen und praktischen Form auf geschlechtsspezifische Herrschaftsverhältnisse und staatliche Institutionalisierungsprozesse aus? Welche Bedeutung kommt dem Staat hinsichtlich geschlechtlicher Diskriminierung in der Gesellschaft zu? Welchen Einfluss hat das Wohlfahrtssystem auf die Emanzipation oder Unterdrückung von Frauen und Männern und wie wirkt sich dies auf die gesellschaftlichen Geschlechterdefinitionen aus?
Im ersten Teil der Arbeit soll ein kurzer Überblick über den Forschungsstand und die verwendeten Autoren erfolgen, bevor die Begrifflichkeiten Bürokratie, Staat und Geschlecht erläutert werden. Der zweite Teil befasst sich mit der historischen Charakterisierung des Staats als männliches Konstrukt. Dem folgend wird betrachtet, wie der Bürokratisierungsprozess auf verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens im Staat Einfluss hat. Im vierten Teil soll konkret betrachtet werden, in welchem Verhältnis weibliche und männliche Geschlechtskonstruktionen zum bürokratischen Staat stehen und in welcher Art und Weise Männer und Frauen in ihrer Lebenswelt von geschlechtlicher Diskriminierung durch den Staat betroffen sind.
Abschließend wird zusammengefasst, welche Implikationen eine geschlechtliche Staatsstruktur für das Staatssubjekt hat.
Der Prozess der Modernisierung, Rationalisierung und Demokratisierung, in dessen Zuge sich das bürokratische System moderner Nationalstaaten herausbildete, scheint bei oberflächlicher Betrachtung ein Prozess der Vermännlichung gewesen zu sein. Der Staat hat historisch einen distinktiv männlichen Charakter, der sich in unterschiedlichen Begrifflichkeiten artikuliert.
Das Geschlechter- und Strukturverhältnis im Nationalstaat wurde lange Zeit als patriarchalisch beschrieben. Der Staat wurde und wird als eine Art Männerbund verstanden, was sich auf seine eingeschlechtliche, organisatorische Struktur bezieht, in der politische und wirtschaftliche Positionen mehrheitlich durch Männer besetzt sind. In diesem Zusammenhang schwingt ein intrinsischer Maskulinismus in Form eines öffentlichen Ideologiesystems zur gesellschaftlichen Propaganda männlicher Überlegenheit mit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeit und Forschungsstand
- Forschungsstand
- Bürokratie
- Der Staat
- Kapitalismus
- Geschlecht
- Der „,männliche Staat\" Teil 1
- Die,,Männlichkeit“ bürokratischer Verwaltung
- Selektion und Institutionalisierung von Gefühlen
- Der Staat als Männerbund
- Die bürokratische Normativierung des Staatssubjekts
- Selbsterhaltung bürokratischer Strukturen und deren gesellschaftliche Verankerung
- Die Private Sphäre
- Sphärentrennung
- Der Ehevertrag bei John Locke
- Die,,bürokratisierte“ Familie
- Die Ehe unter dem Einfluss von Bürokratisierung und Kapitalismus
- Jugendgerichtsbarkeit zur Durchsetzung normativer Strukturen in der Familie
- Geschlechterkonstruktion in der Erziehung und Bildung
- Geschlechterunterschiede in der Kindererziehung
- Die öffentliche Bildung
- Der Wohlfahrtstaat als bürokratische Kontrollinstanz
- Geschlechterdiskriminierung im bürokratischen Staatssystem
- Frauen im bürokratischen Staat
- Historische Kontinuität weiblicher Unterdrückung
- Feministische Staatstheorie
- Männer im bürokratischen Staat
- Schlussfolgerung - Das bürokratisierte Staatssubjekt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Bürokratie und Geschlecht im Kontext des modernen demokratischen Staates. Ziel ist es, zu beleuchten, wie das geschlechtliche Machtverhältnis im Staat reproduziert und gleichzeitig durch bürokratische Strukturen beeinflusst wird.
- Die historische Konstruktion des Staates als männliches Konstrukt
- Die Normierung des Staatssubjekts durch bürokratische Prozesse
- Der Einfluss von Bürokratisierung auf die private Sphäre, insbesondere die Familie
- Die Auswirkungen von Bürokratie auf Geschlechterrollen in Bildung und Erziehung
- Geschlechterdiskriminierung im bürokratischen Staatssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet den Forschungsstand, bevor sie wichtige Begrifflichkeiten wie Bürokratie, Staat und Geschlecht erläutert.
Kapitel 2, „Der „,männliche Staat\" Teil 1“, analysiert die historische Charakterisierung des Staates als männliches Konstrukt, indem es auf die „Männlichkeit“ bürokratischer Verwaltung, die Selektion und Institutionalisierung von Gefühlen und die Darstellung des Staates als Männerbund eingeht.
Kapitel 3, „Die bürokratische Normativierung des Staatssubjekts“, befasst sich mit der Frage, wie der Bürokratisierungsprozess verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens im Staat beeinflusst, insbesondere die Private Sphäre, die „bürokratisierte“ Familie, Geschlechterkonstruktionen in der Erziehung und Bildung sowie die Rolle des Wohlfahrtstaates als bürokratische Kontrollinstanz.
Kapitel 4, „Geschlechterdiskriminierung im bürokratischen Staatssystem“, untersucht, in welcher Beziehung weibliche und männliche Geschlechterkonstruktionen zum bürokratischen Staat stehen und wie Männer und Frauen in ihrer Lebenswelt von geschlechtlicher Diskriminierung durch den Staat betroffen sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Bürokratie, Geschlecht, Staat, Machtverhältnisse, Geschlechterrollen, Geschlechterdiskriminierung, Wohlfahrtstaat, Feministische Staatstheorie und androkratische Ausprägung des Staates.
Häufig gestellte Fragen
Inwiefern ist der moderne Staat ein "männliches Konstrukt"?
Historisch gesehen wurde der Staat als "Männerbund" entwickelt, dessen bürokratische Strukturen und Machtpositionen primär männlich geprägt waren und männliche Überlegenheit propagierten.
Wie beeinflusst Bürokratie das Geschlechterverhältnis in der Familie?
Bürokratische Normen wirken bis in die Privatsphäre hinein, etwa durch die rechtliche Definition der Ehe oder die Jugendgerichtsbarkeit, die bestimmte Rollenbilder innerhalb der Familie festigen können.
Welche Rolle spielt der Wohlfahrtsstaat bei der Geschlechterdiskriminierung?
Der Wohlfahrtsstaat fungiert oft als bürokratische Kontrollinstanz, die durch ihre Leistungen und Regeln Einfluss auf die Emanzipation oder Unterdrückung von Frauen und Männern nimmt.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in Bildung und Erziehung durch den Staat?
Ja, die Arbeit untersucht, wie staatliche Bildungs- und Erziehungssysteme normative Strukturen vorgeben, die zu unterschiedlichen Geschlechterkonstruktionen bei Kindern und Jugendlichen führen.
Was bedeutet "bürokratisierte Normierung des Staatssubjekts"?
Es beschreibt den Prozess, durch den der Staat über Verwaltungsregeln und Gesetze definiert, wie sich Individuen (Männer und Frauen) zu verhalten haben, wodurch gesellschaftliche Machtverhältnisse reproduziert werden.
- Quote paper
- Alexandra Samoleit (Author), 2007, Bürokratie und Geschlecht. Geschlechtskonstruktionen im bürokratisch-demokratischen Staat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950126