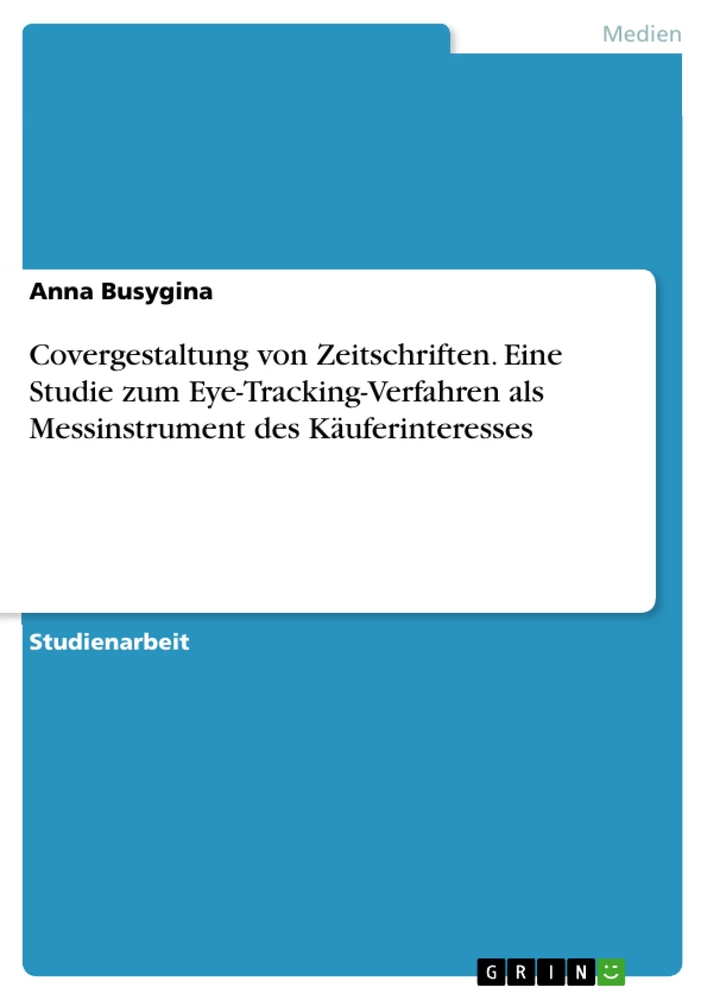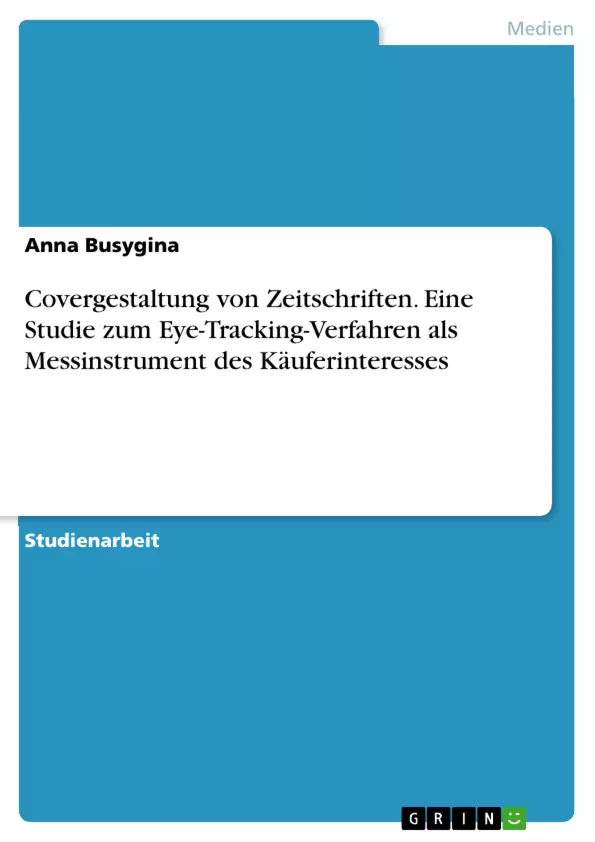Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der Covergestaltung auf den Käufer einer Zeitschrift. Es stellen sich während des Kaufprozesses folgende Fragen: Welches Magazin wird in die Hand genommen und warum? Wie wird ein Cover gelesen? Wie wird der Lesevorgang beeinflusst? Was wird einen Käufer dazu bewegen, genau mit dieser Zeitschrift im Anschluss zur Kasse zu gehen oder sie zurück ins Regal zu stellen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wurde dazu eine empirische Studie durchgeführt, die Gegenstand dieser Arbeit ist.
Jeder Zeitschrift kann man bestimmte Besonderheiten ansehen. Dazu zählen eine bestimmte Größe der Zeitschrift, die Art, wie sie zusammengebunden ist, die Seitengestaltung, die Qualität des Papiers, ob es glatt oder glänzend ist usw. Auf diese Besonderheiten verweist auch Daniel Pfurtscheller (2017). Durch bestimmte Merkmale wird der eine oder der andere Leser angezogen und sein Interesse geweckt. Wenn Vogue auf Arabisch einem westlichen Leser in die Hand fällt, wird er direkt den visuellen Unterschied im Vergleich zu Vogue auf Deutsch oder Englisch feststellen können. Hierbei erscheint das Cover der arabischen Ausgabe aus seiner Sicht plötzlich auf der Rückseite der Zeitschrift und laut der Seitenzahl wird in dieser von rechts nach links geblättert. Christoph Rauch (2007) verweist darauf, dass Arabisch eine linksläufige Schrift ist. Trotz dieser Auffälligkeiten wird man direkt und ohne Zweifel sagen können, dass Vogue Arabia keine Zeitung oder kein Buch ist, sondern definitiv eine Zeitschrift. Auch wenn vorne das weltweit bekannte Wort Vogue gar nicht erscheinen würde, würde man dieses Schriftstück einer Zeitschrift zuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodischer Teil - Eye-Tracking
- Gruppenarbeit
- Ausarbeitung der Forschungsideen
- Testablauf
- Covers
- Methode
- Eye-Tracking-Ergebnisse - Wie werden sie entschlüsselt?
- Lesevorgang
- Marie, Marie
- Rapids
- Ergebnisse
- AOI-Erhebungsdaten
- Befragung
- Auswertungen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der visuellen Gestaltung von Zeitschriftencovern und untersucht, wie diese von unterschiedlichen Probanden mithilfe des Eye-Tracking-Verfahrens gelesen werden. Die Forschungsarbeit analysiert die typographischen Merkmale von Covers und untersucht deren Einfluss auf den Lesevorgang. Sie zielt darauf ab, die Funktionsweise des Eye-Tracking-Verfahrens zu erläutern, den Ablauf eines Eye-Tracking-Experimentes darzustellen und die Ergebnisse dieses bottom-up-Experimentes zu entschlüsseln.
- Visuelle Gestaltung von Zeitschriftencovern
- Eye-Tracking-Verfahren und dessen Anwendung in der Forschung
- Typographische Merkmale von Covers und deren Einfluss auf den Lesevorgang
- Analyse von Eye-Tracking-Daten
- Bottom-up-Forschungsansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und erläutert die Besonderheiten von Zeitschriften im Vergleich zu anderen Schriftstücken. Sie führt die Forschungslücke im Bereich der visuellen Gestaltung von Zeitschriftencovern aus, die diese Arbeit mit dem Eye-Tracking-Verfahren zu schließen versucht. Der methodische Teil befasst sich mit dem Eye-Tracking-Verfahren, erklärt dessen Funktionsweise und erläutert die notwendigen Komponenten eines Eye-Tracking-Systems. Es wird auf den Begriff AOI (Area of Interest) eingegangen und die Kalibrierung des Eye-Trackers beschrieben. Die Kapitel 3 und 4 befassen sich mit der Gruppenarbeit und der Durchführung des Eye-Tracking-Experimentes.
Schlüsselwörter
Eye-Tracking, Zeitschriftencover, Typografie, visuelle Gestaltung, Lesevorgang, AOI (Area of Interest), Bottom-up-Forschungsansatz, Forschungslücke.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Covergestaltung das Kaufverhalten?
Das Cover entscheidet in Sekunden, ob eine Zeitschrift im Regal wahrgenommen, in die Hand genommen und schließlich gekauft wird. Visuelle Reize und Typografie sind hierbei entscheidend.
Was ist das Eye-Tracking-Verfahren?
Eine Methode zur Messung von Blickbewegungen. Sie zeigt genau, welche Elemente eines Covers (z. B. Schlagzeilen, Gesichter) zuerst und wie lange betrachtet werden.
Was bedeutet AOI beim Eye-Tracking?
AOI steht für „Area of Interest“ (relevanter Bereich). Forscher definieren diese Zonen auf dem Cover, um statistisch auszuwerten, wie viel Aufmerksamkeit bestimmte Bilder oder Texte erhalten.
Gibt es kulturelle Unterschiede beim Lesen von Covers?
Ja, zum Beispiel wird die arabische „Vogue“ von rechts nach links gelesen, da Arabisch eine linksläufige Schrift ist, was den gesamten visuellen Aufbau im Vergleich zu westlichen Ausgaben verändert.
Was ist ein Bottom-up-Experiment in der Designforschung?
Dabei wird untersucht, wie Merkmale des Reizes (Farben, Formen) die Aufmerksamkeit automatisch lenken, bevor das Gehirn den Inhalt bewusst verarbeitet.
- Quote paper
- Anna Busygina (Author), 2020, Covergestaltung von Zeitschriften. Eine Studie zum Eye-Tracking-Verfahren als Messinstrument des Käuferinteresses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950576