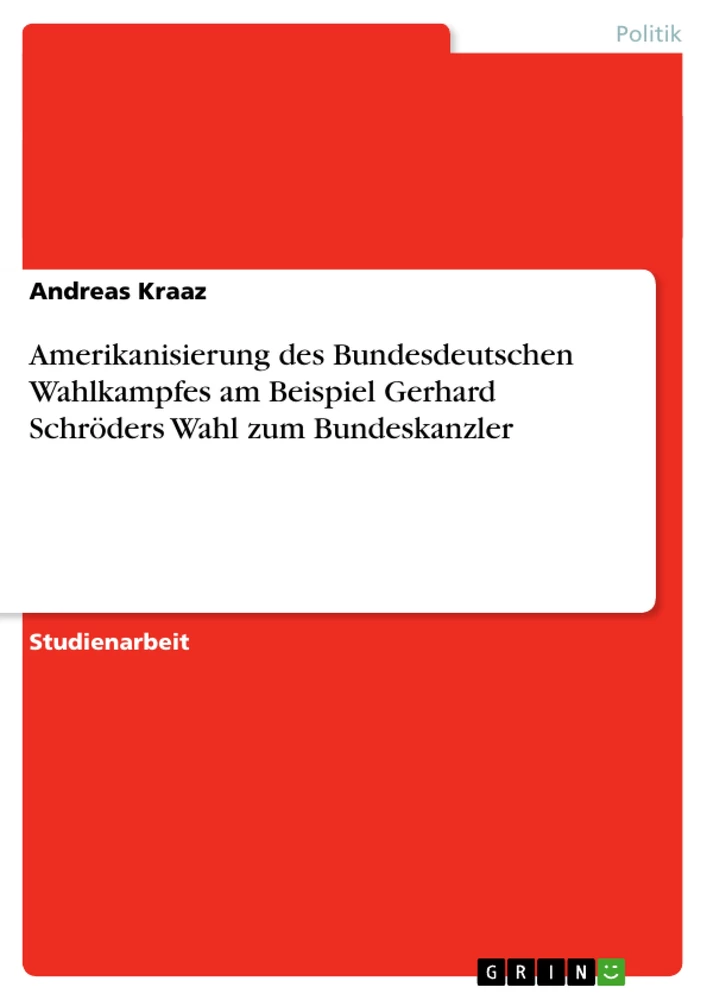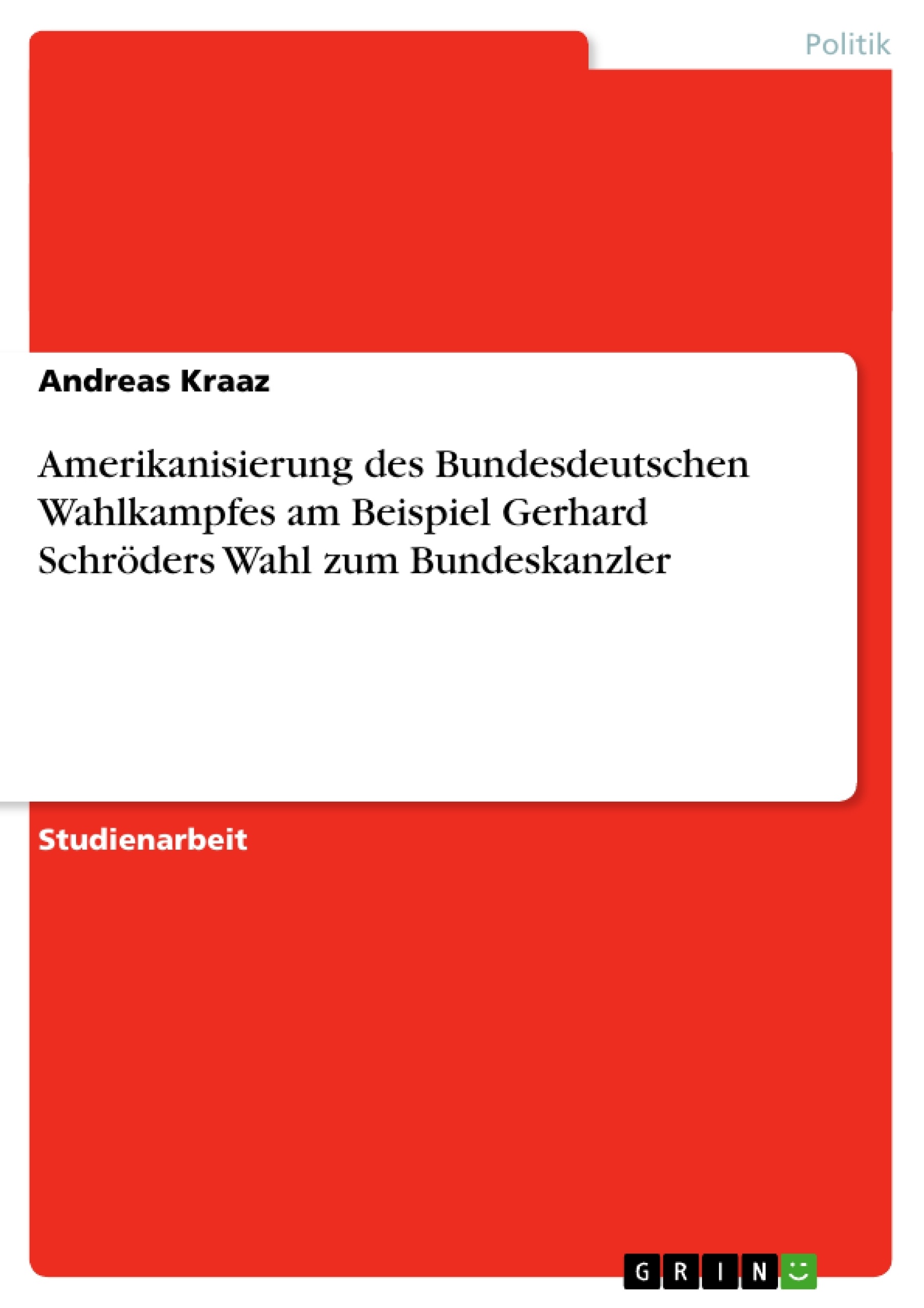Gliederung
1. Einleitung
2. Die steigende Bedeutung des Wahlkampfes entspricht der steigenden Bedeutung des Kandidaten
3. Falluntersuchung: SPD-Bundestagswahlkampf 98 - Gerhard Schröder
3.1. Presseauswertung
3.2. Bedeutung der Massenmedien für den Wahlkampf
4. Kurze Auswertung der Personalisierung anderer Parteien im Bundestagswahlkampf 98
5. Gegen den Trend - DVU-Wahlkampf in Sachsen-Anhalt
6. Fazit / Ursachen und Folgen der Personalisierung
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Wer als Politiker erfolgreich sein will, muß sich ganz auf seine Wähler konzentrieren. Er muß um ihre Gunst buhlen und sie direkt und so persönlich wie nur irgendmöglich ansprechen. In der Werbebranche hat diese Strategie schon seit Jahren einen Namen. Die Rede ist von sogenannten „Relationship-Marketing“1.Dieses machen sich die Parteien im Wahlkampf erfolgreich zu nutze. Eine Kommunikation zwischen Partei und Wähler wird um so persönlicher, wenn man einen Spitzenkandidaten in das Rennen schickt. Das personifizierte „Parteiprogramm“ bietet deutliche Vorteile im Wahlkampf. SPD = Gerhard Schröder, CDU = Helmut Kohl ist eine gewollte Vereinfachung bestehender parteipolitischer Bindungen, die dem Wähler die „einfache“ Entscheidung läßt zwischen Personen zu wählen. Politische Inhalte verschwinden nicht, werden aber seitens der Parteien nicht primär zu Werbe-Wahlkampfzwecken genutzt. Der Wähler hat nach wie vor die Möglichkeit, sich über parteiliche Inhalte zu informieren, wird aber in erster Linie von einer verstärkten Personalisierung beeinflußt. Das Image einer hängt (gerade) im Wahlkampf vom Charisma und der Kompetenz des jeweiligen Spitzenkandidaten der Parteien ab. Wahlkampf ist eine Form von Werbung. Diese unterteilt man in die sogenannte Image- und Produktwerbung ein. Im Wahlkampf wird ein gewisses Image des „Produktes“ Politik an den Mann gebracht. Das funktioniert natürlich nur, wenn man Inhalte, Ziele und Vorstellungen bündeln kann und auf eine gewisse Person projiziert. Damit personalisiert man den Wahlkampf.
Meiner Meinung zufolge ist im Bundesdeutschen Wahlkampf eine starke Personalisierung zu verzeichnen. Diese läßt sich in einer Amerikanisierung und Intensivierung des deutschen Wahlkampfes erkennen. Ich möchte meine Anfangsthese und Ursachen und Wirkung einer Personalisierung im Wahlkampf in dieser Hausarbeit erläutern und festigen. Dazu werde ich exemplarisch in Punkt 2 „Der Bundestagswahlkampf im Jahr 1998 und der damit verbundene Wahlkampf des heutigen Bundeskanzlers Gerhard Schröder untersuchen.
Desweiteren gebe ich eine kurze Erläuterung zu einen Gegenbeispielen. Daher versuche ich zu klären, wie es die DVU in Sachsen-Anhalt auch ohne Leitfiguren und Spitzenkandidaten schaffte, ein Achtungszeichen in der Parteienlandschaft unseres Landes zu setzen. Die Arbeit an meiner Ausarbeitung war von einigen Schwierigkeiten begleitet. So konnten mir die einzelnen Landesverbände nicht weiterhelfen und verwiesen mich zum Thema Personalisierung im Wahlkampf auf die Bundesverbände, auf dessen Antworten ich heute noch warte. Gerne hätte ich Interviews mit Wahlkampfverantwortlichen geführt und diese meiner Arbeit zugefügt. Dies war aber leider seitens der Parteien nicht möglich. Die Literaturlage ist als ausreichend bis gut zu bezeichnen, wobei zu erwähnen ist, daß etliche Ausgaben der Zeitschrift „für Parlamentstage“ seit Wochen nicht in der Bibliothek zu entleihen sind, da sie gerade neu gebunden wurden. Diese obengenannten Sachverhalte erschwerte meine Arbeit etwas. Auch waren große Zeitungen wie „FAZ“, „Süddeutsche“ oder „Die Welt“ aus Kostengründen nicht bereit, mir Artikel oder Exemplare ihrer Veröffentlichungen aus der Wahlkampfzeit 1998 zur Verfügung zu stellen. Ich hatte dies zu berücksichtigen. Positiv ist die Fülle des Informationsgehaltes im Internet zu bewerten, sowie die äußerst freundliche Hilfe der Magdeburger Staatskanzlei, die mir etliche Pressespiegel zur Verfügung stellten.
2. Die steigende Bedeutung des Wahlkampfes entspricht der steigenden Bedeutung des Spitzenkandidaten
Der Bundesdeutsche Wahlkampf ist immer das bedeutendste Instrument für die Parteien, um dem Wähler ihren Spitzenkandidaten für die wichtigste Führungsposition unseres Landes - dem Kanzleramt - zu bewerben. Die personalistische Gesellschaft der Gegenwart wird immer weniger durch allgemein verbindliche Vorbilder und Leitbilder zusammengehalten.2 Die Menschen haben heute sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie leben wollen und ihre Zukunft zu gestalten ist. Zur Zukunft gehört natürlich auch das Nachdenken über Politik.
„Wer wählt, nimmt an diesem politischen Entscheidungsprozess teil, übt Einfluß aus und zwar direkt oder indirekt auf die personelle Zusammenstellung unseres Parlamentes.“3 Also wird es immer wichtiger, dem Wähler zu suggerieren, daß er nicht „bloß“ eine politische Liste wählt, sondern eine Persönlichkeit, einen Menschen mit Namen, Beruf und Familie. Die Zeiten des wirklichen politischen Interesses in breiten Teilen der Bevölkerung sind vorbei. Die Parteien müssen sich schon mehr einfallen lassen, als „über“ politische Kompetenz zu arbeiten. Der Wahlkampf ist in den letzten Jahren deutlich intensiver geworden, seine Bedeutung stetig gewachsen.4 Vor dem Hintergrund wachsender wirtschaftlicher Schwierigkeiten, so die Überlegung von Fachleuten in der Parteienforschung, neigen immer mehr BürgerInnen dazu, Wahlbeteiligung zu verweigern. Darauf muß die Politik natürlich reagieren. Man muß große Überzeugungsarbeit leisten, sprich Wahlkampf in den Vordergrund stellen. Ein weiterer Grund für die wachsende Bedeutung des Wahlkampfes ist die zunehmende Multi- Medialisierung unserer Gesellschaft.5 Noch nie zuvor gab es so vielschichtige Möglichkeiten, in direkter oder indirekter Kommunikation mit dem potentiellen Wähler zu treten. Nach wie vor spielen TV und Radio und selbstverständlich die Printmedien die größte Bedeutung im Wahlkampf. Als neues Medium ist das Internet als Plattform für den Wahlkampf hinzugekommen. Noch nie waren die Medien so wichtig für den Spitzenkandidaten wie heute. Die Bedeutung der Medien in unserer Gesellschaft ist gestiegen. Da der Wahlkampf in ihnen ihr wichtigstes Instrument findet, verzeichnet auch seine Bedeutung einen Anstieg. Ergo steigert sich auch die Rolle des Spitzenkandidaten, der nach meiner Aussage Hauptaugenmerk im Wahlkampf besitzt.
3. Falluntersuchung am Beispiel Gerhard Schröder- Wahl zum Bundeskanzler 1998
Eine Karriere wie in einem Fassbinder-Film.6 Das Arbeiterkind, aufgewachsen mit fünf Geschwistern und ohne Vater, schafft es bis zum mächtigsten Politiker Deutschlands. „Wir waren arm, aber glücklich“, 7 betont Schröder immer wieder. Und jetzt als Kanzler hat er nichts vom hollywoodreifen Auftreten aus Wahlkampfzeiten verloren. Sein Lebenstraum hat sich erfüllt. Schröder ist jemand, der schwer zu „fassen“ ist. Dieses Image wurde in akribischer Kleinstarbeit von Wahlkampfmanager Müntefehring und etlichen Promotion- und Werbeagenturen wie den ostdeutschen Ponesky und Leo (organisierten die Auftritte und Vermarktung im gesamten ostdeutschen Raum)8 und Schröder-Berater Hombach aufgebaut. Er stellte sich einerseits auf die Seite der Arbeitlosen, andererseits profilierte er sich als Mann der Industrie. „Eine dicke Havanna ist für ihn genauso selbstverständlich wie die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit.“9 Der gesamte Bundeswahlkampf 98 der SPD war auf Gerhard Schröder ausgelegt. In Wahlwerbespots, Plakaten und Öffentlichkeitsauftritten stellte man ihn als „politischen Manager“10 dar. Im gesamten Wahlkampf wurde versichert, daß er zupacken will. Vom Rechts-Links-Schema wurde sich verabschiedet. „Modern“ und „Neue Mitte“ wurden zu Schlagwörtern der SPD-Wahlkampfstrategen. Der 54-jährige Schröder wurde als jung- dynamische Leitfigur einer Politik des Wandels dargestellt. Politische Ziele seiner Partei verschoben sich in den Hintergrund. Reform der Arbeitsmarktpolitik,11 innere Sicherheit12 oder soziale Gerechtigkeit 13 wurden fortan eng an die Person Schröders geknüpft. Internationale demokratische Gewinnertypen, wie Großbritanniens Premier Tony Blair oder Bill Clinton standen Pate im Wahlkampf 98. Gerhard Schröder entspricht voll und ganz dem neuen Politikerideal. Für kein Interview oder Statement war oder ist er sich zu schade. Immer lächelnd präsentierte er sich von unzähligen Plakaten als Sinnbild des politischen Umbruchs. Durch diese starke Personifizierung und Greifbarmachung seiner Person gewann Schröder letztendlich die Wahl und konnte das Amt des Bundeskanzlers antreten.
3.1.Presseauswertung Wahlkampf 98
14 Das Jahr 1998 stand voll und ganz im Zeichen des Bundeswahlkampfes. Das vor allem die Medien wichtigstes Instrument hierbei waren, erläuterte ich bereits auf den vorangegangenen Seiten. Um die wachsende Personalisierung insbesondere im Falle der Wahl Gerhard Schröders zum deutschen Bundeskanzler zu verdeutlichen und anschaulich zu machen, füge ich meiner Ausarbeitung hiermit eine Presseauswertung der Monate April bis September 1998 hinzu. Aus den unkommentierten, lediglich auf den Kerninhalt gekürzten Artikel ist deutlich zu ersehen, daß es im Großteil nur um die Person Gerhard Schröders geht. Selbst politische Inhalte und Zielvorstellungen der SPD werden stets auf Gerhard Schröder gemünzt oder zumindest mit seiner Person in Verbindung gebracht. Zur Rolle der Massenmedien im Zusammenhang mit Wahlkampf und Personalisierung komme ich dann im nächsten Unterpunkt meiner Ausarbeitung.
20.4.98
Die Juso-Vorsitzende Andrea Nahles kritisiert im Kölner „Express“ scharf den Parteitag der SPD: „Mein Anspruch an eine innerparteiliche Demokratie ist ein anderer. Was in Leipzig passiert ist, war undemokratisch.“
Die Zeitung „Information“ (Kopenhagen) kommentiert den SPD- Wahlkampf: „Was ist eigentlich neu an Schröders ‚neuer Mitte‘? Nicht mehr als das Wort neu. Und natürlich Schröders schräges Hollywood- Lächeln.“
21.4.98
Schröder umwirbt BDI-Chef Henkel auf der Hannover-Messe: „Die Industrie wird keine Probleme mit einer SPD-Regierung haben.“ Henkel entgegnet. „Der Kandidat predigt zwar die Notwendigkeit der Wettbewerbsfähigkeit, seine Partei beschließt genau das Gegenteil.“ (Bild, 21.4.98)
22.4.98
Schröder trifft am Rande der Hannover-Messe den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko, obwohl nach einem EU-Ratsbeschluß den EUMitgliedern dringend empfohlen wird, wegen der diktatorischen Regierungsweise Lukaschenkos auf Kontakte auf höchster Ebene zu verzichten. Die Staatskanzlei bezeichnet den Besuch als „privat“. Lukaschenko ist mit Vize-Premier, Außenminister, Außenwirtschaftsminister, Industrieminister und Postminister angereist. Schröder ist amtierender Bundesratspräsident. (FR, 22.4.98)
23.4.98
Die Grünen nennen Schröder wegen des Lukaschenko-Treffens einen „außenpolitischen Tolpatsch“. (SZ, 23.4.98)
Matthäus-Maier im „ZDF-Morgenmagazin“ zur Schröder-Äußerung von der „kränkelnden Frühgeburt“ EURO: „Über Worte will ich nicht sprechen, ich hätte diesen Ausdruck nicht gewählt, aber in der Sache hat er doch recht.“
24.4.98
Die „Wirtschaftswoche“ schreibt über Schröder: „Die Tatsache, daß er ein hohles Gefäß ist, das reaktionäre Weltverbesserer wie Oskar Lafontaine oder Jürgen Trittin nur zu gerne mit Inhalten füllen, macht ihn zu einem unkalkulierbaren Risiko. [...]
Die „taz“ vermerkt zu Schröders Treffen mit Lukaschenko: „Vielleicht würden Vertreter der weißrussischen Sozialdemokraten, von denen einige in Gefängnissen sitzen, auch gerne einmal mit Schröder zu Mittag essen.“
26.4.98
Die „Welt am Sonntag“ berichtet von der Berufung des stellvertretenden IG-Metall-Vorsitzenden Riester als Arbeitsminister in Schröders Schattenkabinett.
27.4.98
Höppner verläßt bei 35,9% für die SPD in Sachsen-Anhalt der Realtitätssinn: „Das ist ein großartiger Wahlsieg der SPD“. Sein Finanzminister Schaefer meint kopfschüttelnd, von einem Sieg könne die SPD nun wirklich nicht mehr sprechen. (Die Welt, 27.4.98)
Für Müntefering ist der sog. Schröder-Effekt offenbar doch nur eine regionale Angelegenheit. Im „DLF“ erklärt er auf die Frage, „Aber diesmal hat der Schröder-Effekt nicht so gezogen, wie in Niedersachsen?“: „Gut, in Niedersachsen ist Schröder zu Hause. Da gibt es eine andere Ausgangslage.“
Schröder im „Tagesthemen“-Interview: „Ich habe natürlich genau hingehört, was Reinhard Höppner gesagt hat. Und wenn er von stabiler Regierung, die er bilden will, redet, dann scheidet natürlich aus Tolerierungen - rechts sowieso, aber nach meinem Eindruck auch andere.“
Die IG Metall bestätigt, daß Riester im Falle eines Wahlsieges in die Bundesregierung wechseln werde. (Handelsblatt, 27.4.98)
Roland Berger gibt Schröder im „Spiegel“ einen deftigen Korb: „Als Münchener werde ich bei der Bundestagswahl CSU wählen.“ Weiter sagt er: „Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, wie von der SPD gefordert, wäre ein gravierender Fehler.“
29.4.98
Riesters Berufung hat für Verstimmung gesorgt. Dreßler hat erst aus der Presse davon erfahren, daß er in einem möglichen SPD-Kabinett nicht Sozialminister werden soll. Kanzlerkandidat Gerhard Schröder habe bis Dienstag überhaupt nicht mit ihm gesprochen. Er habe allerdings mit Parteichef Oskar Lafontaine in dieser Angelegenheit telefoniert. Beides wollte Dreßler nicht kommentieren. (WAZ, 29.4.98)
30.4.98
In der SPD-Fraktion in Sachsen-Anhalt wird wegen des von Schröder ausgeübten Drucks auf Höppner von „Besser-Wessi“ und „zentralistischen SED-Methoden“ gesprochen. (FR, 30.4.98)
Offensichtlich sind die Grünen für Schröder doch wieder regierungsfähig. Mit Fischer spricht er über die Verteilung von Ministerien. (Berliner Zeitung, 30.4.98)
In einer Aktuellen Stunde im Bundestag stimmt Verheugen der Bewertung, der weißrussische Präsident Lukaschenko sei ein „Diktator“ ausdrücklich zu, nennt Schröders Treffen mit Lukaschenko aber dennoch „richtig“. (FR, 2.5.98)
1.5.98
Der DGB rührt die Werbetrommel für die SPD. Der ÖTV-Vorsitzende Mai sagt: „Diese Regierung muß weg.“ (dpa, 1.5.98) Lafontaine meint dazu: „Wenn die Gewerkschaften heute Vorschläge zu Bekämpfung der Arbeitslosigkeit machen, dann ist das keine platte Einmischung in den Wahlkampf, sondern ihre Pflicht.“ (dpa, 1.5.98)
4.5.98
Der „Focus“ schreibt über „Schröders Schwachstelle: Er wirbt für eine SPD, die es gar nicht gibt.“
Der „Spiegel“ erinnert daran, daß Schröder 1994 Höppner noch geraten hat: „Nimm doch die PDS mit in die Regierung...“.
Die „SZ“ kommentiert: „Mit diesen Aussagen hat sich Walter Riester dem Verdacht ausgesetzt, diesen Almosen-Staat aus vergangenen Epochen wieder herbeizureden. Deshalb muß er nun konkret benennen, welche Schritte er in der Sozialpolitik gehen will. Sonst verfestigt sich der Eindruck, Schröder habe zwar mit Rudolf Dreßler einen Mann von gestern aus seinem Schattenkabinett ferngehalten, dafür aber einen von vorgestern hineingehievt.“
6.5.98
Offensichtlich gibt es in der SPD doch Streit um die Rentenpolitik. Im Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion wird schon angezweifelt, ob Riester der richtige Mann für den Posten des Arbeitsministers einer SPDRegierung ist. Vorstandsmitglied Haak: „Die Berufung Riesters war eine einsame Entscheidung seitens Schröder.“ (Bild, 6.5.98)
9.5.98
„Wieviel hat Gerhard Schröder in der Partei, die ihn zum Kanzlerkandidaten kürte, noch zu sagen?“ fragt die „Rheinische Post“.
„Die Welt“ berichtet von einem Krisengespräch zwischen Scharping und dem „tief verbitterte[n] Kanzlerkandidate[n]“.
Die „Berliner Zeitung“ kommentiert des Fernbleiben Schröders bei der Geburtstagsfeier Israels in Berlin: „Nur sagen seine Berater, daß Schröder nur zu Veranstaltungen geht, wo er auch reden darf und daher niemals daran denken würde, auf dem Parkett zu verharren, um dem amtierenden Kanzler zuzuhören. Es gibt also in der Einordnung Schröders nichts, was wichtiger sein könnte, als er selbst. Das ist eine hochmütige und arrogante Position, die er sich abgewöhnen muß. Denn nicht jedes Geschwätz ist eine Rede.“
11.5.98
Und Schröder wirft Zwickel auf dem „Klartext“-Forum seiner Partei vor, mit seiner Forderung „die Wirklichkeit in den Betrieben“ zu mißachten. Lafontaine hatte Zwickels Forderung nach weiterer Arbeitszeitverkürzung ausdrücklich begrüßt. (Rheinische Post, 12.5.98)
Das „Handelsblatt“ kommentiert: „Der Eindruck, er habe die SPD nicht im Griff, ist für Schröder schon fatal genug. Wie der Teufel das Weihwasser fürchtet Kohls Herausforderer aber, mit den Grünen oder der PDS auch nur in Verbindung gebracht zu werden.“
Der „Focus“ schreibt: „Die enge Beziehung ostdeutscher Sozialdemokraten zu den Kommunisten offenbart einen tiefen Riß quer durch die SPD.“
12.5.98
Schröder antwortet auf die Frage „Aber ist dieses Hängen an der DVU nicht auch ein bißchen Taktik bei der SPD?“ in den „Tagesthemen“: „Das mag im Einzelfall so sein.“
Die „Kölnische Rundschau“ schreibt: „Inoffiziell soll Gerhard Schröder allerdings stärkere Töne angeschlagen haben. So soll er angeblich geäußert haben, er werde Höppner (‚der hat sowieso keinen Arsch in der Hose‘) persönlich aus der SPD werfen, wenn der es mit der PDS treibe.“
In der Umgebung Schröders heißt es: „Eine SPD-Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt mit Duldung der PDS wäre eine Bloßstellung Schröders.“ Schröder sagt, es gebe „keinen formalen Einfluß von außen“, schickt aber seinen Wahlkampfberater Hombach nach Magdeburg. (Berliner Zeitung, 12.5.98)
Die „FAZ“ kommentiert das erste „Klartext“-Forum der SPD zu ihrem Wahlprogramm: „Etwas mehr Klartext wäre von Schröder schon zu erwarten. Bis zum 27. September ist ‚immer nur lächeln‘ nicht genug.“
14.5.98
Die Grünen machen die „Rolle rückwärts“ (Bild, 15.5.98). Das umstrittene Wahlprogramm soll vertuscht werden, ein „Kurzprogramm“ wird aufgelegt.
16.5.98
Die „HAZ“ kommentiert den SPD-Streit um die PDS: „Der SPD- Strahlemann Schröder hat sich in der eigenen Partei schon vor der Wahl nicht durchsetzen können. Die Genossen haben seine Warnung in den Wind geschlagen. Nun kann man sich fragen, weshalb es ihm nach der Bundestagswahl besser ergehen und er als Kanzler durchsetzen sollte, was ihm als Kandidat verwehrt worden ist.“
20.5.98
Müntefering betont mit Blick auf Schröder zur PDS-Frage: „Es gibt da keine Verwerfungen zwischen uns“ (ADN, 20.5.98)
21.5.98
Schröder macht das Rentenchaos perfekt: „Für die, die jetzt von der Schule kommen, soll es nur noch eine beitragsfinanzierte Grundrente geben.“ (Wirtschaftswoche, 21.5.98)
22.5.98
Schröder im „Bild“-Interview auf die Frage „Ist die PDS für Sie eine demokratische Partei?“: „Diese Frage interessiert mich nicht.“
„Die Welt“ schreibt: „Wie im Fall der verlorenen Kraftprobe um eine PDS-Duldung in Sachsen-Anhalt stellt sich schon heute die Frage, ob Schröder womöglich nur eine aus wahlstrategischen Gründen vorgeschobene Galionsfigur der SPD ist.“
23.5.98
Lafontaine und Müntefering behaupten - anders als Schröder - weiterhin, die CDU habe das Scheitern der Verhandlungen über eine Große Koalition in Sachsen-Anhalt durch maßlose Forderungen provoziert. (Rheinische Post, 23.5.98)
25.5.98
Der „Tagesspiegel“ kommentiert: „Warum versteckt Schröder den Finanzierungsvorbehalt im Kleingedruckten? Das besagt doch nichts anderes, als daß den Rentnern ungedeckte Versprechungen gemacht werden. Der Vorwurf der Rentenlüge wird Schröder schneller ereilen, als er sich heute vorstellen.“
Das ARD-Magazin „Fakt“ erläutert eine dimap-Umfrage: „So recht mag also fast die Hälfte der Bundesbürger dem SPD-Kandidaten seine Beteuerungen nicht mehr glauben, er werde sich auf keinen Fall mit PDS-Stimmen zum Bundeskanzler wählen lassen. Das Vertrauen zu Gerhard Schröder hat gelitten.“
26.5.98
Schröder gibt im Rentenstreit klein bei und gleichzeitig Rätsel auf. In der SPD-Präsidiumssitzung erklärt er, mit seinem Ausdruck „beitragsfinanzierte Grundsicherung“ nie etwas anderes gemeint zu haben, als die beitragsfinanzierte, leistungsorientierte Grundrente. Ein Präsidiumsmitglied: „Verblüffend“. (FR, 26.5.98)
Schröder stellt „auf Druck der Fraktion“ (Tagesspiegel, 27.5.98) seine Wahlkampfmannschaft vor.
Die „Stuttgarter Nachrichten“ schreiben zur Planung Schröders, Lafontaine zum Finanzminister zu machen: „Ansonsten soll ausgerechnet dem Saarländer das Schlüsselressort des Finanzministers zufallen, einem Mann also, der die überfällige Steuerreform kaputtgemacht, den Euro kritisiert, als Ministerpräsident die eigenen Landesfinanzen kaputtgemacht und den finaziellen Transfer in die neuen Länder stets skeptisch begleitet hat.“
27.5.98
Zu Schröders Verhalten hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der PDS in Sachsen-Anhalt schreibt die „Rheinische Post“: „Im übrigen ist der Kandidat von einer derart verblüffenden Wendigkeit, daß man ihm auch zutraut, dereinst an der Spitze einer neuen Linksbewegung zu stehen.“
Die Kommentare zur Wahlkampfmannschaft Schröders fallen nicht besser aus: „Nicht mehr als eine Pflichtübung“ (Kölnische Rundschau, 27.5.98), „Gemessen an den Spekulationen ist Schröders Liste nun eher unspektakulär ausgefallen“ (Rheinische Post, 27.5.98), „Und jetzt: Hausmannkost. [...] Die große Frische verströmen sie nicht.“ (SZ, 27.5.98)
28.5.98
Die Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen Müller sagt gegenüber der „Rheinischen Post“: „So langsam steht Schröder nicht nur inhaltlich für politische Beliebigkeit, sondern auch strategisch.“
Lafontaine schimpft vor der Bundestagsfraktion, das Gerede einiger seiner Parteikollegen zur Rente gehe ihm langsam „auf den Geist“. Teilnehmer sagten, daß die Kritik offensichtlich in erster Linie an den SPD-Kanzlerkandidaten Schröder und seinen Berater Hombach gerichtet gewesen sei. (SZ, 29.5.98)
Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Anke Fuchs, fordert erneut eine Ausbildungsabgabe, um jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu garantieren. Diese Abgabe werde auch von Schröder unterstützt. „Da können Sie sich drehen und wenden, wie Sie wollen, das wird kommen“, sagt Fuchs. (dpa, 28.5.98)
29.5.98
Die Staatskanzlei in Hannover erklärt hinsichtlich der Ausbildungsplatzabgabe, Schröder bleibe bei seiner [ablehnenden] Haltung. (Rheinische Post, 29.5.98)
Schröder läßt wieder einmal tief blicken. Vor der versammelten SPDBundestagsfraktion sagt er, die Berliner Arbeitssenatorin Bergmann sein in seinem Wahlkampftteam zuständig für „Frauen und das ganze andere Gedöns“. (Süddeutsche Zeitung, 30.5.98)
31.5.98
Die „BamS“ schreibt: „Das Dümmste, was Schröder passieren könnte, wäre die absolute Mehrheit seiner Partei. Dann wäre er eine Geisel seines linkssozialistischen Flügels und eine Marionette Lafontaine. Fast genauso schlecht wäre für ihn Rot-Grün. Dann würde sich der linke SPDFlügel mit den Grünen verbünden, um dem Wirtschaftsstandort Deutschland endgültig den Garaus zu machen.“
3.6.98
Die „Welt“ schreibt über Schröders vergebliche Suche nach einem Wirtschaftsvertreter für sein Schattenkabinett: „Doch alle Bewerber, die Schröder ansprach, winkten ab. Ein Grund: Keine renommierte Persönlichkeit aus der Wirtschaft ist bereit, das Programm der SPD mitzutragen.“
Die „FAZ“ schreibt über Schröder und Fischer: „Ihre erste Bewährungsprobe als parteiinterne Deichbauer gegen links haben sie hinter sich. Beide sind naß bis auf die Haut. Über Schröder ist das Wasser einfach hinweggeschwappt, Fischer hat den gebrochenen Deich immerhin noch notdürftig flicken können.“
4.6.98
„Die Welt“ berichtet, daß an der Spitze der Ostberliner Agentur, die Schröders Auftritte in den neuen Bundesländern organisiert, mit Gerald Ponesky und Uwe Leo zwei Personen stehen, die langjährige Erfahrung in der Organisation von Großveranstaltungen in Ostdeutschland aus der Zeit vor 1989 mitbringen. Dazu gehörten die Pfingsttreffen der FDJ wie auch Honeckers 750-Jahr-Feier Osteberlins 1987. Uwe Leo gehörte zum „Oktoberclub“, der „bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit nahezu das gesamte Oeuvre proletarischer Kampflieder zum Besten gab und zu den propagandistischsten Hauptstützen der Staatsjugend zählte.“ (Die Welt, 4.6.98)
6.6.98
In einem vorab veröffentlichten Spiegel-Gespräch kündigte PDS-Chef Lothar Bisky an, er selbst werde als Bundestagsabgeordneter Schröder wählen. Er halte Schröders gegenteilige Äußerungen für „eine Ausflucht, die nur bis zum 27. September gilt.“ (dpa, 6.6.98)
8.6.98
Der „Spiegel“ wirft die Frage auf, ob es beim Bau der Millionen-Villa von Schröder-Manager Hombach mit rechten Dingen zugegangen sei.
3.9.98
„Berliner Zeitung“: „Schröder akzeptiert im Osten PDS-Bündnisse. Er traut Kooperationen akzeptabler und gestandener(?) Landeverbände selbständige Entscheidungen zu.
4.9.1998
Bild titelt: „Duell im Bundestag-so schlugen sich die Kandidaten Spitzenkandidaten. Rededuell endete mit einem Unentschieden. Schröder und Kohl erweisen sich als ebenbürtig.“
„Die Welt“: „Beflügeltes Parlament“ Die Welt untersucht die Kompetenz der Spitzenkandidaten Kohl und Schäuble und kommt zum Schluß, daß Deutschland weiterhin von Kanzler Kohl regiert werden sollte.
„SZ“: Auch die „Süddeutsche Zeitung“ titelt „Duell der Sieger“ und geht dabei nur auf die Personen Kohls und Schröders ein, ohne auf inhaltliche Fragen ihrer Partei einzugehen.
9.9.98
„FAZ“: Die neue Mitte des Irgendwo: FAZ berichtet von Strategieänderung der SPD-Doppelspitze auf der Zielgeraden des Bundestagswahlkampfes 98. Die SPD versucht Profil des Kandidaten zu verschärfen.
14.9.98
„Magd. Volksstimme“: „Schröder im Regen kurz und knapp“. SPD Wahlkampf auf dem Magdeburger Domplatz lockte im strömenden Regen nur knapp 1000 Leute. Schröder sprach als Leitfigur vom „wahren Aufbau Ost“ sowie einer „neuen, kraftvollen Politik“.
15.9.98
„Bild/MD“ zum selben Thema: „Gerade 1000 Menschen wollten Schröder im Dauerregen sehen.“
16.9.98
„Die Welt“: „Das Rennen ist offen. Die Berliner Republik wählt anders - die Seele der guten alten Tante SPD leidet“ schreibt das CDU-nahe Blatt „Die Welt“ und geht wiedereinmal fast ausschließlich auf SPD- Frontmann Schröder ein.
24.9.98
„Neues Deutschland“: „Höchste Zeit für die Wahl“ Das „ND“ schreibt von der verblassenden Faszination Schröders und dem Untergang der Kohl-Ära.
28.9.98
„Tagesspiegel“: „Der Wähler wollte ein neues Gesicht“ Überwältigender Wahlsieg Gerhard Schröders wird stark an seiner Person und seinem Wahlkampf festgemacht. Der „Tagesspiegel“ kommt zu Ergebnis, daß Schröders „neues Gesicht“ den alten Kanzler abgelöst hat.
3.2.Die Bedeutung der Massenmedien im Wahlkampf
Personalisierung wuchs und wächst während des Wahlkampfes proportional zur Medialisierung. Die Massenmedien spielen als Medium die wichtigste Rolle im Wahlkampf.
„Für die Mehrheit der modernen Wähler findet der Wahlkampf in den und durch die Massenmedien statt. Die größte Aufmerksamkeit genießt in diesem Zusammenhang des Fernsehen.“15 Wissenschaftler, besonders in den USA, beschäftigen sich schon seit langem mit der Rolle des TV.
Besonders im Wahlkampf ist eine breite Beeinflussung der Menschen durch das Fernsehen zu erkennen. „Danach reagiert der Wähler auf Fernsehsendungen, wie der sprichwörtliche Esel auf den Stock“.16 Das soll heißen, je mehr das Fernsehen auf ihn (den Wähler) eindringt, desto fester beharrt er auf dem Standpunkt, den er einmal eingenommen hat. Er nimmt nur das wahr, was er hören und sehen will. Dieses Phänomen nennt man selektive Wahrnehmung.17 Mit dieser will der Wähler innere Konflikte vermeiden und sucht gezielt bestätigende Informationen.
Dieses machen sich die Parteien im Wahlkampf zu Nutze. Man baut gezielt ein gewisses, positives Image auf, das so lupenrein sein muß, daß etwaige negative Berichterstattung dem jeweiligen Kandidaten nichts anhaben kann. Massenmedien können nach bestehenden Thesen nur informieren, die eigentliche Bewertung geht aber vom Menschen aus. Medien werden von Menschen gestaltet und konzipiert. So schließt sich letztendlich der Kreis. Wahlkampfmanager und Politiker wurde schon die große Bedeutung der Massenmedien in den letzten Jahrzehnten immer mehr bewußt.18 Fernsehen, Printmedien, Radio und Internet werden von nahezu jedem Haushalt genutzt. Deshalb sind sie von so einer Wichtigkeit für den Wahlkampf. Nirgendwo kann besser Parteien- und Kandidatenwerbung betrieben werden. Durch die wachsende Medialisierung wird die Personalisierung in der Politik weitestgehend vorangetrieben. Öffentliche Auftritte, Reden, Bundestagsauftritte, Interviews oder andere öffentliche Auftritte politischer Prominenz werden durch die Journalisten landesweit kommentiert und verbreitet. So steht wohl unumstößlich fest, daß die Massenmedien eine große Rolle im (bundesdeutschen) Wahlkampf spielen. Ohne sie würde der Wahlkampf seine wichtigste Plattform verlieren.
4. Kurze Auswertung der Personalisierung anderer Parteien im Bundestagswahlkampf 1998
Auch jenseits der SPD ließ sich bei den anderen deutschen Parteien wie der CDU/CSU ebenfalls eine starke Personalisierung des Wahlkampfes feststellen. Während in der CSU „Aushängeschild und bayrischer Patriot“ Stoiber Sinnbild der CSU ist, war der CDU-Wahlkampf mit der Person Helmut Kohls verknüpft. Die CDU-Wahlkampfstrategen setzten vor Allem auf den sogenannten Kanzlerbonus.19 Es wurde verstärkt mit der Kanzlerfigur Helmut Kohl gearbeitet. Die CDU versprach blühende Landschaften und setzte auf Plakaten stets Helmut Kohl in voller Größe in den Vordergrund seiner Regierungsmannschaft. Wahlkampfmanager Hintze ging sogar soweit, Helmut Kohl als größten Kanzler der Deutschen Geschichte darzustellen. (mag er Bismarck, Adenauer, Erhardt vergessen haben). „Kanzler ist Person und Amt“.20 Unter diesem Leitsatz und der „Ausschlachtung“ politischer Erfolge Kohls (wie z.B. der Wiedervereinigung oder die Bemühungen um ein geeintes Europa) rückten politische Inhalte der Christdemokraten in den Hintergrund und der Amtsbonus des höchsten deutschen Politikeramtes war der Grundstein des CDU-Wahlkampfes im Bundeswahlkampfjahr 1998.
5. Gegen den Trend - Der DVU-Wahlkampf in Sachsen- Anhalt im Jahr 1998
Die Landtagswahl vom 26. April 1998 in Sachsen-Anhalt brachte eine verfassungsfeindliche und antidemokratisch eingestufte Partei in den Magdeburger Landtag. Im Sog der Niedersachsenwahl und im Vorfeld der Bundestagswahlen im September konzentrierte sich das öffentliche Interesse auf eine eventuelle Fortsetzung der „Magdeburger Modells“21 Bei allen Diskussionen über eine PDS-tolerierte
Minderheitsregegierung der SPD wurde einer rechtsgerichteten Partei kaum Bedeutung zugemessen. Gemeint ist die „Deutsche Volksunion“ des Münchener Verlegers Gerhard Frey. Absolut gegen den Trend ohne eine erkennbare Personalisierung, ohne Leitbilder wie z.B. Chef Frey ins Spiel zu bringen, erzielte die DVU unglaubliche 192.086 (Zweit-) Stimmen, das sind 12,9% .22 Die DVU investierte knapp drei Millionen DM in den Wahlkampf, mehr als SPD und CDU zusammen für denselben Zweck aufbrachten. Das Geld wurde aber nicht in die Vermarktung eines Spitzenkandidaten gesteckt. Es gab keine öffentlichen Großkundgebungen, keine Interviews, kein Auftritt in TV oder Presse. Vielmehr blieben die DVU-Kandidaten namen- und gesichtslos. Der DVU-Wahlkampf kam ganz ohne Personalisierung aus, da er gezielt auf eine gewisse Wählerschaft gerichtet war. Die „Deutsche Volksunion“ setzte in ihrem Wahlkampf auf das junge, proletarische und ausländerfeindliche Milieu Sachsen-Anhalts. Gerade diesem erschienen die Parolen, wie „Rette die D-Mark“, „Deutsche Arbeitsplätze für deutsche Arbeitnehmer“, „laß Dich nicht zur Sau machen!“ oder „kriminelle Ausländer raus!“ wohl einfacher und einleuchtender als die Slogans der etablierten Parteien wie SPD („Unser Land - Unser Weg“) und CDU („Investionen, Arbeitsplätze, Sicherheit“).23 Es ist ein Nebeneffekt der Personalisierung und inhaltlicher Entleerung des Wahlkampfes durch die großen Parteien, daß extreme Parteien die Möglichkeit haben bei unzufriedenen und enttäuschten Wählern Erfolge zu erzielen.24 Nicht immer geht also die Strategie der totalen Vereinfachung und Personalisierung in der Politik auf. Wer „nur“ blühende Landschaften verspricht, diese aber innerhalb einer Legislaturperiode nicht schaffen kann, was sicher auch von wirtschafts- sozialen Faktoren abhängt, muß in Kauf nehmen, daß seine Politik an Schlagworte und Personen und nicht mehr an real existierenden Inhalten, Programmen oder Zielen festgemacht wird. Darin liegt eine Gefahr und ein Schlupfwinkel die sich extreme Minderheiten, wie die DVU, zu Hilfe nehmen können. Darauf sollten die etablierten Parteien Rücksicht nehmen und ihr Wahlkampfverhalten gegebenenfalls umstellen.
6. Fazit: „Personalisierung im deutschen Wahlkampf´- Ursachen und Folgen
In den vorangestellten Kapiteln beschäftigte ich mich mit der Personalisierung im deutschen Wahlkampf. Starke Parteien werden von starken Spitzenkandidaten gestützt und umgekehrt. Es steht wohl unumstößlich fest, daß wachsende Personalisierung und gewollte Vereinfachung bis hin zum Schlagwortgebrauch zum Markenzeichen der Wahlzeit geworden sind. Man könnte sagen, die Kürze ist die eigentliche Kunst des Wahlkampfes! Am Beispiel Gerhard Schröders ist zu erkennen, daß ein neues Zeitalter des Wahlkampfes angebrochen ist. Vielleicht hat Gerhard Schröder den Stil deutscher Wahlkämpfe revolutioniert. Personalisierung und Intensivierung sind die Grundpfeiler des „neuen“ Wahlkampfes. Ausländische Vorbilder wie Bill Clinton oder Tony Blair standen Pate für die Figur des alles überstrahlenden Medienstars, dessen Kennzeichen eine veränderte Medienwirklichkeit inklusive „Zweieinhalb-Minuten-Clip“ ist. Deutlich zu erkennen ist die Komprimierung der Wahlbotschaft auf das zur Identifizierung notwendige Minimum. (Neu-) Bundeskanzler Schröder sagte einmal, der Kern der (politischen) Botschaft müsse auf einer Telefonkarte Platz finden. Und er sollte Recht behalten.
Die FDP etwa illustrierte den Slogan „Wir sind bereit“ mit einer schillernden, oder definitionsgemäß leeren, Seifenblase. „Die Kraft des Neuen“ erinnerte später an die „Neuen SPD-Mega-Perls“ Und auch während CDU-Stratege Wolfgang Schäuble noch dafür plädierte, einen inhaltlichen Wahlkampf zu führen, speckte auch seine Partei deutlich ab. Unter den Händen von Parteichef Helmut Kohl wurde aus Schäubles 56- Seiten-Entwurf für ein gemeinsames Wahlprogramm der Union eine knappe Fünf-Punkte-Liste. Die Bündnis-Grünen rangen sich zur Ausarbeitung eines „Kurzprogramms“ durch, welches Vorschläge wie den „Fünf-Mark-Benzinpreis“, einen NATO- und Atomaustritt enthalten und gar erläutern sollte. Die FDP kam spartanisch mit einem Punkt:
„Steuern senken!“ aus. Und auch Protestpartei PDS setzte voll und ganz auf ihre Vorzeigegenossen Gysi, Modrow, Bisky und Co. und vereinfachte auf die Formel: „Wir Ossis sind dagegen!“ Schnell könnte man an eine wirklich neue Erfindung des Wahlkampfes in deutschen Landen denken. Ich bin aber der Meinung, daß der Wahlkampf keineswegs einen revolutionär neuen Weg eingeschlagen hat. Allenfalls wurden die Gesetze des Wahlkampfes wiederentdeckt und die Gegebenheiten der Werte- und Informationsgesellschaft angepaßt. Dies ??? mit Cleverness und dem unabdingbaren Maß an persönlicher Glaubwürdigkeit.
Selbstbewußte Kanzlerparteien und solche, die es werden wollen, machen nicht viele Worte. Man denke an Konrad Adenauers „Keine Experimente“ oder Willy Brandts „Mehr Demokratie wagen“. Wenn nicht gerade frisch aus dem Ei geschlüpft, brauchen sich Parteien dem Wähler doch nicht erst ausführlich vorzustellen. Er kennt sie und ihre Vorstellungen bereits - und manchmal schon zur Genüge. Sich länglich zu erklären heißt, sich zu verteidigen. Das mag für nötig halten, wer nicht erfüllte Erwartungen und (vielleicht unvermeidliche) Fehlschläge begründen muß. Wer die Kraft fühlt, das Land zu führen, muß diese Gewißheit vermitteln. Sie ist ansteckend.
Beschränkung auf die entscheidenden Punkte, auf klare Perspektiven und prägnante Lösungsworte ist, wie erfolgreiche Wahlkämpfer immer gewußt haben, keine Schwäche, sondern Stärke. Wie ungedeckte Wechsel zu meiden sind leichtfertige Versprechungen - der Wähler durchschaut allemal, wenn er verladen werden soll. Glaubwürdigkeit geht über alles - nicht nur die des Kandidaten, sondern auch die seiner Partei: die Gewißheit nämlich, daß sie seine Botschaft, mit der er wirbt, nicht nachträglich zurechtbiegt.
Die Personalisierung im Wahlkampf erreichte im Wahljahr 1998 sicherlich ihren Höhepunkt. Eine wirkliche, inhaltlich Entleerung gab und gibt es hingegen nicht. Noch immer hat der Wähler aber die Möglichkeit, sich über Vorstellungen und Ziele der einzelnen Parteien zu informieren. Die Informationspflicht hingegen wird durch die Parteien allerdings recht vernachlässigt, da die Vereinfachung politischer Formeln und die werbewirksame Personalisierung mehr Wählerstimmen als eine genaue Aufklärung über politische Inhalte verspricht.
[...]
1 Vgl. :Krahwinkel,M.: Werbung in den Neunzigern, Hamburg 1998.
2 Vgl.: Zit. nach: Informationen zur politischen Bildung, Nr. 4/98.
3 Ebenda, S.2.
4 Vgl.: Steinseifer-Pabst,A., Wolf, W.Dr.: Wahlen und Wahlkampf in der BRD, Heidelberg 1994.
5 Vgl.: Holz-Bacha,D.(Hrsg.): Wahlen und Wahlkampf in den Medien: Untersuchungen aus dem Wahljahr 1994, Opladen 1996.
6 Heribert Fassbinder: umstrittener Autor und Regiseur mit sozialkritischer Ader
7 Vgl.: „GQ“ (Monatsmagazin) Nr.: 2/99
8 Vgl.: „ Die Welt“ vom 4.6.1998
9 Vgl.: Augstein, R.: Sonderheft: Wahlen 1998,in: Der Spiegel 29.9.1998.
10 Vgl.: Bechtel, M.: Wahlen an der Jahrtausendwende, in: Informationen zur politischen Bildung, Nr. 4 1998.
11 Vgl.: Ebenda
12 Vgl.: Ebenda
13 Vgl.: Ebenda
14 Vgl.: zu Folgendem: Pressespiegel der Staatskanzlei-Magdeburg, Nr.4-9/98.
15 Vgl.: Steinseifer-Pabst,A., Wolf,W.Dr.: Wahlen und Wahlkampf in der BRD, Heidelberg 1994.
16 Vgl.: Ebenda
17 Vgl.: Guierer Mc,P.: Persuasife Kommunikation: Modelle zur Erklärung, die zwischen Kommunikation und Einstellung vermitteln, USA 1964.
18 Vgl.: Steinseifer-Pabst,A., Wolf,W.Dr.: Wahlen und Wahlkampf in der BRD, Heidelberg 1994.
19 Vgl.: Augstein,R.: Sonderheft: Wahlen 1998,in: Der Spiegel 29.9.1998.
20 Friedmann, M.( jüdischer Würdenträger und CDU-Politiker mit eigener Talkshow),in: „Vorsicht Friedmann“, ZDF 20.3.1998.
21 Vgl..Schieren,S.Dr.: Analyse des DVU-Wahlergebnisses, in:Breit,G.Prof.Dr., Forndran,E.Prof.Dr.,Schieren,S.Dr. (Hrsg.): Demokratie in Bedrängniss ?, Magdeburg 1998.
22 Ebenda
23 Ebenda
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Personalisierung im deutschen Wahlkampf, insbesondere im Bundestagswahlkampf 1998. Sie untersucht, wie die Bedeutung von Wahlkämpfen und Spitzenkandidaten zugenommen hat und welche Auswirkungen dies auf die politische Landschaft hat.
Welche Gliederung hat die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist wie folgt gegliedert: 1. Einleitung 2. Die steigende Bedeutung des Wahlkampfes entspricht der steigenden Bedeutung des Kandidaten 3. Falluntersuchung: SPD-Bundestagswahlkampf 98 - Gerhard Schröder * 3.1. Presseauswertung * 3.2. Bedeutung der Massenmedien für den Wahlkampf 4. Kurze Auswertung der Personalisierung anderer Parteien im Bundestagswahlkampf 98 5. Gegen den Trend - DVU-Wahlkampf in Sachsen-Anhalt 6. Fazit / Ursachen und Folgen der Personalisierung 7. Literaturverzeichnis
Was ist das Hauptargument der Hausarbeit?
Die Hausarbeit argumentiert, dass im bundesdeutschen Wahlkampf eine starke Personalisierung zu verzeichnen ist, die sich in einer Amerikanisierung und Intensivierung des deutschen Wahlkampfes erkennen lässt. Diese Entwicklung wird anhand des Wahlkampfes von Gerhard Schröder im Jahr 1998 illustriert.
Wie wird die Personalisierung am Beispiel Gerhard Schröders untersucht?
Die Hausarbeit analysiert den SPD-Bundestagswahlkampf 1998 anhand von Gerhard Schröders Imageaufbau, seiner Darstellung in den Medien und der Strategie, politische Inhalte eng an seine Person zu knüpfen. Eine Presseauswertung aus dieser Zeit soll dies verdeutlichen.
Welche Rolle spielen die Massenmedien im Wahlkampf?
Die Hausarbeit betont die zentrale Rolle der Massenmedien (TV, Radio, Printmedien, Internet) im Wahlkampf. Sie tragen maßgeblich zur Personalisierung bei, indem sie Auftritte, Reden und Interviews von Politikern landesweit verbreiten und kommentieren.
Gibt es auch Gegenbeispiele zur Personalisierung?
Ja, die Hausarbeit untersucht den DVU-Wahlkampf in Sachsen-Anhalt im Jahr 1998 als ein Beispiel, bei dem die Partei ohne erkennbare Personalisierung und Spitzenkandidaten erfolgreich war. Dies wird auf die gezielte Ansprache einer bestimmten Wählerschaft (junges, proletarisches und ausländerfeindliches Milieu) zurückgeführt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit kommt zu dem Schluss, dass Personalisierung und Vereinfachung zu Markenzeichen der Wahlzeit geworden sind. Obwohl politische Inhalte nach wie vor vorhanden sind, wird die Informationspflicht seitens der Parteien oft vernachlässigt, da eine werbewirksame Personalisierung mehr Wählerstimmen verspricht.
Welche Schwierigkeiten gab es bei der Erstellung dieser Hausarbeit?
Schwierigkeiten waren die fehlende Unterstützung der Landesverbände für Interviews, lange Wartezeiten auf Antworten der Bundesverbände, die eingeschränkte Verfügbarkeit von Fachzeitschriften in der Bibliothek und die fehlende Bereitschaft großer Zeitungen, Artikel aus der Wahlkampfzeit 1998 zur Verfügung zu stellen.
- Quote paper
- Andreas Kraaz (Author), 2000, Amerikanisierung des Bundesdeutschen Wahlkampfes am Beispiel Gerhard Schröders Wahl zum Bundeskanzler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95081