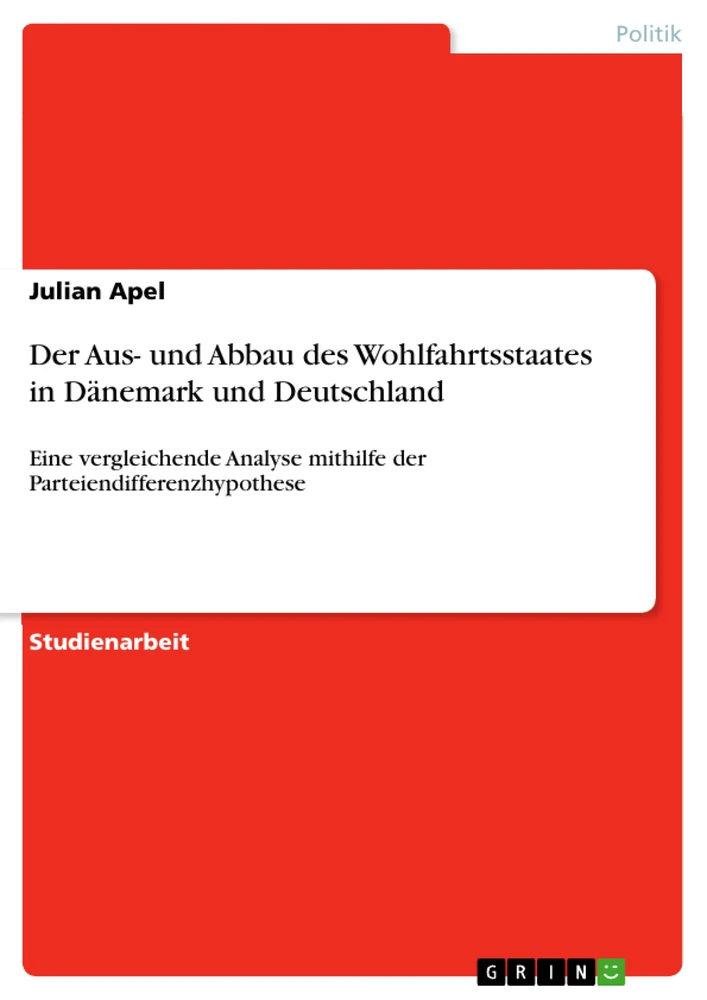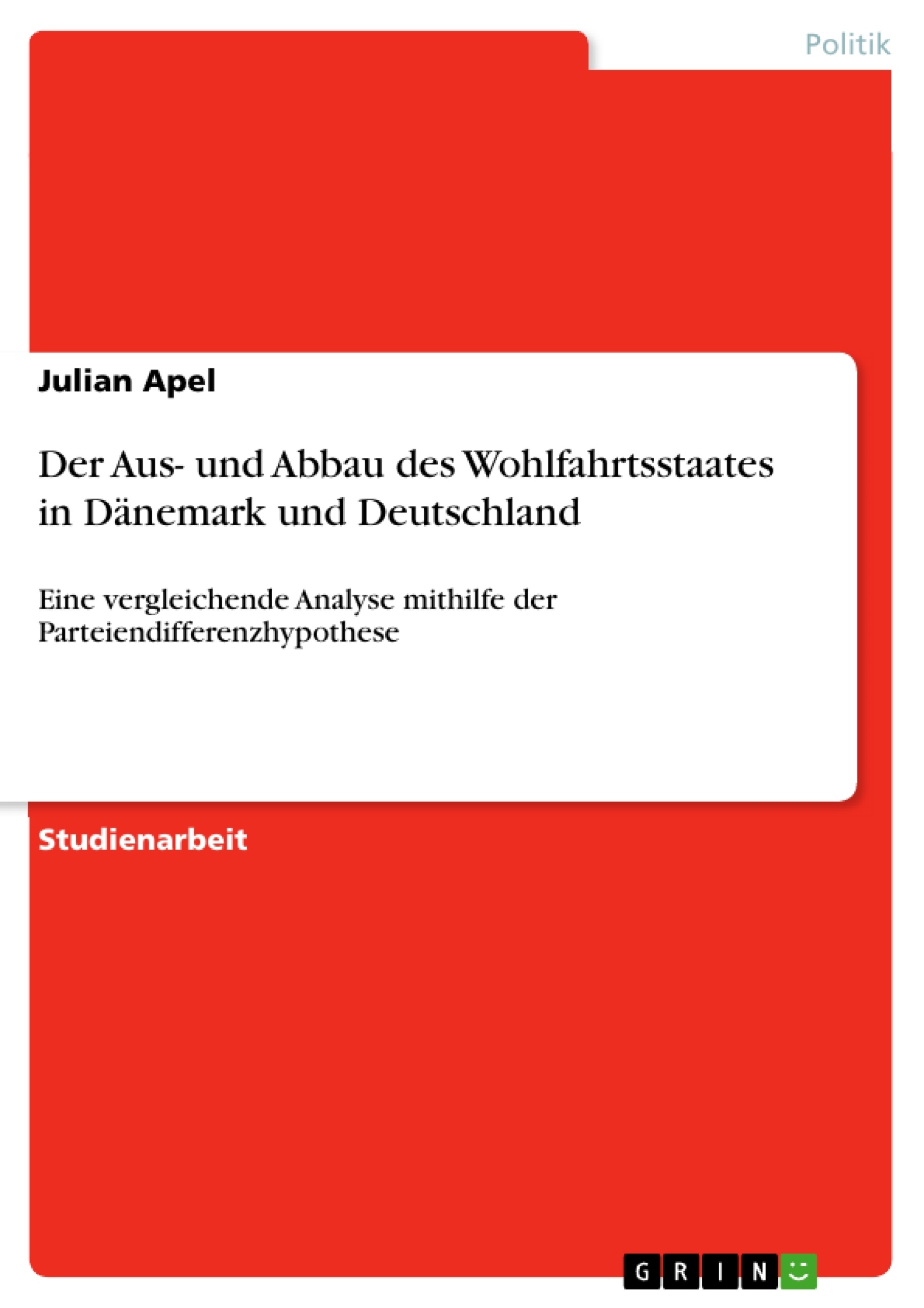Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht der Vergleich der Wohlfahrtsstaatlichkeit Dänemarks und Deutschlands. Dänemark zählt mit seinem sozialdemokratischen System zu einem Vorzeigemodell der Wohlfahrtsstaaten. Deutschland hingegen überzeugt zwar mit einem funktionierenden sozialpolitischen System, steht aber aufgrund einer teilweise großen Ungleichheit in der Bevölkerung deutlich öfter in der Kritik als Dänemark. Die unabhängige Variable ist in dieser Arbeit die Parteienlandschaft, die abhängige Variable ist das Ausmaß der Wohlfahrtsstaatlichkeit. Als theoretisches Instrumentarium wird der Ansatz der Parteiendifferenzen genutzt.
Die Wohlfahrtsstaatlichkeit ist in westlichen Ländern nicht mehr wegzudenken. Ob Schutz vor Arbeitslosigkeit, Rentensicherung oder Sozialhilfe in schwierigen Zeiten – wohlfahrtsstaatliche Fürsorgeprogramme sorgen für einen Hauch von Sicherheit in einer schnelllebigen Welt, die durch diverse exogene Schocks oder anderen „Focusing Events“ ständig im Wandel ist. Digitalisierung, Technisierung, Globalisierung - Faktoren, die dazu führen, dass Volkswirtschaften einem ständigen Kreislauf von Veränderung und Anpassung ausgesetzt sind.
Hierbei sorgen ständige Wandlungsverläufe in Strukturen dafür, dass auch die Gesellschaft ständigen Veränderungen ausgesetzt ist. Es herrscht Unsicherheit, ob die fortschreitende Modernisierung oder Automatisierung zu Jobverlusten führt oder ob die erworbenen Qualifikationen ausreichen, um sich auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft behaupten zu können. Eine ausgebaute Wohlfahrtsstaatlichkeit kann diesen Sorgen entgegenwirken und dient als Instrumentarium, die Gesellschaft vor ständiger Unsicherheit und Frustration zu schützen und eine gewisse Lebensqualität zu erhalten. Wohlfahrtsstaatlichkeit ist allerdings nicht gleich Wohlfahrtsstaatlichkeit, da unterschiedliche Volkswirtschaften unterschiedliche Mechanismen oder Strukturen aufweisen, die in unterschiedlichen Dimensionen staatliche Fürsorge bieten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Parteiendifferenzhypothese
- 3. Sozialpolitik Deutschland
- 4. Sozialpolitik Dänemark
- 5. Analyse
- 5.1 These 1
- 5.2 These 2
- 5.3 These 3
- 6. Fazit und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Aus- und Abbau des Wohlfahrtsstaates in Dänemark und Deutschland und analysiert, inwieweit die Parteienlandschaft in beiden Ländern Einfluss auf die Ausgestaltung der Sozialpolitik hat. Die Analyse bezieht sich dabei auf die Parteiendifferenzhypothese, die besagt, dass die ideologische Ausrichtung der Regierungsparteien den Policy-Output beeinflusst.
- Vergleich der Wohlfahrtsstaaten Dänemark und Deutschland
- Analyse der Parteiendifferenzhypothese im Kontext der Sozialpolitik
- Untersuchung des Einflusses der Parteienlandschaft auf den Wohlfahrtsstaat
- Bedeutung der sozialdemokratischen Ideologie für die Gestaltung der Sozialpolitik
- Analyse des Ausmaßes des Wohlfahrtsstaates und des Rückbaus von Sozialleistungen in beiden Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Wohlfahrtsstaatlichkeit ein und stellt die beiden untersuchten Länder, Dänemark und Deutschland, in Bezug auf ihre unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Systeme vor.
- Kapitel 2: Die Parteiendifferenzhypothese
Dieses Kapitel stellt die Parteiendifferenzhypothese vor und erläutert verschiedene Ansätze und Vertreter der Theorie. Die Hypothese besagt, dass die ideologische Ausrichtung von Regierungsparteien einen entscheidenden Einfluss auf den Policy-Output hat.
- Kapitel 3: Sozialpolitik Deutschland
Dieses Kapitel beschreibt das deutsche Sozialsystem und erläutert die wichtigsten sozialpolitischen Elemente. Es beleuchtet die Bedeutung von konservativen Politikansätzen und die Kritikpunkte, die mit dem deutschen Wohlfahrtsstaat verbunden sind.
- Kapitel 4: Sozialpolitik Dänemark
Dieses Kapitel befasst sich mit dem dänischen Sozialsystem und präsentiert es als ein sozialdemokratisches Vorzeigemodell. Es verdeutlicht die Besonderheiten des dänischen Wohlfahrtsstaates und betont dessen stark sozial ausgerichtete Politik.
- Kapitel 5: Analyse
Das Kapitel beinhaltet die Analyse von drei Hypothesen, die den Zusammenhang zwischen Parteienlandschaften und Wohlfahrtsstaatlichkeit untersuchen. Die erste These bezieht sich auf die Typologie von Wohlfahrtsstaaten und ihre Beziehung zur Parteienlandschaft. Die zweite These behandelt den Einfluss sozialdemokratischer Ideologie auf die Gleichheit bzw. Ungleichheit im Wohlfahrtsstaat. Die dritte These untersucht den Rückbau des Wohlfahrtsstaates anhand von Sozialleistungsquoten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich des Aus- und Abbaus des Wohlfahrtsstaates in Dänemark und Deutschland und analysiert die Parteiendifferenzhypothese als theoretisches Instrumentarium. Wichtige Schlüsselwörter sind: Wohlfahrtsstaatlichkeit, Sozialpolitik, Parteiendifferenzhypothese, Sozialdemokratie, Konservatismus, Ungleichheit, Sozialleistungsquote, Dänemark, Deutschland, Esping-Andersens „The Three Worlds of Welfare Capitalism“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen dem dänischen und deutschen Wohlfahrtsstaat?
Dänemark folgt dem sozialdemokratischen Modell mit hoher Gleichheit, während Deutschland als konservativer Wohlfahrtsstaat gilt, der stärker auf Beitragsleistung und Statusserhalt basiert.
Was besagt die Parteiendifferenzhypothese?
Sie besagt, dass die ideologische Ausrichtung der Regierungsparteien (z. B. links vs. rechts) einen direkten Einfluss auf die Gestaltung und Großzügigkeit der Sozialpolitik hat.
Wie beeinflusst die Digitalisierung den Wohlfahrtsstaat?
Strukturwandel durch Automatisierung erzeugt Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt, was den Druck auf staatliche Sicherungssysteme erhöht, die Bürger vor Jobverlusten zu schützen.
Was ist die Sozialleistungsquote?
Sie misst den Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt und dient als Indikator für das Ausmaß der staatlichen Fürsorge.
Gibt es einen Rückbau des Wohlfahrtsstaates?
Die Arbeit untersucht, inwieweit beide Länder trotz ihrer Traditionen Sparmaßnahmen und Reformen (Retrenchment) im Sozialbereich durchgeführt haben.
- Quote paper
- Julian Apel (Author), 2018, Der Aus- und Abbau des Wohlfahrtsstaates in Dänemark und Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950815