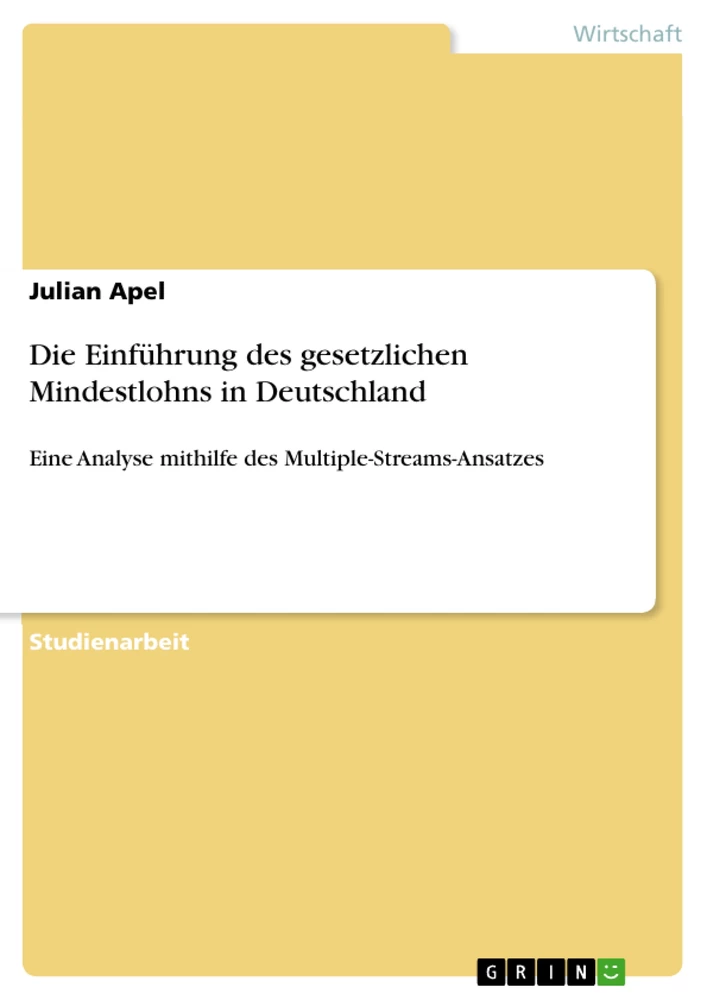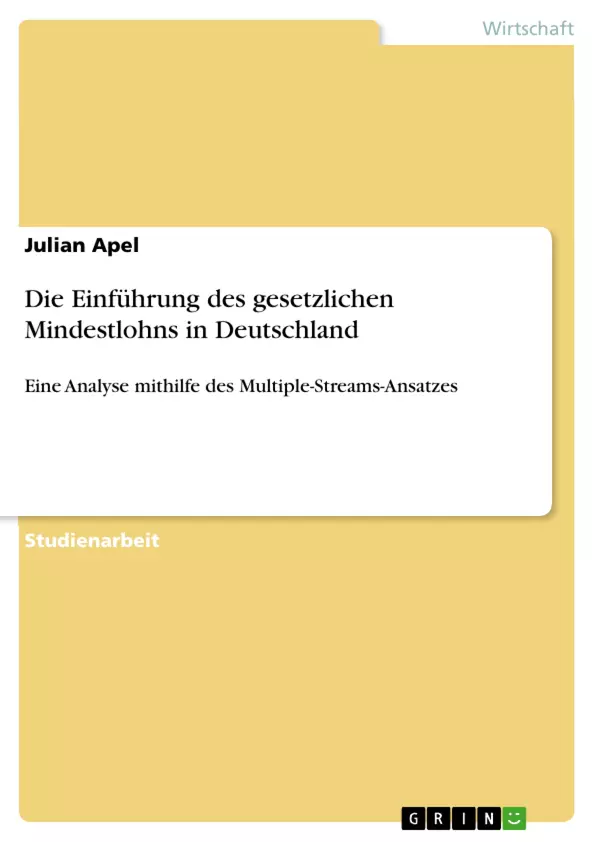In dieser Arbeit soll mithilfe des Multiple-Streams-Ansatzes (MSA) von John W. Kingdon die gesamte Hängepartie der Mindestlohnreform in Deutschland erklärt werden. Hierbei wird geklärt, warum sich die ganze Reform über so viele Jahre hingezogen hat. Des Weiteren erörtert der Autor, wie die Argumentierung gegen und für den Mindestlohn aufgebaut war und wer die Policy-Unternehmer waren, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass der Mindestlohn doch in eine machbare Reform umgemünzt wurde.
Wie kam es dazu, dass der Mindestlohn trotz der anfangs ablehnenden Haltung seitens der CDU doch durchgewunken wurde, und welche Rolle spielt die SPD dabei? Welche Faktoren und Einflüsse haben die Mindestlohndebatte verlangsamt oder befeuert und welche Faktoren führten zu einer Agenda Platzierung des Mindestlohns. Hierbei wird der Blick auch explizit auf spezielle Interessengruppen und Policy-Maker gelegt, die den ganzen Prozess verlangsamt oder gehemmt haben. Der MSA wird genutzt, um nach einem gewissen Rahmen vorzugehen und so den Prozess aufzuschlüsseln. Die verschiedenen Ströme werden separat abgehandelt und betrachtet, um am Ende ein Gesamtfazit zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Multiple Streams Ansatz
- 2.1 Problem-Strom
- 2.2 Policy-Strom
- 2.3 Politics-Strom
- 2.4 Policy-Unternehmer
- 3. Analyse MSA
- 3.1 Problem-Strom
- 3.2 Policy-Strom
- 3.3 Politics-Strom
- 4. Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland unter Verwendung des Multiple-Streams-Ansatzes von John W. Kingdon. Ziel ist es, die lange Hängepartie der Mindestlohnreform zu erklären, die Argumentation für und gegen den Mindestlohn zu beleuchten und die Rolle der Policy-Unternehmer aufzuzeigen, die den Mindestlohn schließlich in eine realisierbare Reform umwandelten.
- Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland
- Anwendung des Multiple-Streams-Ansatzes
- Analyse der Problem-, Policy- und Politics-Ströme
- Identifikation von Policy-Unternehmern und Interessengruppen
- Bedeutung des Mindestlohns für die Arbeitsbedingungen und das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Thematik und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 erläutert den Multiple-Streams-Ansatz von John W. Kingdon und beschreibt die drei Ströme: Problem-, Policy- und Politics-Strom. Außerdem wird die Rolle von Policy-Unternehmern im Prozess der Agendasettung hervorgehoben. Kapitel 3 analysiert die Einführung des Mindestlohns in Deutschland mithilfe des Multiple-Streams-Ansatzes. Hierbei werden die einzelnen Ströme im Kontext der Mindestlohndebatte untersucht.
Schlüsselwörter
Multiple-Streams-Ansatz, Mindestlohn, Politikfeldanalyse, Problemstrom, Policystrom, Politicsstrom, Policy-Unternehmer, Agendasettung, Reformveränderung, Interessengruppen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Warum dauerte die Einführung des Mindestlohns in Deutschland so lange?
Die Arbeit nutzt den Multiple-Streams-Ansatz, um zu erklären, wie politische Widerstände, Interessengruppen und die ursprüngliche Ablehnung der CDU den Reformprozess über Jahre verzögerten.
Was ist der Multiple-Streams-Ansatz (MSA) nach Kingdon?
Der MSA ist ein Modell der Politikfeldanalyse, das davon ausgeht, dass eine Reform dann zustande kommt, wenn drei „Ströme“ (Probleme, Lösungen und politische Stimmung) in einem „Window of Opportunity“ zusammenfinden.
Wer sind „Policy-Unternehmer“ in diesem Kontext?
Policy-Unternehmer sind Akteure, die aktiv daran arbeiten, ihre bevorzugten Lösungen (hier den Mindestlohn) auf die politische Agenda zu setzen und Mehrheiten dafür zu organisieren.
Welche Rolle spielte die SPD bei der Mindestlohnreform?
Die SPD fungierte als treibende Kraft, die das Thema Mindestlohn zur Bedingung für Koalitionsverhandlungen machte und so den Widerstand der CDU schließlich brach.
Was versteht man unter dem „Politics-Strom“?
Der Politics-Strom umfasst Faktoren wie die öffentliche Meinung, Wahlergebnisse und Machtverhältnisse im Parlament, die den Rahmen für politische Entscheidungen bilden.
- Quote paper
- Julian Apel (Author), 2019, Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950820