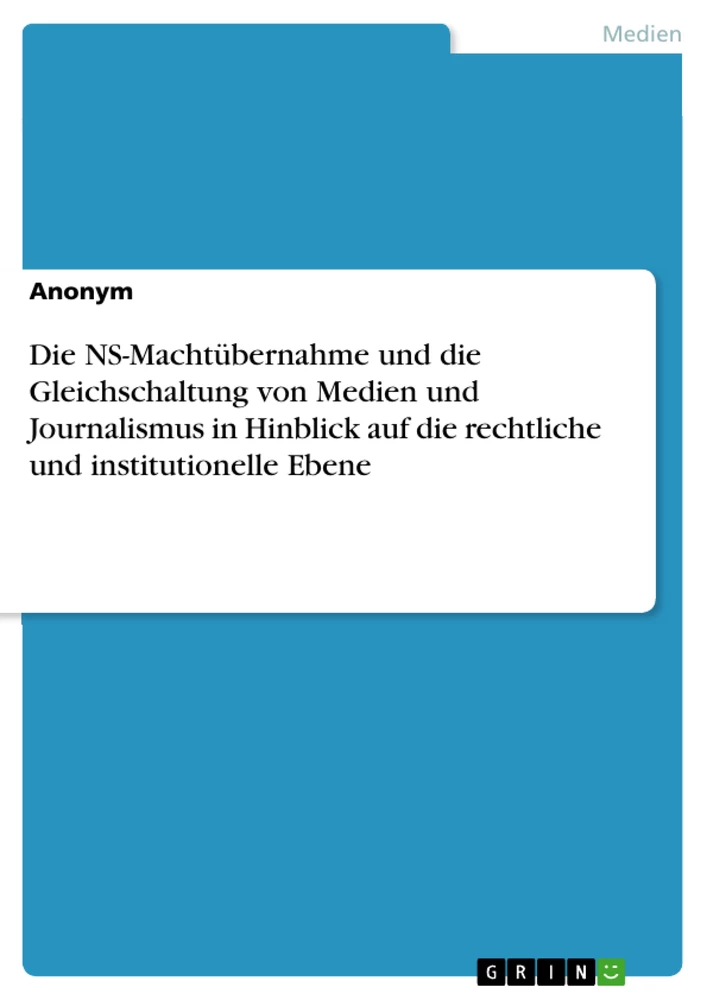Die vorliegende Arbeit soll den Prozess der Gleichschaltung der Presse im Nationalsozialismus beschreiben und sich vor allem der Frage widmen, wie dieser systematisch vonstattenging, sowie nachvollziehen, aus welchen Gründen die Gleichschaltung für Hitler und die Nationalsozialisten so essentiell zur Machtgewinnung war.
Unmittelbar nach ihrer Machtübernahme begann die Führung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) mit der Ausschaltung jener Organisationen, die sich ihrem Totalitätsanspruch zu widersetzen drohten. Eine Anpassung aller staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen an die politisch-ideologischen Ziele der NSDAP sollte die pluralistische Vielfalt der Weimarer Republik ersetzen. Bei der Übernahme des Staats, der Justiz und der Gesellschaft, sowie bei der Etablierung ihres Herrschaftssystems bedienten sich die Nationalsozialisten vor allem der Gleichschaltung. Die erzwungene und freiwillige Anpassung ermöglichte der Partei eine nahezu vollständige Kontrolle aller gesellschaftlichen Bereiche. Gleichgeschaltet waren neben Vereinen und Organisationen auch Presse, Film und Rundfunk, die als Mittel zur Beeinflussung und Propaganda eingesetzt wurden.
Die Nationalsozialisten sahen es als Aufgabe der Presse an, im Sinne ihrer weltanschaulichen Linie zu wirken. Joseph Goebbels, der am 13.03.1933 zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ernannt wurde, entschied im Endeffekt, was veröffentlicht werden durfte und was nicht. Als einer der mächtigsten Drahtzieher des Nazi-Regimes steuerte und kontrollierte er den Prozess der Gleichschaltung, mittels seines eigens errichteten Reichsministerium. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten zog die deutsche Presselandschaft sehr in Mitleidenschaft, was sich unter anderem in der sinkenden Anzahl der Tageszeitungen in Deutschland zeigt: Im Jahr 1932 hat es in Deutschland 4703 Tageszeitungen gegeben, wo-hingegen es im Jahr 1934 durch die Maßnahmen des NS-Regimes nur noch 3097 und im Jahr 1935 sogar nur noch 2527 Zeitungen gab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematische Abgrenzung
- Die Geschichte der Presse und der Aufbau eines totalitären Staates
- Die Gleichschaltung auf der rechtlichen und institutionellen Ebene
- Die Gleichschaltung auf der rechtlichen Ebene
- Die Gleichschaltung auf der institutionellen Ebene und das Schriftleitergesetz
- Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Prozess der Gleichschaltung von Medien und Journalismus in der NS-Zeit, insbesondere mit der rechtlichen und institutionellen Ebene. Ziel ist es, die systematische Vorgehensweise der Nationalsozialisten bei der Kontrolle der Presse zu beschreiben und die Bedeutung dieser Maßnahmen für die Machtgewinnung Hitlers zu beleuchten.
- Die Entwicklung der Presselandschaft in Deutschland vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis zur NS-Zeit
- Die Rolle des Staats im Bereich der Pressefreiheit und die Einschränkungen der Pressefreiheit im Laufe der Geschichte
- Die rechtlichen und institutionellen Maßnahmen der Nationalsozialisten zur Gleichschaltung der Presse
- Die Bedeutung des Schriftleitergesetzes und die Rolle des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda
- Die Auswirkungen der Gleichschaltung auf die Anzahl und den Inhalt von Zeitungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Zielsetzung. Sie verdeutlicht, dass die Nationalsozialisten nach der Machtübernahme die Kontrolle über alle gesellschaftlichen Bereiche erlangten, insbesondere über Medien wie Presse, Film und Rundfunk, um Propaganda zu betreiben.
- Thematische Abgrenzung: Dieses Kapitel legt den Fokus der Arbeit fest, die sich auf die Gleichschaltung der Presse durch die Nationalsozialisten konzentriert. Es wird erläutert, dass die Arbeit sich auf die rechtliche und institutionelle Ebene der Gleichschaltung konzentriert und andere Bereiche wie die wirtschaftliche und inhaltliche Ebene aufgrund des begrenzten Umfangs ausklammert.
- Die Geschichte der Presse und der Aufbau eines totalitären Staates: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung der deutschen Presselandschaft von der Kaiserzeit bis zur Weimarer Republik nach und beleuchtet die Rolle des Staates in Bezug auf die Pressefreiheit. Es zeigt, wie die Pressefreiheit trotz liberaler Tendenzen durch staatliche Kontrollen und Unterdrückungsmaßnahmen eingeschränkt war.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen der Gleichschaltung, Pressefreiheit, Propaganda, Nationalsozialismus, Rechtliche und Institutionelle Ebene, Schriftleitergesetz, Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Machtübernahme, Weimarer Republik, Kaiserzeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Gleichschaltung“ im Nationalsozialismus?
Es beschreibt die erzwungene Anpassung aller gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen an die Ideologie der NSDAP, um die pluralistische Vielfalt zu beseitigen.
Welche Rolle spielte Joseph Goebbels bei der Pressekontrolle?
Als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda steuerte er den Prozess der Gleichschaltung und entschied, welche Inhalte veröffentlicht werden durften.
Was war das Schriftleitergesetz?
Dieses Gesetz machte den Journalistenberuf zu einer staatlich kontrollierten Aufgabe und zwang Redakteure, im Sinne der NS-Weltanschauung zu arbeiten.
Wie veränderte sich die Anzahl der Zeitungen nach 1933?
Die Zahl der Tageszeitungen sank drastisch: Von 4703 im Jahr 1932 auf nur noch 2527 im Jahr 1935 aufgrund der repressiven Maßnahmen des Regimes.
Warum war die Gleichschaltung der Medien für Hitler so wichtig?
Die vollständige Kontrolle über Presse, Film und Rundfunk war essenziell für die Verbreitung von Propaganda und die Sicherung der totalitären Macht.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Die NS-Machtübernahme und die Gleichschaltung von Medien und Journalismus in Hinblick auf die rechtliche und institutionelle Ebene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950866