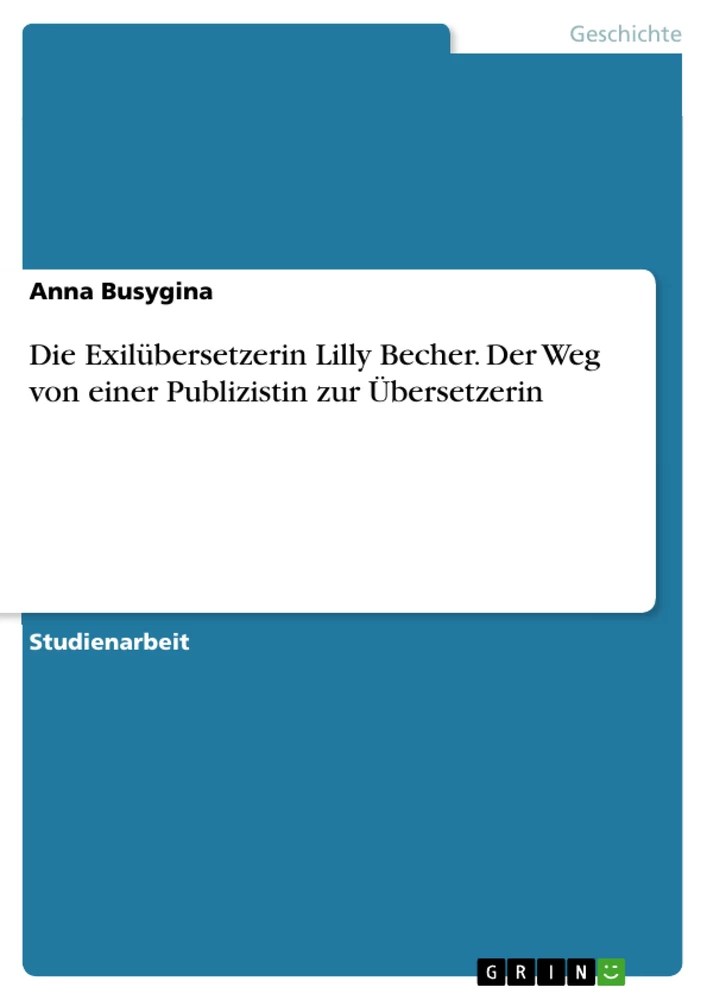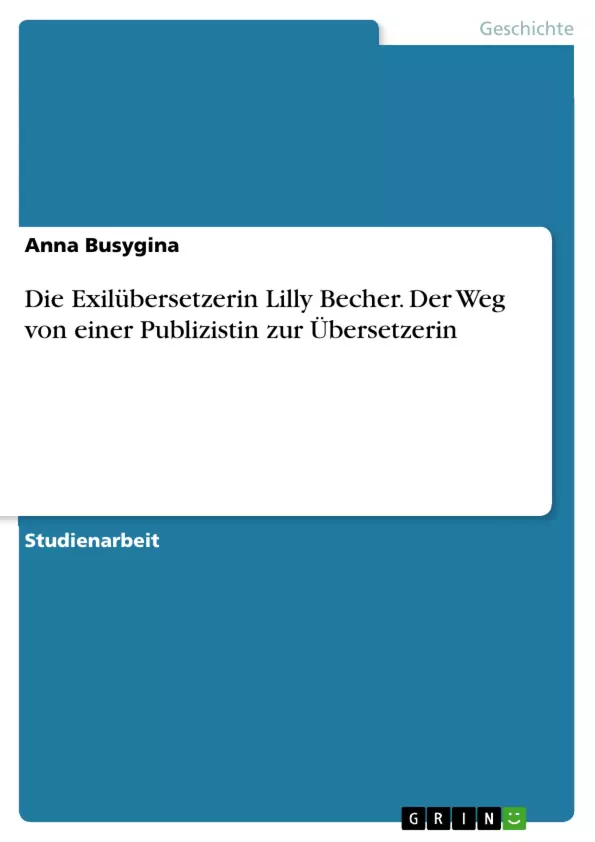Bücherverbrennungen, Zensur, Verfolgung. Das war die tatsächliche Realität der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Viele Personen mit dem bekannten Namen mussten damals ihr Zuhause verlassen, um sich wieder Meinungsfreiheit zu erschaffen. Darunter auch Lilly Becher, Ehefrau von Johannes Becher, dem berühmten Schriftsteller. Sie war Parteifunktionärin und im russischen Exil war sie als Übersetzerin tätig. Allerdings sind unter ihrem echten Namen kaum Arbeiten von ihr zu finden. In dieser Arbeit werden die zu Lilly Becher gefundenen Daten aus den Exil-Archiven zusammengefasst und dem Leser dargelegt. Dabei wird ihr Weg zur Sprachenmittlerin untersucht sowie eines ihrer bekannten Werke über das Konzentrationslager in Treblinka unter die Lupe genommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Recherchebericht
- 3 Vita
- 4 Lilly Becher - Bibliographie
- 4.1 Übersetzungen
- 4.2 Originalbeiträge in Zeitschriften und Zeitungen
- 4.3 Originalwerke in Buchform
- 4.4 Herausgeberschaften
- 4.5 Beteiligungen an anderen Publikationen
- 4.6 Veröffentlichte Briefe
- 5 Der Weg von Publizistin zur Übersetzerin
- 5.1 In Berührung mit Sprachen
- 5.2 Die Hölle von Treblinka
- 5.3 Verschleierung der Identität
- 5.4 Pseudonyme und ihre Verwendung
- 6 Schluss
- 7 Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Geschichte von Lilly Becher, einer Exilübersetzerin, und untersucht ihre Arbeit im Kontext der Judenverfolgung im Nationalsozialismus.
- Der Weg von Lilly Becher von der Publizistin zur Übersetzerin im Exil.
- Die Herausforderungen, denen sie als Übersetzerin im Exil begegnete, insbesondere im Hinblick auf Sprachverlust, Spracherwerb, Sprachwechsel und Mehrsprachigkeit.
- Die Bedeutung ihrer Übersetzungen und ihre Rolle in der Bewältigung der NS-Vergangenheit.
- Die Verwendung von Pseudonymen und die Frage der Identität im Exil.
- Die Schwierigkeiten der Recherche zu Exilübersetzern und die Problematik der Glaubwürdigkeit von Internetressourcen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und führt den Leser mit dem Holocaust-Mahnmal in Berlin in die Geschichte der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden ein. Sie stellt die Buchreihe „Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945“ und den ersten Band von Wolf Gruner vor.
- Kapitel 2: Recherchebericht: Das Kapitel beschreibt die Methoden der Recherche zu Lilly Becher und die Quellen, die für die Erstellung der Arbeit verwendet wurden.
- Kapitel 3: Vita: Dieses Kapitel präsentiert die Biographie von Lilly Becher, basierend auf Informationen aus dem Frankfurter Exilarchiv.
- Kapitel 4: Lilly Becher - Bibliographie: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Übersicht über Lilly Bechers bibliographische Werke, unterteilt in Übersetzungen, Originalbeiträge, Originalwerke, Herausgeberschaften, Beteiligungen an anderen Publikationen und veröffentlichte Briefe.
- Kapitel 5: Der Weg von Publizistin zur Übersetzerin: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Phasen von Lilly Bechers Leben, insbesondere ihre Begegnung mit Sprachen, ihre Erfahrungen in der Hölle von Treblinka und die Verschleierung ihrer Identität durch die Verwendung von Pseudonymen.
Schlüsselwörter
Exilübersetzerin, Lilly Becher, Judenverfolgung, Nationalsozialismus, Sprachverlust, Spracherwerb, Sprachwechsel, Mehrsprachigkeit, Pseudonyme, Identität, Frankfurter Exilarchiv, Recherchebericht, Biographie, Übersetzungen, Bibliographie, Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Lilly Becher?
Lilly Becher war eine deutsche Publizistin und Parteifunktionärin, die im sowjetischen Exil als Übersetzerin arbeitete.
Warum arbeitete sie unter Pseudonymen?
Aufgrund der politischen Verfolgung und der Exilsituation war die Verschleierung der Identität oft notwendig, um publizieren zu können.
Welches bekannte Werk übersetzte Lilly Becher?
Die Arbeit untersucht unter anderem ihre Übersetzung eines Werkes über das Konzentrationslager Treblinka ("Die Hölle von Treblinka").
Welchen Herausforderungen begegneten Exilübersetzer?
Thematisiert werden Sprachverlust, der erzwungene Sprachwechsel und die schwierigen Arbeitsbedingungen in der Emigration.
Woher stammen die Informationen für diese Arbeit?
Die Daten wurden primär aus den Beständen des Frankfurter Exilarchivs recherchiert.
- Arbeit zitieren
- Anna Busygina (Autor:in), 2020, Die Exilübersetzerin Lilly Becher. Der Weg von einer Publizistin zur Übersetzerin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/951088