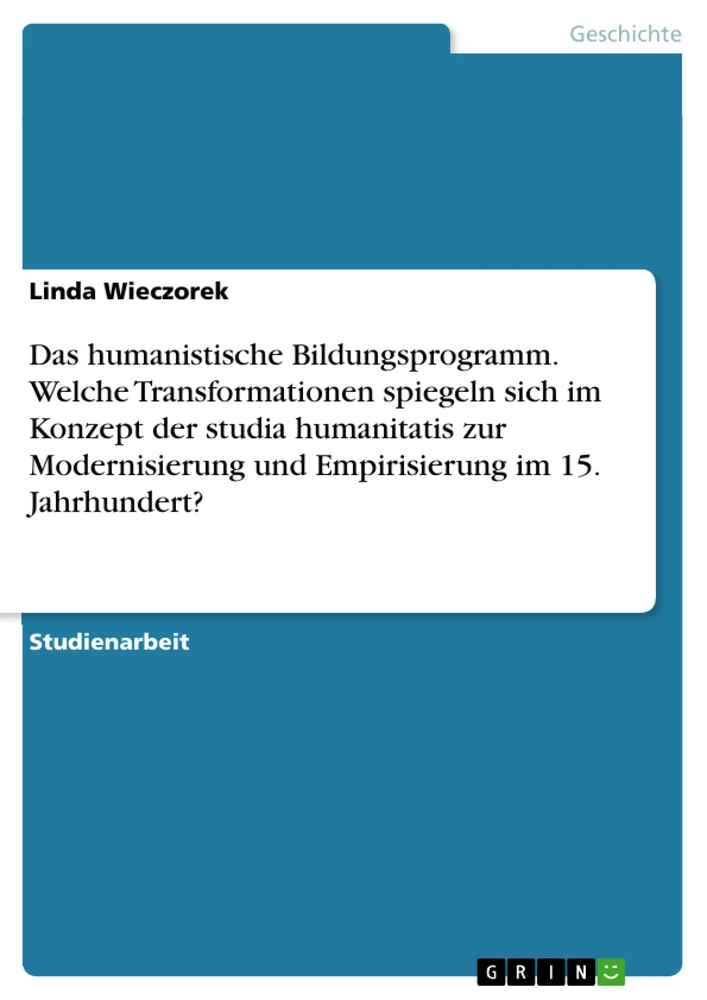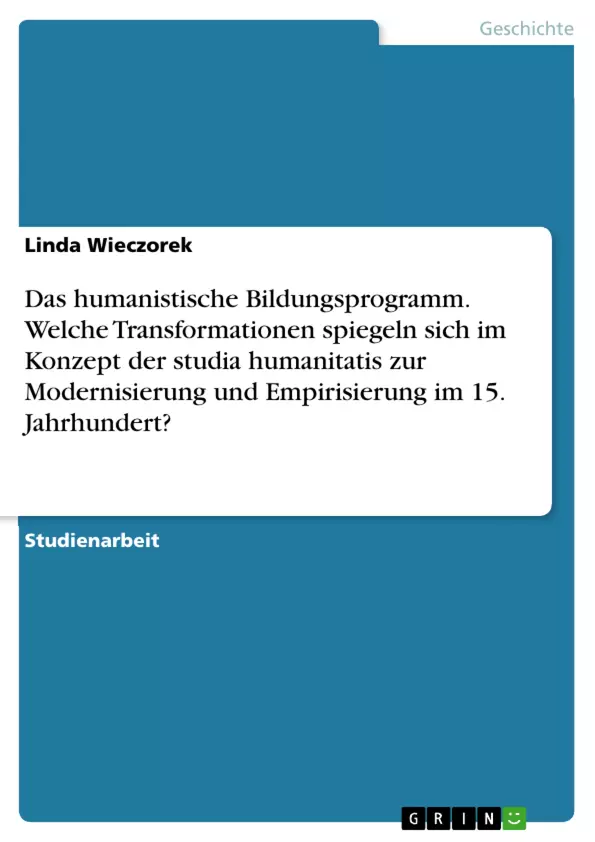Welche Transformationen spiegeln sich im renaissance-humanistischen Konzept der studia humanitatis zur Modernisierung und Empirisierung von Welt und Mensch im 15. Jahrhundert? Nach einer Einführung in die Thematik werden zunächst die Anfänge des Humanismus anhand der historischen Einordnung und zentraler Begriffe skizziert, wobei den Aspekten der Erziehung und dem Bildungsverständnis besondere Aufmerksamkeit zukommt. Das darauffolgende Kapitel widmet sich den studia humanitatis. Hier werden zunächst die Rahmenbedingungen und die Bedeutung der Bildung für das Individuum beschreiben. Das humanistische Studienprogramm wird mittels des Fächerkanons beleuchtet, wobei die lateinische Sprache den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet. Das anschließende vierte Kapitel thematisiert die Auswirkungen der studia humanitatis auf die Modernisierung und die Empirisierung von Welt und Mensch im 15. Jahrhundert. Inwiefern hat sich das Realitätsverständnis im Renaissance-Humanismus verändert? Was bewirken die einzelnen Disziplinen und welche Ansprüche haben die Menschen an die Wissenschaft? Die Antworten auf diese Fragen sowie die Kernaussagen der Arbeit werden im letzten Abschnitt zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Renaissance-humanistische Bildung
- Anfänge des Humanismus
- Erziehungs- und Bildungsverständnis
- Humanistisches Studienprogramm
- Die studia humanitatis
- Latein: Die Sprache des Humanismus
- Transformationsprozesse und Auswirkungen der studia humanitatis
- Empirisierung
- Modernisierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Transformationen, die sich im renaissance-humanistischen Konzept der studia humanitatis im 15. Jahrhundert vollzogen haben. Sie beleuchtet, wie diese im Kontext der Modernisierung und Empirisierung von Welt und Mensch zum Tragen kamen.
- Anfänge des Humanismus und seine historischen Wurzeln
- Das Erziehungs- und Bildungsverständnis der Renaissance
- Die Bedeutung der studia humanitatis für die individuelle Bildung
- Die Auswirkungen der studia humanitatis auf die Modernisierung und Empirisierung
- Die Rolle der lateinischen Sprache im humanistischen Studienprogramm
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die Anfänge des Humanismus sowie die zentralen Begriffe und historischen Hintergründe. Es wird besonderer Wert auf die Aspekte der Erziehung und des Bildungsverständnisses gelegt. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem humanistischen Studienprogramm, den Rahmenbedingungen der Bildung und der Bedeutung für das Individuum. Der Fokus liegt auf der lateinischen Sprache als zentralem Element des humanistischen Fächerkanons. Das dritte Kapitel analysiert die Auswirkungen der studia humanitatis auf die Modernisierung und Empirisierung von Welt und Mensch im 15. Jahrhundert. Hier wird untersucht, inwieweit sich das Realitätsverständnis im Renaissance-Humanismus verändert hat und welche Ansprüche die Menschen an die Wissenschaft stellen.
Schlüsselwörter
Studia humanitatis, Renaissance, Humanismus, Bildung, Erziehung, Modernisierung, Empirisierung, Latein, Antike, Cicero, Petrarca, Transformationsprozesse, Weltverständnis, Wissenschaftsverständnis
- Citation du texte
- Linda Wieczorek (Auteur), 2019, Das humanistische Bildungsprogramm. Welche Transformationen spiegeln sich im Konzept der studia humanitatis zur Modernisierung und Empirisierung im 15. Jahrhundert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/951155