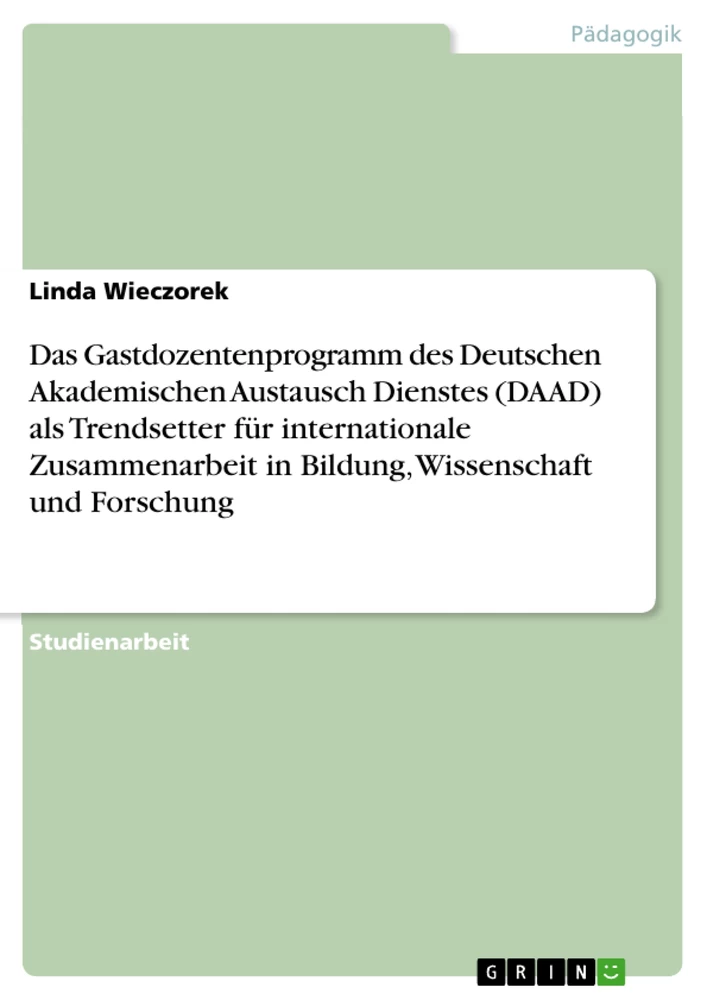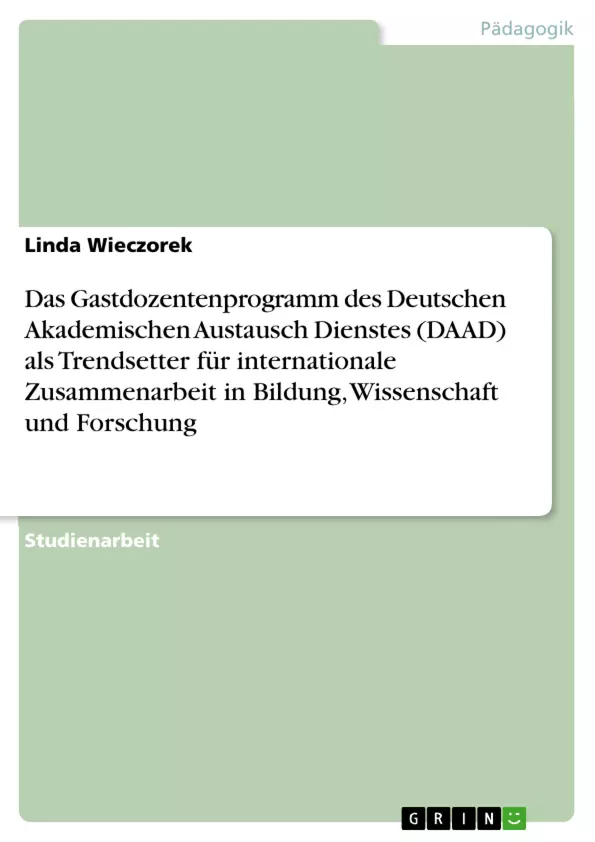Die vorliegende Ausarbeitung basiert auf dem Seminar „Theoretische, historische und international-vergleichende Zugänge zur Erwachsenenbildung/Weiterbildung“ und thematisiert die wissenschaftliche Fragestellung „Inwiefern wirkt sich das Gastdozentenprogramm des DAAD auf persönliche und berufliche Weiterbildung sowie auf institutioneller und bildungspolitischer Ebene aus?“
Nach einer Einführung in die Thematik wird zunächst die Entstehung und Entwicklung des ERASMUS Programms von den ersten Entwürfen im Jahr 1986 bis zum heutigen Dachprogramm, ERASMUS+ vorgestellt und hinsichtlich der Ziele sowie der zentralen Bedeutung für die europäische Bildungslandschaft beschrieben. Der Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) ist der Verwaltungsapparat des ERASMUS/ERASMUS+ Programms und wird hinsichtlich seines Aufgabenfeldes, der Leitidee sowie der engen Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung im darauffolgenden Kapitel skizziert. Das Gastdozentenprogramm ist ein Konzept der Nationalen Agentur des DAAD, welches als Förderprogramm für Hochschulpersonal fungiert. Im Folgenden wird die Dozentenmobilität anhand der Teilnahmebedingungen und -formate, der Dauer und Finanzierung sowie der übergeordneten Ziele des Förderprogramms charakterisiert. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung, die berufliche Weiterbildung sowie die institutionellen und bildungspolitischen Veränderungen bilden den Schwerpunkt dieser Ausarbeitung. Die Antwort auf die Fragestellung sowie die Kernaussagen der vorliegenden Seminararbeit werden im letzten Abschnitt zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Gastdozentenprogramm des DAAD
- Einleitung
- Austauschprogramm für europäische Studierende: ERASMUS/ ERASMUS+
- Entstehung und Entwicklung
- ERASMUS+
- DAAD
- Gastdozentenprogramm
- Die Auswirkungen der Dozentenmobilität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung analysiert das Gastdozentenprogramm des DAAD im Kontext der europäischen Bildungslandschaft. Ziel ist es, die Auswirkungen dieses Programms auf die persönliche und berufliche Weiterbildung sowie auf institutioneller und bildungspolitischer Ebene zu untersuchen.
- Entwicklung und Bedeutung des ERASMUS/ERASMUS+ Programms
- Rolle des DAAD als Verwaltungsapparat und Förderer von Dozentenmobilität
- Charakteristika des Gastdozentenprogramms, inklusive Teilnahmebedingungen, Formate und Finanzierung
- Auswirkungen der Dozentenmobilität auf die persönliche und berufliche Weiterbildung
- Institutionelle und bildungspolitische Veränderungen im Kontext des Gastdozentenprogramms
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Gastdozentenprogramm des DAAD als Instrument zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Forschung vor und skizziert die Ziele des Programms sowie die Relevanz des Themas im Kontext der europäischen Hochschulpolitik.
- Austauschprogramm für europäische Studierende: ERASMUS/ERASMUS+: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des ERASMUS-Programms, beschreibt die Ziele des Programmes und stellt die wichtigsten Neuerungen des ERASMUS+ Programms vor. Darüber hinaus wird der DAAD als Verwaltungsapparat des Programms vorgestellt.
- Gastdozentenprogramm: Dieses Kapitel widmet sich dem Gastdozentenprogramm des DAAD, beschreibt die Teilnahmebedingungen und -formate, die Finanzierung des Programms und die übergeordneten Ziele des Förderprogramms.
Schlüsselwörter
ERASMUS/ERASMUS+, Gastdozentenprogramm, DAAD, Dozentenmobilität, internationale Zusammenarbeit, Hochschulbildung, Weiterbildung, Bildungspolitik, Europäische Union, Forschung, Lehre.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Gastdozentenprogramm des DAAD?
Es ist ein Förderprogramm, das Hochschulpersonal ermöglicht, an europäischen Partnerhochschulen zu lehren und sich international zu vernetzen.
Was ist der Unterschied zwischen ERASMUS und ERASMUS+?
ERASMUS+ ist das aktuelle Dachprogramm der EU, das neben dem klassischen Studierendenaustausch auch die Mobilität von Lehrpersonal und Kooperationen im Sport umfasst.
Welche Vorteile bietet die Dozentenmobilität?
Sie fördert die persönliche Weiterbildung, den Austausch von Lehrmethoden und stärkt die internationale Profilbildung der Heimathochschule.
Wer verwaltet die ERASMUS-Mittel in Deutschland?
Der Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) fungiert als Nationale Agentur für die Verwaltung und Vergabe dieser Mittel.
Wie lange dauert eine Gastdozentur in der Regel?
Die Dauer variiert je nach Programmformat, liegt aber meist zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen im Rahmen der Dozentenmobilität.
- Citation du texte
- Linda Wieczorek (Auteur), 2020, Das Gastdozentenprogramm des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD) als Trendsetter für internationale Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/951160