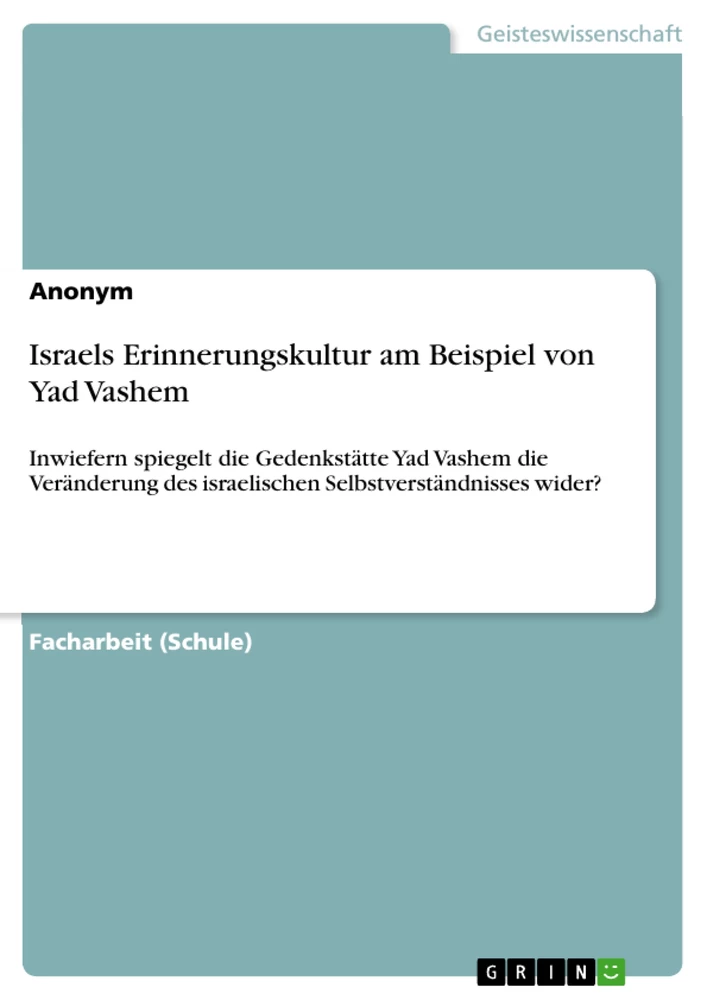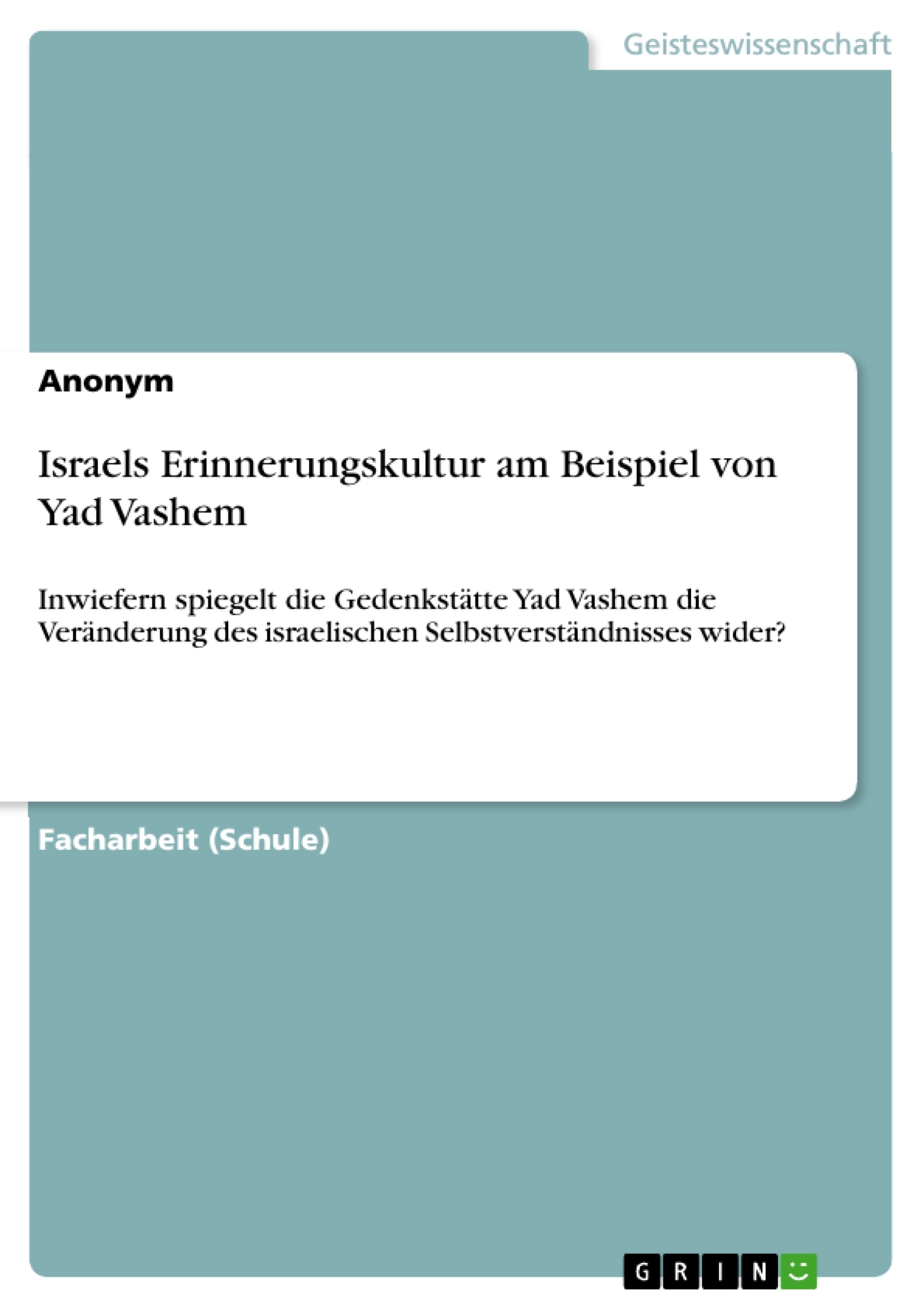1 Einleitung
1.1 Die Signifikanz des Themas
Die Beschäftigung mit der Erinnerung an den Holocaust ist von großer Bedeu-tung, da nur so verhindert werden kann, dass ein erneuter Völkermord in Zukunft stattfindet. Die wichtige Frage ist jedoch wie erinnert werden soll, denn die Zu-gänge der Geschichte verändern sich mit jeder Generation und jedem Zeitabstand zu den historischen Ereignissen und aus diesem Grund muss sich auch die Ver-mittlung beständig modernisieren. Die Erinnerung hat eine enorme Mahnkraft und prägt zudem auch aktuelles politisches Handeln. Ein Zitat des ehemaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier trifft diese Signifikanz sehr gut:
„In einer Welt, die uns unsicher, ruhelos und ungeordnet vorkommen mag, ist die Geschichte Lehre, Mahnung und Ansporn zugleich. […] Das Erinnern hat kein Ende und darf es auch nicht haben.“
Nach Steinmeier solle man die Geschichte nutzen, um aus ihr zu lernen, und an den Holocaust auf ewig erinnern, denn das Vergessen ist in unserer heutigen, „ru-helos[en]“ Welt eine große Gefahr.
1.2 Die Erläuterung der Fragestellung
Das Ziel dieser Arbeit ist, herauszuarbeiten, inwieweit Israels verändertes Selbst-verständnis das offizielle Gedenken an die Shoah beeinflusst. Dazu wird als Bei-spiel die Gedenkstätte Yad Vashem herangezogen, da diese die nationale Erinne-rung vertreten soll. Daraus erschließt sich die Fragestellung:
"Inwiefern spiegelt die Gedenkstätte Yad Vashem die Veränderung des israelischen Selbstverständnisses wider?"
Sie ist eine Erweiterung der Frage, wie in Yad Vashem erinnert wird, und ergänzt diese um den Bezug zu geschichtlichen Aspekten in Israel und der Entwicklung in der Gedenkstätte.
1.3 Die Vorgehensweise
Aus diesem Grund wird als erstes auf die Veränderung des Selbstverständnisses in Israel nach dessen Staatsgründung durch prägnante, historische Ereignisse ein-gegangen. Darauffolgend wird chronologisch die Entwicklung der Gedenkstätte Yad Vashem beschrieben und diese mit dem gewandelten Selbstverständnis Isra-els verknüpft. Dies endet mit einer ausführlichen Betrachtung der heutigen Ge-denkstätte in Bezugnahme des Gedenkens an die Opfer in Architektur und Auf-bau des neuen Museumskomplexes, sowie der gewählten Maßnahmen zum Tod der Zeitzeugen und zur Darstellung der Täter. Im abschließenden Fazit erfolgt die Beantwortung der Leitfrage durch Zusammentragen und Bewertung der wichtigs-ten, gewonnenen Erkenntnisse und ein kritischer Blick auf die methodische Durchführung der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Signifikanz des Themas
- Die Erläuterung der Fragestellung
- Die Vorgehensweise
- Das israelische Selbstverständnis im Wandel der Zeit
- Die Gründung der Gedenkstätte Yad Vashem
- Die Weiterentwicklung der Gedenkstätte
- Die Entwicklung bis zum Eichmannprozess
- Die Entwicklung nach dem Eichmannprozess
- Die Entwicklung nach dem Jom-Kippur-Krieg
- Am Beispiel des Warschauer Ghetto-Platzes
- Am Beispiel der Kindergedenkstätte
- Der neue Museumskomplex
- Die Architektur
- Die Maßnahmen zum Tod der Zeitzeugen
- Das Gedenken an die Opfer
- Die Darstellung der Täter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie sich Israels veränderter Selbstverständnis auf das offizielle Gedenken an die Shoah auswirkt. Sie analysiert die Gedenkstätte Yad Vashem als repräsentatives Beispiel für die nationale Erinnerungskultur.
- Die Entwicklung des israelischen Selbstverständnisses nach der Staatsgründung
- Der Einfluss des Eichmannprozesses auf das Shoahgedenken in Israel
- Die Rolle des Jom-Kippur-Krieges für die Verlagerung des Fokus von heroischem Widerstand zum Opfergedenken
- Die architektonische und inhaltliche Gestaltung des neuen Museumskomplexes von Yad Vashem
- Die Auseinandersetzung mit den Täterperspektiven im Kontext der Erinnerungskultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung des Themas Holocaustgedenken und die Relevanz einer zeitgemäßen Vermittlung. Die Arbeit untersucht die Frage, inwiefern die Gedenkstätte Yad Vashem die Veränderung des israelischen Selbstverständnisses widerspiegelt. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung des israelischen Selbstverständnisses seit der Staatsgründung, wobei die Verdrängung der Shoah-Erinnerung in den ersten Jahren und die Bedeutung des Eichmannprozesses für die Hinwendung zum Opfergedenken hervorgehoben werden. Das dritte Kapitel beschreibt die Gründung von Yad Vashem und seine Anfänge. Das vierte Kapitel widmet sich der Weiterentwicklung der Gedenkstätte, wobei die Veränderungen bis zum Eichmannprozess, nach dem Eichmannprozess und nach dem Jom-Kippur-Krieg beleuchtet werden. Das fünfte Kapitel analysiert den neuen Museumskomplex von Yad Vashem und geht auf die Architektur, die Maßnahmen zum Tod der Zeitzeugen, das Gedenken an die Opfer und die Darstellung der Täter ein. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und beantwortet die Leitfrage.
Schlüsselwörter
Holocaustgedenken, Yad Vashem, Israel, Erinnerungskultur, Selbstverständnis, Shoah, Eichmannprozess, Jom-Kippur-Krieg, Opfergedenken, Täterdarstellung, Museumskomplex, Architektur, Zeitzeugen, Nationales Gedenken.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Israels Erinnerungskultur am Beispiel von Yad Vashem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/951191