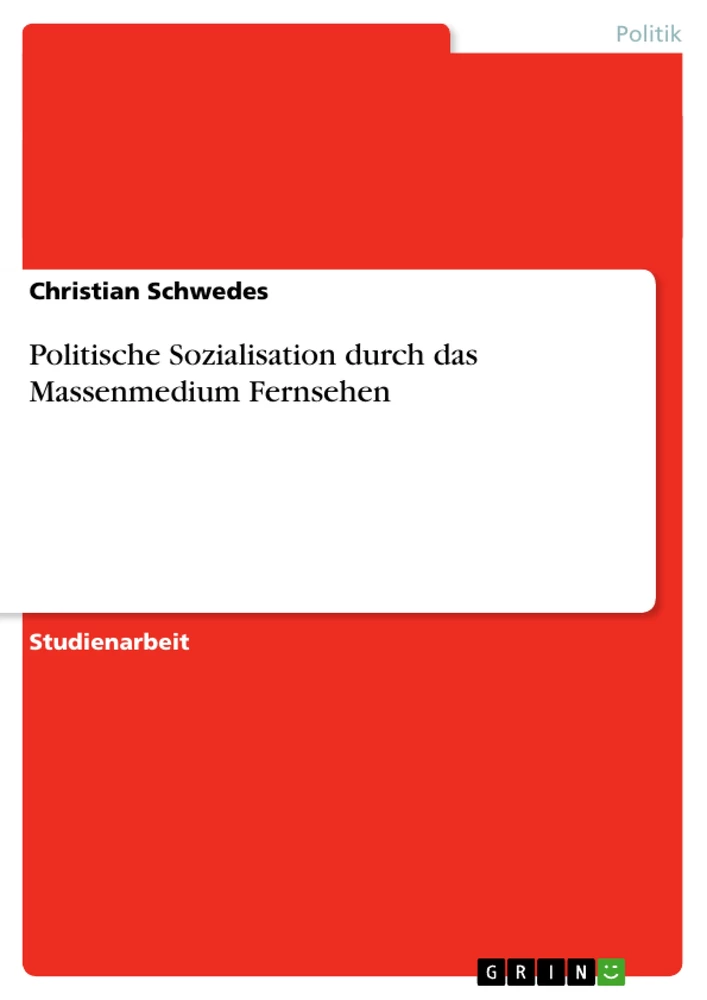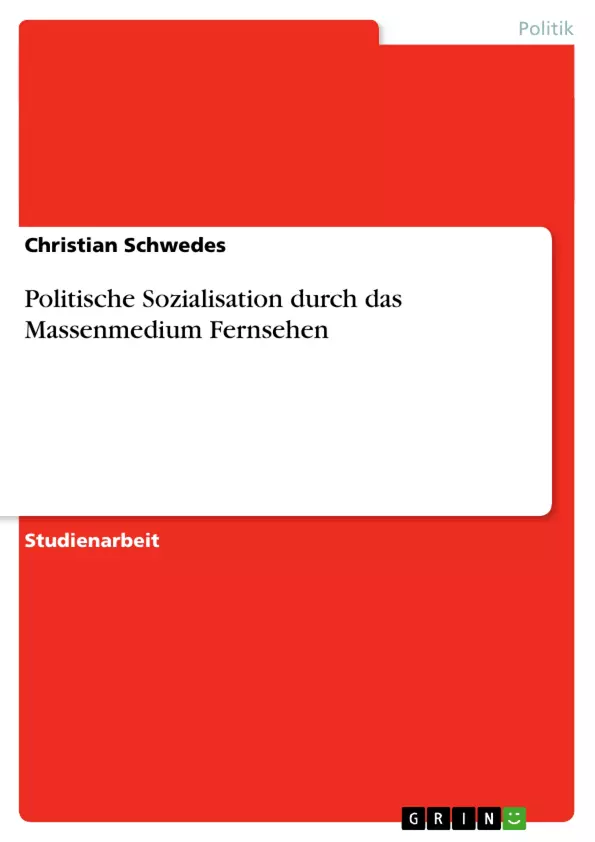Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Die rechtlichen Grundlagen des Fernsehens
2.2 Die Zulassung der Privatsender
2.3 Die Grundlagen der politischen Sozialisation
2.4 Die Funktionen des Fernsehens
2.4.1 Aufklärung
2.4.2 Manipulation
2.4.3. Unbeabsichtigte Effekte
2.5 Wirkungsweisen des Fernsehens
3. Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis
1 Baake, Dieter: Partizipation und Massenmedien, in: Hans Jürgen Kagelmann / Gerd Wenninger (Hrsg.), Medienpsychologie, Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen, München 1982
2 Bullinger, Martin: Medienrecht in: Staatslexikon, Bd. 3, Freiburg i. Br. 1995
3 Geißler, Rainer: Massenmedien, Basiskommunikation und Demokratie, Tübingen 1973
4 IfD: Auswirkungen des Fernsehens, Allensbach 1970
5 Kevenhörster, Paul: Politikwissenschaft, Bd. 1: Entscheidungen und Strukturen der Politik, Opladen 1997
6 Pöttker, Horst: Politische Sozialisation durch Massenmedien: Aufklärung, Manipulation und ungewollte Einflüsse, in: Bernhard Claußen / Rainer Geißler (Hrsg.), Die Politisierung des Menschen, Instanzen der politischen Sozialisation, Ein Handbuch, Opladen 1996
7 Roegele, Otto B.: Medienpolitik, in: Staatslexikon, Bd. 3, Freiburg i. Br. 1995
8 Rousseau, Jean- Jacques : „Discours sur les Sciences et les Arts“, in: ders., Du Contrat Social, Classiques Garnier, Paris o.J.
9 Schäuble, Wolfgang: Und sie bewegt sich doch, Gengenbach/Bonn 1998
10 Schulz, Werner: Die Konstruktion von Realität in den Nachrichten- Medien, Freiburg i. Br. 1976
1. Einleitung
Bei der seit Jahren geführten Diskussion um Politikverdrossenheit und ihre Ursachen, gerät das Augenmerk zwangsläufig auf die Entstehung der politischen Einstellungen. Der Wandel von der sozioökonomischen Struktur einer Industrie- zu der einer Informationsgesellschaft, bedingt eine immer größer werdende Bedeutung der gesellschaftlichen Kommunikatoren. Deshalb spielen im Prozess der politischen Sozialisation, neben den klassischen Sozialisationsagenturen, Familie und Schule die Massenmedien eine zunehmende Rolle. Da das Fernsehen einen hohen Grad der Erreichbarkeit durch seine Rezipienten aufweist soll im folgenden untersucht werden, welcher Stellenwert dem Fernsehen als Bindeglied in der Gesellschaft, speziell der bundesdeutschen zukommt, und inwieweit es gesellschaftsrelevante Sozialisationseffekte erzielt.
Im Einzelnen wird kurz auf die rechtlichen Grundlagen der privatfinanzierten audiovisuellen Medien sowie der, des öffentlich- rechtlichen Fernsehens eingegangen. Auch das Thema der Medienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland kann, aufgrund der Kürze dieser Arbeit, nur kurz angerissen werden. Ebenso sollen die Grundlagen der politischen Sozialisation nur sehr periphere Erklärungen finden. Der Schwerpunkt liegt auf den aufklärenden, manipulativen und nicht intendierten Funktionen des Massenmediums Fernsehen. Dessen Auswirkungen, auf die latenten und bewussten Einstellungen zu politischen Institutionen und Parteien, Organisationen und einzelnen gesellschaftlichen Gruppen und deren Funktionalität, sollen vertiefend betrachtet werden. Mögliche Folgen, für die Legitimität des politischen Systems und den Grad der politischen Partizipation, werden aufgezeigt.
2. Hauptteil
2.1 Rechtliche Grundlagen des Fernsehens
„Medien tragen entscheidend dazu bei, dass politische, kulturelle und andere Auffassungen verbreitet und empfangen werden können. Die Freiheit, Meinungen zu verbreiten und sich zu informieren, ist innerstaatlich durch Artikel fünf des Grundgesetzes und europaweit ( Art. 10 EMRK ) gewährleistet.“1 Durch die von den alliierten Siegermächten verfügte Neuordnung des Rundfunks in Deutschland, zwischen 1954 und `48, wurde das organisatorische und inhaltliche Gestaltungsrecht den Ländern zugesprochen. Es etablierte sich ein System von „öffentlich- rechtlichen Anstalten“2, die möglichst staatsfern betrieben und durch Rundfunk- und Verwaltungsräte kontrolliert werden sollten. Diese Aufsichtsorgane, gerieten mit den ihnen unterliegenden Funkhäusern mit der Zeit immer stärker in den Einflussbereich der Parteien. So kann der Rundfunk, im Gegensatz zur Weimarer Republik, heute als „staatsfern und parteinah“3 bezeichnet werden.
2.2 Die Zulassung der Privatsender
In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, vom 28. 2. 1961, wurde das Oligopol der öffentlich- rechtlichen Anstalten, mit Hinweis auf die Frequenzknappheit, als mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Da dieses Argument durch die technischen Möglichkeiten von Kabel- und Satellitenübertragung immer mehr an Bedeutung verlor, wurde die Zulassung privatfinanzierter Sender möglich. Ob die sogenannten Neuen Medien mehr Segen oder mehr Gefahr mit sich bringen, ist auch in wissenschaftlichen Debatten zum Gegenstand geworden. „Von kulturpessimistischen und ideologisch vorgeprägten Einstellungen[...]abgesehen, lebt diese Debatte von der Tatsache, dass die Entscheidungssituation am Beginn einer neuen Epoche der Mediengeschichte als solche erkannt ist und als Herausforderung verstanden wird.“4
2.3 Grundlagen der politischen Sozialisation
Die politische Sozialisation indes, ist als Phase der Vermittlung politisch bedeutsamer Wertvorstellungen und Einstellungen zum politischen System zu sehen. Sie lässt sich nach Auffassung Kevenhörsters „in zwei Phasen aufteilen: die primäre Sozialisation, [in der] Enkulturation [und] Soziabilisierung [stattfinden] und das Individuum dadurch auf gesellschaftliche Rollen einstimmt und die sekundäre Sozialisation“5, die es mit seinen Aufgaben vertraut macht. Als Agenturen der politischen Sozialisation sind Familie, Schule, peer groups, Arbeits- und Nachbarschaftsgruppen, Parteien, aber auch die Medien zu sehen. Durch einen kommunikativen Vermittlungsprozess, zwischen den Generationen und den sozialen Schichten und Gruppen, stabilisieren sie die Gesellschaft.
2.4 Die Funktionen des Fernsehens
2.4.1 Aufklärung
Das Medium Fernsehen, übernimmt dabei unter anderem gesellschaftlich erwünschte Aufgaben. Es vermittelt Informationen und Sachwissen und macht es in einer weit „ausdifferenzierten Gesellschaft [möglich,] fehlende unmittelbare Erfahrung zu ersetzen“6, die ganz wesentlich zur politischen Handlungskompetenz der Bürger beiträgt. Hinzu kommt die Aufgabe, die Folgen staatlichen Handelns auf Lebensbereiche der Individuen verständlich und anschaulich zu vermitteln. So wird die Politisierung und die daraus resultierende Partizipationsbereitschaft der Bürger gefördert. Ein dritter, legitimer Sozialisationseffekt erzielt eine „grundsätzlich skeptische Einstellung der Rezipienten gegenüber staatlicher Macht“7 und deren Inhabern. Er wird durch die kritische Haltung der Medien und durch ihre Kontrollfunktion gegenüber dem Staat ausgelöst.
2.4.2 Manipulation
Da das Fernsehen ebenfalls ein Unterhaltungsmedium darstellt und die gesendete Botschaft auch einen optimalen Gewinn, durch hohen Verbreitungsgrad d. h. Einschaltquoten erbringen soll, wird versucht, so Pöttker, das Informationsbedürfnis zu wecken ohne es zu befriedigen. Demnach, beschränkt sich die Auswirkung der Massenmedien auf die politische Sozialisation, auf „oberflächliches Detailwissen“8, geringe politische Anteilnahme sowie Beteiligung und eine Beschränkung auf die „Privat- und Konsumsphäre“9. Nicht die kritische Haltung zu staatlichem Handeln sondern die „Identifikation mit prominenten Politikern“9, wird nach dieser Sichtweise gefördert. Die legitime Aufgabenerfüllung des Fernsehens durch objektive Information, wird in Form von zunehmendem Unterhaltungsjournalismus als gefährdet angesehen.10
2.4.3 Unbeabsichtigte Effekte
Neben dieser manipulativen Funktion ergibt sich aus der Tatsache, dass Medienkonsumenten nicht nur reagieren sondern auch agieren eine weitere, unbeabsichtigte Wirkung des Fernsehens. Mit der Zulassung privater Fernsehsender, ist die Glaubwürdigkeit des Fernsehens laut Umfragen, zwischen 1964 und 1990, stark zurückgegangen. In einem von „Konkurrenz zwischen privaten und öffentlich- rechtlichen Anbietern [geprägten Rundfunksystem schwindet der Eindruck des] offiziösen Charakters“11 beim Fernsehen. Doch auch die Lenkung von ARD, ZDF und ihren Schwesterprogrammen, durch den Proporz der politischen Parteien in den Rundfunkräten, „dürfte [...] zur Politikverdrossenheit beigetragen haben, [...]“12.
2.5 Wirkungsweisen des Fernsehens
Das Gewicht des Mediums Fernsehen als Kommunikator und Bindeglied zwischen Gesellschaft und Staat, wird zweifellos deutlich. Seine Wirkungsweisen und die Chancen, die sich daraus für die politische Sozialisation und die Legitimität der einzelnen Komponenten des politischen Systems ergeben, müssen aber genauer untersucht werden. In Bezug auf die Funktionalität des politischen Systems, ist folgendes zu bemerken: Die staatlichen Institutionen sind in der Frage der Legitimation, ebenso wie ihre Vertreter, ganz wesentlich auf die massenkommunikativen Elemente des Fernsehens angewiesen. Einerseits kontrollieren die Medien staatliches Handeln, andererseits „macht das Nachrichtenprinzip der zuspitzenden Verkürzung das Verständnis[...] für die Komplexität von Sachverhalten[...] nicht größer.“13 Da aber die politische Sozialisation „oft mehr durch den Kontext der Kommunikation als durch ihren Inhalt geprägt wird“14, entsteht durch die Selektion und „Thematisierung politischer Fragen eine eigene Medienrealität“15 die Teile der authentischen Wirklichkeit ersetzt. Komplizierte Entscheidungsverfahren sind für die Masse nicht mehr durchschaubar. Das „Wissen um einige Ereignisse und Persönlichkeiten ist jedoch nicht gleichbedeutend mit wirklicher politischer Bildung und Einsicht in die Komplexität der Probleme.“16 So hinterlässt das Fernsehen bei Zuschauern ein völlig simplifiziertes Bild der politischen Praxis. Es entsteht der Eindruck, als sei Politik eine „unterhaltsame Sache [ein] leichtes Geschäft“17, die Sinnzusammenhänge bleiben unklar. Es kommt zur Beschränkung der Politik auf ihren medienwirksamen Symbolgehalt.
3. Schlussbemerkung
Die politische Sozialisation verliert vor allem in ihrer Sekundärphase an Nachhaltigkeit, was mit zur Legitimitätskrise der Institutionen und Politiker beiträgt. Sind die Parteien zwar heute strukturell gefestigt, so haben ihre „Kommunikationsprobleme im Umgang mit Medien und Wählerschaft“18 weiter zugenommen. Der mit alledem verbundene Qualitätsverlust bei der Vermittlung von Politik, hat generell Rückwirkungen auf die Qualität von Politik. Denn, wenn die erste Frage nicht mehr lautet, ob ein Gesetz, ob eine bestimmte Reform notwendig ist, sondern ob sie vermittelbar ist, liegt darin schon eine Teilkapitulation, vor den Mechanismen der modernen Medienkommunikation. Politik, die auf Zustimmung der demokratischen Öffentlichkeit angewiesen ist, steht deshalb vor dem Dilemma sich entweder den Beschleunigungstendenzen in der Berichterstattung anzupassen, was zwangsläufig zu Lasten der politischen Inhalte gehen muss, oder mannhaft dagegen zu halten, was notabene öffentliche Zustimmung kostet. Jedoch erst die massenhafte und unmittelbare Verbreitung politischer Informationen und Meinungen, ermöglicht letztendlich die Entstehung einer Öffentlichkeit, also die Artikulation des „volonté générale“19, die allein das Volk zu einem zur Volksherrschaft fähigen Subjekt, zu einem demos werden lässt. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Information welche das Fernsehen bereitstellt, den Rezipienten nicht ungehindert erreichen. „Welche Wirkung wann erzielt wird, bestimmt viel mehr[...] die soziale Gruppe sowie der Meinungsführer der als kompetent für bestimmte Meinungen angesehen wird[...]“.20
„Übergreifende Vermittlungsagenturen“21 wie das Fernsehen, schwächen den Einfluss von Einzelgruppen auf den Sozialisationsprozess ab. „Sie verstärken eher vorhandene Einstellungen oder tragen zu ihrer Konstanz bei, als dass sie Meinungen abschwächen oder sogar umkehren.[...] Trendumschwünge gehen nie von einer gesellschaftlichen Instanz aus; sie können von den Medien allein nicht veranlasst werden.“22. Dass die breit angelegte Tiefenwirkung des Fernsehens, sich angesichts des wirtschaftlichen Drucks, eher noch weiter abschwächen dürfte ist vorherzusehen. Auch die Eigenschaften des audiovisuellen Unterhaltungsmediums an sich, und die scheinbare Steigerung durch die stärkerwerdende Infotainmentkultur, werden kaum zu einer Wertsteigerung des Fernsehens für die politische Sozialisation, führen. Neu aufkommende Informationstechiken wie das Internet, oder das TV on demand, bringen zwar Selektions- und Informationsvorteile für das einzelne Individuum. Positive Sozialisationseffekte werden aber durch die übergroße Masse der Information verhindert werden.
[...]
1 Bullinger, Martin: Medienrecht, in: Staatslexikon, Bd 3, Freiburg i. Br. 1995, S. 1066
2 Roegele, Otto B.: Medienpolitik, in: siehe Fußnote1, S. 1062
3 Roegele, Otto B.: a.a.O. S. 1062
4 Roegele, Otto B.: Neue Medien in: siehe Fußnote1, S. 1065
5 Kevenhörster, Paul: Politikwissenschaft. Bd.1: Entscheidungen und Strukturen der Politik. Opladen 1997 S. 109
6 Pöttker, Horst: Politische Sozialisation durch Massenmedien: Aufklärung, Manipulation und ungewollte Einflüsse, in: Bernhard Claußen / Rainer Geißler (Hrsg.) Die Politisierung des Menschen, Instanzen der politischen Sozialisation, Ein Handbuch, Opladen 1996 S. 150
7 Pöttker, Horst, a.a.O. S. 151
8 Pöttker, Horst, a.a.O. S. 153
9 A.a.O. S.153
9 A.a.O. S. 153
10 Vgl. A.a.O. S. 155
11 A.a.O. S. 155
12 A.a.O. S. 155
13 Schäuble, Wolfgang: Und sie bewegt sich doch, Gengenbach/Bonn, 1998 S. 8
14 Kevenhörster, Paul, a.a.O. S 78
15 Schulz, Werner: Die Konstruktion von Realität in den Nachrichten- Medien, Freiburg i. Br. 1976 S. 206
16 Geißler, Rainer: Massenmedien, Basiskommunikation und Demokratie, Tübingen 1973 S. 194
17 IfD: Auswirkungen des Fernsehens, Allensbach 1970 S. 56, 62 f.
18 Kevenhörster, Paul, a.a.O. S. 81
19 Rousseau, Jean- Jacques : Du Contrat Social, Classiques Garnier, Paris o. J., I 7, II I.
20 Baake, Dieter: Partizipation und Massenmedien, in: Hans Jürgen Kagelmann / Gerd Wenninger (Hrsg.) Medienpsychologie, Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen, München 1982 S. 139
21 Kevenhörster, Paul, a.a.O. S. 92
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei enthält einen umfassenden Überblick über die Rolle des Fernsehens im Kontext der politischen Sozialisation. Sie umfasst ein Inhaltsverzeichnis, ein Literaturverzeichnis, eine Einleitung, einen Hauptteil und eine Schlussbemerkung. Der Hauptteil gliedert sich in die rechtlichen Grundlagen des Fernsehens, die Zulassung der Privatsender, die Grundlagen der politischen Sozialisation sowie die Funktionen des Fernsehens, wobei Aufklärung, Manipulation und unbeabsichtigte Effekte thematisiert werden. Abschließend werden die Wirkungsweisen des Fernsehens betrachtet.
Welche Themen werden im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil behandelt detailliert die rechtlichen Rahmenbedingungen des Fernsehens in Deutschland, insbesondere die Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern. Es werden die Grundlagen der politischen Sozialisation erläutert und die Rolle des Fernsehens als Sozialisationsagentur analysiert. Ein Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Funktionen des Fernsehens, darunter die Aufklärung, mögliche Manipulationen und unbeabsichtigte Effekte auf die politische Meinungsbildung. Abschließend wird die Wirkungsweise des Fernsehens auf die Legitimität politischer Institutionen und die politische Partizipation untersucht.
Was sind die rechtlichen Grundlagen des Fernsehens, die in dem Text behandelt werden?
Der Text behandelt die Entwicklung des Rundfunksystems in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch die alliierten Siegermächte initiiert wurde. Dabei wird auf die Etablierung von öffentlich-rechtlichen Anstalten eingegangen, die staatsfern betrieben und durch Rundfunk- und Verwaltungsräte kontrolliert werden sollten. Auch die zunehmende Nähe dieser Gremien zu politischen Parteien wird thematisiert. Weiterhin wird die Zulassung der Privatsender beleuchtet, die durch technische Entwicklungen wie Kabel- und Satellitenübertragung möglich wurde.
Welche Rollen spielt das Fernsehen in der politischen Sozialisation laut dem Text?
Laut dem Text übernimmt das Fernsehen verschiedene Rollen in der politischen Sozialisation. Einerseits vermittelt es Informationen und Sachwissen, wodurch es zur politischen Handlungskompetenz der Bürger beiträgt. Es trägt auch dazu bei, die Folgen staatlichen Handelns verständlich zu machen und eine skeptische Haltung gegenüber staatlicher Macht zu fördern. Andererseits wird kritisiert, dass das Fernsehen durch Unterhaltungsjournalismus und Simplifizierung komplexer Sachverhalte zu oberflächlichem Wissen und geringer politischer Teilhabe führen kann.
Was sind die möglichen manipulativen Einflüsse des Fernsehens, die in dem Text erwähnt werden?
Der Text geht auf die mögliche Manipulation durch das Fernsehen ein, indem das Informationsbedürfnis der Zuschauer geweckt, aber nicht vollständig befriedigt wird. Es wird argumentiert, dass dies zu oberflächlichem Detailwissen, geringer politischer Beteiligung und einer Beschränkung auf die Privat- und Konsumsphäre führen kann. Anstatt einer kritischen Haltung gegenüber staatlichem Handeln wird möglicherweise die Identifikation mit prominenten Politikern gefördert.
Was sind die unbeabsichtigten Effekte des Fernsehens laut dem Text?
Zu den unbeabsichtigten Effekten des Fernsehens zählt der Glaubwürdigkeitsverlust, der mit der Zulassung privater Fernsehsender einherging. Durch die Konkurrenz zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Anbietern schwindet der Eindruck des "offiziösen Charakters" des Fernsehens. Auch die Steuerung der öffentlich-rechtlichen Sender durch den Proporz der politischen Parteien in den Rundfunkräten kann zur Politikverdrossenheit beitragen.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text bezüglich der politischen Sozialisation durch das Fernsehen?
Der Text schlussfolgert, dass die politische Sozialisation durch das Fernsehen in ihrer Sekundärphase an Nachhaltigkeit verliert, was zur Legitimitätskrise von Institutionen und Politikern beiträgt. Die Vermittlung von Politik leidet unter Qualitätsverlusten, was sich negativ auf die Qualität von Politik auswirkt. Die Beschleunigungstendenzen in der Berichterstattung und die Anpassung an medienwirksame Inhalte können zu Lasten der politischen Inhalte gehen.
Welche Literatur wird in dem Text zitiert?
Der Text zitiert verschiedene Werke zur Medienforschung, Politikwissenschaft und zum Staatsrecht, darunter Arbeiten von Dieter Baake, Martin Bullinger, Rainer Geißler, Paul Kevenhörster, Horst Pöttker, Otto B. Roegele, Jean-Jacques Rousseau, Wolfgang Schäuble und Werner Schulz.
- Arbeit zitieren
- Christian Schwedes (Autor:in), 2000, Politische Sozialisation durch das Massenmedium Fernsehen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95164