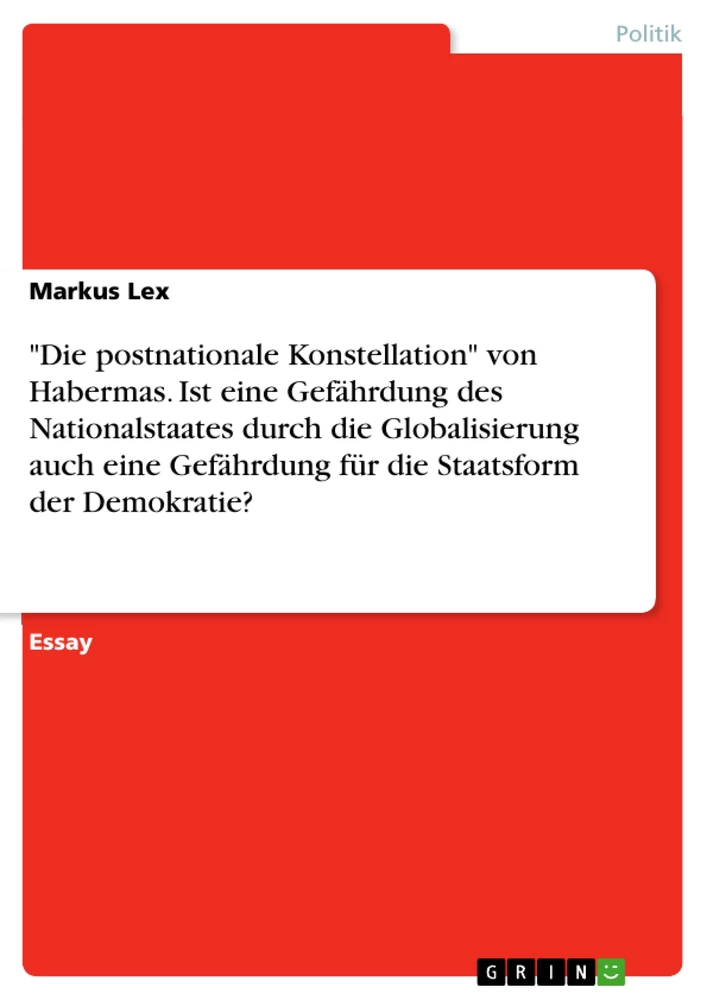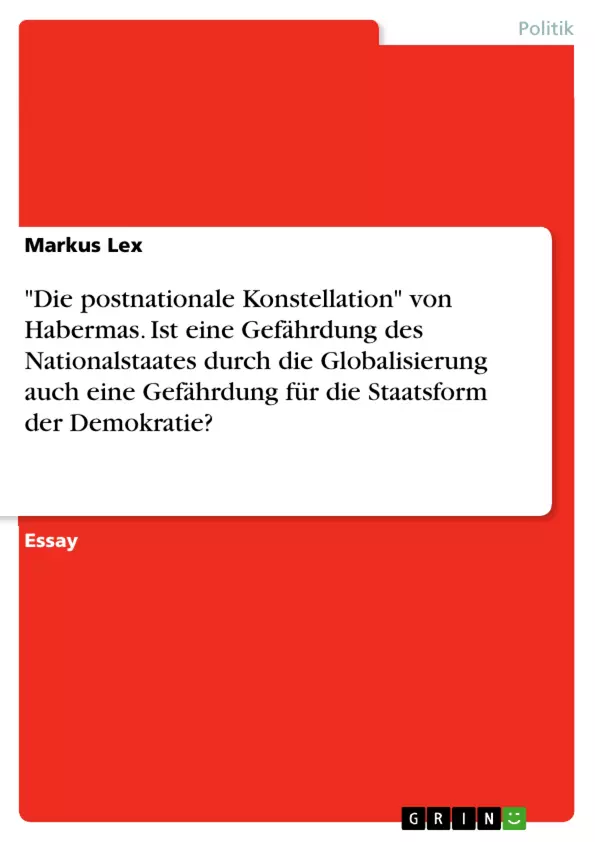Der Kernpunkt dieser Arbeit versucht zu beantworten, ob die Gefährdung des Nationalstaates durch die Auswirkungen der Globalisierung auch eine Gefährdung für die Staatsform der Demokratie bedeutet. Dafür müssen zunächst wesentliche Begriffe definiert werden.
Jürgen Habermas ist einer der renommiertesten Philosophen und Soziologen der Gegenwart. 1998 wurde das Werk „Die postnationale Konstellation“ im Suhrkamp Verlag veröffentlicht. Dieses Werk soll als Grundlage für die Betrachtung der Rolle des Nationalstaates für die Demokratie fungieren. Demokratische Staatsformen entstanden in der historischen Betrachtung stets im nationalstaatlichen Rahmen. Jürgen Habermas versucht jene Auswirkungen der Globalisierung in Hinblick auf den Nationalstaat und gleichzeitig die Möglichkeiten einer postnationalen Konstellation zu beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. HAUPTTEIL
- 2.1 Grundsätzliche Annahmen
- 2.2 Definition Nationalstaat
- 2.3 Definition Globalisierung
- 2.4 Herausforderungen für die Demokratie
- 3. SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Globalisierung auf den Nationalstaat und die Demokratie im Kontext der Thesen Jürgen Habermas‘. Sie untersucht, ob die Herausforderungen der Globalisierung für den Nationalstaat auch eine Gefährdung für die Demokratie darstellen.
- Definition und Bedeutung des Nationalstaates
- Einfluss der Globalisierung auf den Nationalstaat
- Herausforderungen für die Demokratie im Kontext der Globalisierung
- Die Rolle des Nationalstaates in der postnationalen Konstellation
- Mögliche Folgen der Globalisierung für die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Arbeit setzt sich mit dem Werk „Die postnationale Konstellation“ von Jürgen Habermas auseinander und beleuchtet die Bedeutung des Nationalstaates für die Demokratie im Kontext der Globalisierung. Das Zitat von Wolfgang Goethe dient als Ausgangspunkt für die Analyse der gegenwärtigen Situation.
2. Hauptteil
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit grundsätzlichen Annahmen, der Definition des Nationalstaates und der Globalisierung. Dabei wird der Einfluss der Globalisierung auf den Nationalstaat und die Demokratie untersucht und es werden verschiedene Herausforderungen für die Demokratie im Kontext der Globalisierung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Nationalstaat, Globalisierung, Demokratie, postnationale Konstellation, Jürgen Habermas, Herausforderungen, Transformation, Selbstgesetzgebung, Wahlregime.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernfrage dieser Arbeit über Habermas?
Die Arbeit untersucht, ob die Gefährdung des Nationalstaates durch die Globalisierung zwangsläufig auch eine Gefährdung für die Staatsform der Demokratie bedeutet.
Welches Werk von Jürgen Habermas dient als Grundlage?
Als Grundlage dient das 1998 im Suhrkamp Verlag veröffentlichte Werk „Die postnationale Konstellation“.
Warum ist der Nationalstaat für die Demokratie historisch so wichtig?
Demokratische Staatsformen sind historisch betrachtet stets im Rahmen von Nationalstaaten entstanden, weshalb deren Schwächung durch globale Prozesse Fragen zur Zukunft der Demokratie aufwirft.
Was versteht Habermas unter der „postnationalen Konstellation“?
Er beschreibt damit die Situation und die Möglichkeiten politischer Ordnung und demokratischer Selbststeuerung jenseits des klassischen Nationalstaates unter den Bedingungen der Globalisierung.
Welche Begriffe werden im Hauptteil der Arbeit definiert?
Es werden wesentliche Begriffe wie Nationalstaat, Globalisierung und die spezifischen Herausforderungen für die Demokratie (z.B. Wahlregime, Selbstgesetzgebung) definiert.
- Quote paper
- Markus Lex (Author), 2020, "Die postnationale Konstellation" von Habermas. Ist eine Gefährdung des Nationalstaates durch die Globalisierung auch eine Gefährdung für die Staatsform der Demokratie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/953218