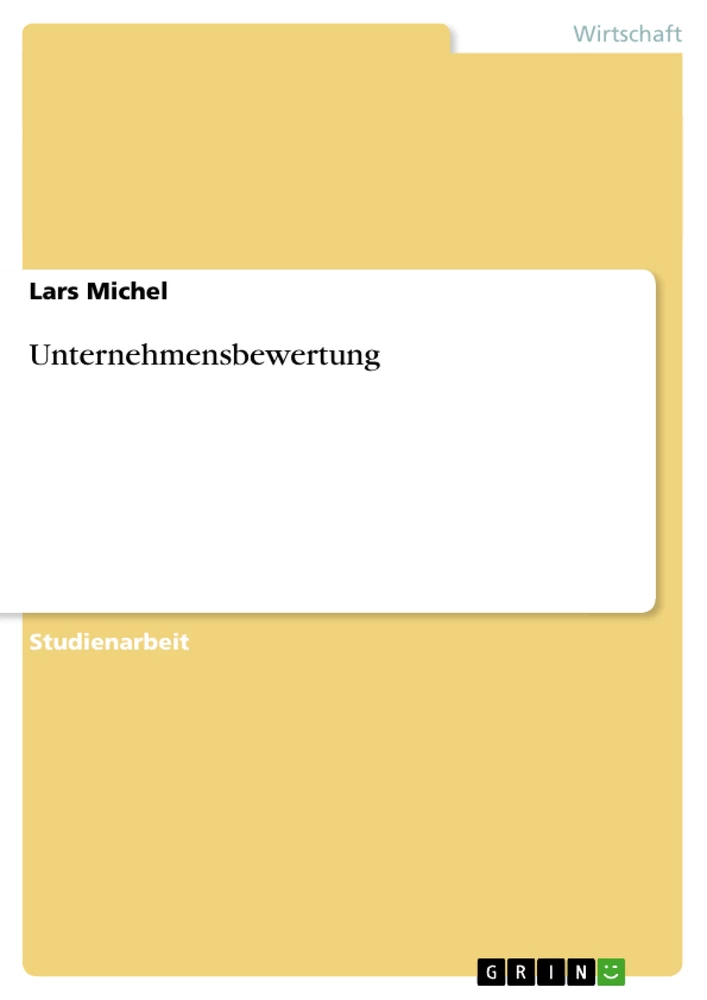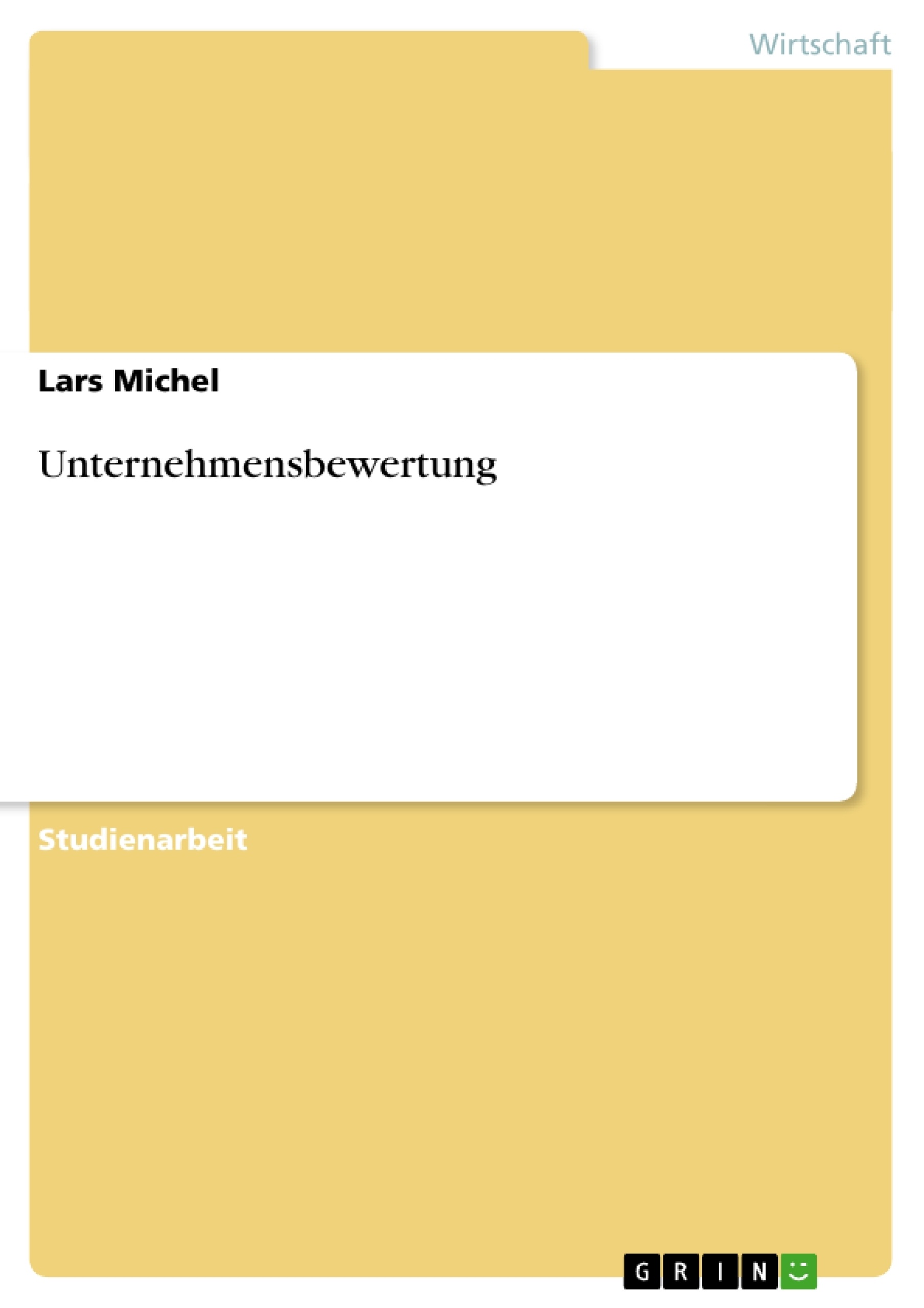Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A Einleitender Teil
I. Begriffserklärungen
II. Problemstellung
III. Gang der Untersuchung
B. Hauptteil
I. Grundsätze der Ermittlung des Praxiswertes
1. Anlässe zur Praxisbewertung
2. Unterscheidung zwischen internem und externem Praxiswert
3. Beeinflussungsgrößen des Praxiswertes
II. Methoden der Ermittlung des Praxiswertes
1. Praxisbewertung im Rahmen der Entscheidungswertfindung
a. Wertfindung in der betriebswirtschaftlichen Theorie
aa) Substanzwert
ab) Ertragswertverfahren
b. Wertfindung in der Bewertungspraxis
ba) Modifizierte Ertragswertmethode
bb) Umsatzmethode
2. Praxisbewertung im Rahmen der Auseinandersetzung
a. Ausscheiden von Gesellschaftern
b. Ehescheidung
c. Erbauseinandersetzung
C. Abschließende Bemerkungen
I. Zusammenfassung der Untersuchung
II. Kritik an den Ergebnissen
III. Ausblick
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A Einleitender Teil
I. Begriffserklärungen
Eine Wirtschaftsprüferkanzlei kann als Einzelpraxis, als Sozietät in der Rechtsform einer BGB-Gesellschaft, d.h. als Personengemeinschaft, oder als Berufsgesellschaft geführt werden.1 Berufsgesellschaften können die Rechtsform einer OHG, KG oder PartG haben.2 Unabhängig von der Anzahl der Berufsangehörigen kann aber auch die Gesellschaftsform einer AG oder GmbH, gewählt werden.
Um den Wert einer solchen Kanzlei zu ermitteln, ist es u.a. erforderlich den Praxiswert zu bestimmen, der in der Literatur unterschiedlich definiert wird. Der Praxiswert soll hier nicht identisch mit dem Wert der gesamten Praxis sein, sondern mit den Begriffen Goodwill sowie Geschäfts- oder Firmenwert gleichgesetzt werden. Er bezeichnet somit den über den Substanzwert hinausgehenden immateriellen Wert der Wirtschaftsprüfer- praxis und ist in Abgrenzung zum Begriff Gesamtwert zu sehen, der sich aus der Summe von Substanzwert und Praxiswert ergibt. Der Geschäftswert verkörpert gleichzeitig den über eine Normalverzinsung der Substanz hinausgehenden Übergewinn.3 Für Freiberuflerpraxen umfaßt er nur den Wert, der durch das besondere Vertrauensverhältnis gekennzeichneten Geschäftsbeziehungen des Berufsangehörigen zu seinen Mandanten.4
Entsprechend wird im folgenden auch die Differenzierung der Begriffe Praxiswert und Geschäftswert des BFH außer acht gelassen.5
Aufgrund der starken Personenbezogenheit bei Wirtschaftsprüferpraxen wird zwischen dem internen und dem externen Praxiswert unterschieden, da sich ein Unterschied in der Person des künftigen Eigentümers stark auf die Entwicklung der Zukunftserträge auswirkt.1 Für den Fall des Praxisverkaufs oder der Aufnahme eines Gesellschafters wird der interne Praxiswert ermittelt, der darauf beruht, daß der bisherige Inhaber in der Firma bleibt, während ein Erwerber den externen Praxiswert berechnet, wenn der bisherige Inhaber ausscheidet. Für einen potentiellen Erwerber ist der Praxiswert gleichbedeutend mit dem wirtschaftlichen Wert der ihm gewährten Chance, die Klientel des Veräußerers für sich zu gewinnen und den vorhandenen Mandantenstamm als Grundlage für den weiteren Ausbau der Kanzlei zu verwenden.2
Neben der Methode den Goodwill mit Hilfe eines Ertragswertverfahrens zu ermitteln, wird für Praxen von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern die Umsatzmethode angewandt. Im Rahmen des Umsatzverfahrens wird hier auf den Umsatz Bezug genommen, der aber nicht dem steuerrechtlichen Begriff Umsatz, sondern dem normalisierten, periodisch abgegrenzten Jahresumsatz entsprechen soll, von dem anzunehmen ist, daß er auch in Zukunft zu erzielen sein wird.3
II. Problemstellung
Ursprünglich wurde die Veräußerung einer freiberuflichen Praxis als standes- und sittenwidrig angesehen, heute aber wird die Notwendigkeit des Praxisverkaufs anerkannt, wenn er aus Gründen der Berufsunfähigkeit, Alters- oder Hinterbliebenenversorgung vollzogen wird oder wenn die Erben eines Freiberuflers die Praxis verkaufen.1
Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Bewertung einerseits und in der Bewertungspraxis andererseits werden unterschiedliche Methoden ange- wandt, um ein Unternehmen zu bewerten. Sie lassen sich aber nur bedingt auf Wirtschaftsprüferpraxen anwenden. Eine aktuelle Untersuchung (Peemöller/Meyer-Pries, DStR, 1995, 1202 ff.) zeigt, daß Steuerberater in der Praxis einem Kombinationsverfahren aus Ertragswert und Substanzwert den Vorzug geben, obwohl der Substanzwert nach der herrschenden wissenschaftlichen Ansicht lediglich eine Hilfs- und Kontrollgröße darstellen soll.2 Wirtschaftsprüfer wenden derzeit das Umsatzverfahren an.3 WPK und BStBK geben in ihren Handbüchern nur Empfehlungen, aber keine verbindlichen Vorgaben.4
Die Bewertung von freiberuflichen Praxen gewinnt mehr und mehr an Bedeutung.5 Einerseits werden immer häufiger Vermögensbewertungen aus familienrechtlichen Anlässen erforderlich, andererseits werden Praxen immer häufiger veräußert und selbst in Todesfällen nur noch selten liquidiert.6
III. Gang der Untersuchung
Die Bewertung von Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterpraxen wird hier gleichgesetzt, da in beiden Berufsfeldern ähnliche, oft sogar die gleichen Tätigkeiten ausgeübt werden und sich in der Literatur bzgl. dieser Berufsstände keine Unterschiede feststellen lassen.
Dabei werden zwei Grundformen der Praxisbewertung unterschieden: die Ermittlung von Grenzpreisen als Entscheidungsgrundlage sowie die Ermittlung von Schiedswerten als objektivierter Unternehmenswert.7
Im Zuge der Entscheidungswertermittlung sollen hier sowohl die betriebswirtschaftlichen Grundsätze als auch die Praktikabilität Berück- sichtigung finden, soweit sie zur Bewertung von Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungspraxen angewandt werden. Bezüglich der Praxisbewertung im Rahmen der Auseinandersetzung konnte zu dieser Differenzierung jedoch nicht ausreichend Literatur gefunden werden. Entsprechend werden in diesem Teil der vorliegenden Arbeit nur die jeweiligen Besonderheiten dargestellt.
Um möglichst aktuelle Kenntnisse zu erlangen, wurde neben der Literatur- recherche ein persönliches Gespräch mit WP/StB Prof. Dr. Karl Kurz bei der WPK in Düsseldorf geführt und im Internet recherchiert.
B. Hauptteil
I. Grundsätze der Ermittlung des Praxiswertes
1. Anlässe zur Praxisbewertung
Die Übertragung oder Aufgabe einer Wirtschaftsprüfungs- oder Steuer- beratungspraxis und somit die Notwendigkeit ihrer Bewertung kann sich aus unterschiedlichen Gründen ergeben. Grundsätzlich sind folgende Anlässe denkbar:
- entgeltliche und unentgeltliche Übertragung einer Einzelpraxis,
- Errichtung und Erweiterung einer Sozietät durch Aufnahme eines Partners in eine Einzelpraxis oder Sozietät,
- Einbringung einer Einzelpraxis oder Sozietät in eine Berufsgesellschaft,
- Ausscheiden eines Partners aus einer Sozietät oder Berufsgesellschaft,
- Auflösung einer Berufsgesellschaft.1
Die Bewertung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen dient dabei im allgemeinen als Grundlage für Investitions- oder Desinvestitionsentscheidungen.2 Demgegenüber soll ein unparteiischer Gutachter bei der Wertermittlung im Sinne der Vermittlungsfunktion zwischen den unterschiedlichen Interessen mehrerer Parteien vermitteln.3
2. Unterscheidung zwischen internem und externem Praxiswert
Nach dem Zweck der Praxisbewertung wird zwischen dem internen und dem externen Praxiswert unterschieden. Der interne Praxiswert beruht auf dem Gedanken, daß der bisherige Inhaber einen Teilhaber aufnimmt und in der Praxis verbleibt, also die persönliche Verbindung zu seinen Mandaten aufrechterhält.4 Ein externer Praxiswert hingegen wird unter der Prämisse berechnet, daß der bisherige Inhaber ausscheidet. Er ergibt sich für den Kauf oder Verkauf und den Krankheits- oder Todesfall. Der interne Praxiswert wird somit immer über dem externen Praxiswert liegen.
Da die Höhe der nachhaltig erzielbaren Überschüsse von der Realisierbarkeit des externen Praxiswertes abhängt, ist es aus Sicht eines potentiellen Käufers erforderlich, die Praxisstruktur zu analysieren und zu bewerten, um eine Ertragsprognose ermitteln zu können, die auf Fortführung der Praxis durch seine Person beruht.1
3. Beeinflussungsgrößen des Praxiswertes
Im wesentlichen wird der Praxiswert von dem Grad der Personengebundenheit, der Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter sowie der Struktur der Klientel bzw. der Aufträge beeinflußt.2
Der Wert einer Praxis und die Frage der Übertragbarkeit der Ertragskraft hängen entscheidend von der Stärke der Bindung zwischen dem bisherigen Praxisinhaber und seinen Mandanten ab.3 Je länger eine Geschäftsbeziehung besteht, desto größer ist das Risiko des Mandantenverlustes bei der Praxisübertragung auf einen neuen Inhaber.4
Diese Bindung der Klientel zu ihrer Praxis kann aber auch zu den Mitarbeitern bestehen, womit dann eine Abwanderung von Mandanten weniger wahrscheinlich ist.5 Je mehr Mitarbeiter die Kanzlei hat und je höher diese qualifiziert sind, desto wertbeständiger ist also der Praxiswert einer Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungskanzlei.6 Aus diesem Grund ist bei solchen Praxen abzuschätzen, wieviele Mitarbeiter kündigen werden, um das Mandatsverlustrisiko einschätzen zu können.7
Eine hohe Anzahl an Mandaten mit geringem Anteil am gesamten Honorar der Praxis verringern das wirtschaftliche Risiko für den Goodwill im Veräußerungsfall.1 Die Höhe des Spezialisierungsgrades bzgl. bestimmter Aufträge bestimmt ebenso die externe Realisierbarkeit des Praxiswertes; demnach ist stets eine genaue Analyse der Praxisstruktur erforderlich.2 Werden überwiegend Routineaufträge ausgeführt, besteht dagegen eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß einem Erwerber die Klienten erhalten bleiben.
Letztendlich hat aber auch die Konkurrenzsituation in der Region einen nicht unerheblichen Einfluß auf das Mandantenverlustrisiko.3
II. Methoden der Ermittlung des Praxiswertes
1. Praxisbewertung im Rahmen der Entscheidungswertfindung
a. Wertfindung in der betriebswirtschaftlichen Theorie>
aa) Substanzwert
Zur Vermeidung begrifflicher Unstimmigkeiten soll der Substanzwert hier im engeren Sinne, also in Anlehnung an den handelsrechtlichen Bilanzwert, betrachtet werden.4 Als Teil des Gesamtwertes setzt sich demnach die Substanz einer Kanzlei aus den aktivierungsfähigen materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen zusammen. Hierzu zählen im we- sentlichen die BGA, die EDV-Anlagen sowie die zugehörige Software, vorrätige Materialien, die Bibliothek und evtl. die Praxisräume selbst.5 Dabei ist zwischen den betriebsnotwendigen Wirtschaftsgütern zu unter- scheiden, die zu Wiederbeschaffungskosten abzüglich Abschreibungen zu bewerten sind, und den nicht betriebsnotwendigen Wirtschaftsgütern, die zum Liquidationswert anzusetzen sind.6
Verbindlichkeiten sind in diesem Substanzwert noch nicht enthalten, daher wird an dieser Stelle vom Bruttowert der Substanz ausgegangen.7 Ein Geschäftswert kann nicht angesetzt werden, da er nicht selbständig verkehrsfähig ist; er findet seinen Ausdruck allein im Ertragswert.1
Der Substanzwert wird hier nicht als Reproduktionswert betrachtet, da zur Nachbildung eines Unternehmens auch Investitionen in den Geschäfts- oder Firmenwert erforderlich sind2. Als Liquidationswert hingegen stellt er wie bei jeder anderen Unternehmensbewertung die Preisuntergrenze des Verkäufers dar.
In der betriebswirtschaftlichen Theorie kommt dem Verfahren, den Gesamtwert eines Unternehmens mit Hilfe der Substanzwertmethode zu bestimmen, nur noch eine untergeordnete Bedeutung im Sinne einer Kontrollfunktion zu.3 Bei der Bewertung einer Wirtschaftsprüferpraxis kann diese Methode aufgrund der geringen Bedeutung der Substanz für den Gesamtwert gar nicht angewandt werden.
ab) Ertragswertverfahren
Werden ausschließlich finanzielle Ziele vorausgesetzt, ergibt sich der Goodwill einer Praxis durch die nachhaltig erzielbaren Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben, die aus der Aufwands- und Ertragsrechnung abgeleitet werden.4 Um die erwarteten Entnahmemöglichkeiten vergleichbar zu machen, werden sie durch einen Kapitalisierungszinssatz auf den Bewertungsstichtag abgezinst. Dieser Zinssatz wird üblicherweise von dem Zins langfristiger Anleihen abgeleitet und um einen Risikozuschlag erhöht.5 Alternativ rechnet man mit der Mindestverzinsung des Investors oder mit der durchschnittlichen Verzinsung langfristiger Staatspapiere.6 Die Bestimmung des Zinsfußes ist in besonderer Weise von den individuellen Gegebenheiten des Bewertungsobjektes abhängig.7
Dann werden diese Ergebnisse mit den Einnahmeüberschüssen einer alternativen Investition verglichen, um so zum Grenzpreis des Käufers zu gelangen.1 Im Rahmen der Ertragswertverfahren wird bei der Ermittlung des künftig erzielbaren Erfolges vom Prinzip der Vollausschüttung bei Substanzerhaltung ausgegangen.2 Würde man Gewinnthesaurierung unterstellen, wären Korrekturrechnungen erforderlich, da Thesaurierungen Substanzmehrungen darstellen, die ihrerseits wieder zu zusätzlichen Erfolgen führen könnten.3
Mit Hilfe eines Ertragswertverfahrens wird der Praxiswert zum Stichtag festgestellt und um die Verbindlichkeiten bereinigt, soweit der Erwerber sie übernimmt. Im Grundsatz kann man dabei zwei Wege der Abschätzung der Ertragskraft unterscheiden: die pauschale und die analytische Methode.4
Die pauschale Methode schließt nach der traditionellen Auffassung, die sich an den Ergebnissen der vergangenen Jahre orientiert, aus vergangenen und gegenwärtigen Daten mit Hilfe eines gewichteten Mittelwertes auf ein zukünftiges Durchschnittsergebnis.5 Sie wird jedoch nur noch für Branchen des wenig schwankenden lebensnotwendigen Bedarfs als geeignet ange- sehen.6
Die analytische Methode hingegen ist die von der betriebswirtschaftlichen Theorie präferierte Vorgehensweise. Gemäß dem Düsseldorfer Verfahren nach HFA 2/1983 wird in zwei Schritten zuerst nach der sog. Phasenmethode der „objektivierte Wert“ des Unternehmens ermittelt, so „wie es steht und liegt“.7 Dazu wird der Planungszeitraum in mindestens zwei Phasen zerlegt und der Periodenerfolg der einzelnen Phasen prognostiziert.8 Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daß der Zukunftserfolg eines zu bewertendes Unternehmen anfänglich durch die hohe Fremdkapitalquote belastet ist.1
Die Erträge der näheren Zukunft werden anhand vorhandener Planzahlen für jedes Jahr gesondert veranschlagt, die Erträge ferner Jahre werden mit einem gleichbleibenden Betrag veranschlagt.2 Um die mit solchen Prognosen verbundenen Unsicherheiten zu begrenzen, gewichtet man innerhalb der Phasen nach unterschiedlichen Schätzgenauigkeiten und begründet eine Minderung des Problems mit der abnehmenden Bedeutung ferner Zukunftsjahre für den Barwert der Erfolge.3
In einem zweiten Bewertungsschritt wird der so ermittelte Unternehmenswert in Berücksichtigung individueller Merkmale des Bewertungssubjektes ergänzt, um die persönliche Steuerpflicht, die Auswirkungen spezieller Erwägungen des Investors auf den Zinssatz der Alternative sowie die positiven und negativen Synergieeffekte zu berücksichtigen.4
Diese Formen der Ertragswertmethode sind aber u.U. auf Kanzleien von Wirtschaftsprüfern nicht anwendbar, da sie eine unendliche Lebensdauer der Unternehmung unterstellen, der Praxiswert einer Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungskanzlei aber kein sich laufend regenerierender Firmen- wert ist.5
b. Wertfindung in der Bewertungspraxis>
ba) Modifizierte Ertragswertmethode
Da insbesondere Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei der Praxis- übertragung Ziele verfolgen, die nicht finanzieller Art sind, und bei der Bewertung der Praxis eines Angehörigen dieser Berufe berufstypische Besonderheiten die Wertfindung erschweren, wird eine Modifikation der reinen Ertragswertmethode notwendig, die diesen zusätzlichen Aspekten Rechnung trägt.1
Im Gegensatz zu Gewerbebetrieben ist bei Freiberuflerpraxen der Goodwill jedoch grundsätzlich reproduzierbar, so daß ein Kaufinteressent als Entscheidungsalternative die Neugründung einer eigenen Praxis hat.2 Aus diesen Überlegungen ergibt sich die Notwendigkeit, bei der Bewertung von Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien einzelne Einflüsse auf Sachverhalte immer individuell zu analysieren bzw. zu bewerten.3
Zu diesem Zweck wird das Ertragswertverfahren für die Anwendung auf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungspraxen dahingehend modifiziert, daß kein Ewigkeitsertrag kapitalisiert, sondern für die Ertragsprognose eine begrenzte Zeit unterstellt wird, in der der Praxiserwerber sich eine vergleichbare Praxis aufbauen könnte.4 Lediglich der Differenzbetrag der Nettoüberschüsse, den die bestehende Kanzlei gegenüber einer neu aufzu- bauenden abwirft, soll dem früheren Praxisinhaber als Kaufpreis für den Praxiswert gezahlt werden.5
Die Probleme liegen bei diesem Wertermittlungsverfahren in der Prognose zukünftiger Entwicklungen, dem Festlegen des Kalkulationszinssatzes und der Bestimmung des Planungshorizontes.6
Daneben wird stellenweise das Humankapital des Bewertungssubjektes berücksichtigt, indem der Arbeitseinsatz durch Ansatz eines kalkulato- rischen Stundenlohns finanziell bewertet und somit vergleichbar gemacht wird.7 Der Wert des Goodwill wird danach um einen Betrag verringert, den ein potentieller Erwerber als Angestellter WP oder StB verdienen könnte.
bb) Umsatzmethode
Aus Vereinfachungsgründen wird in der Praxis häufig auf eine Multiplikatormethode zurückgegriffen, die den gesuchten Wert als Vielfaches vom Umsatz, Cash-Flow oder Gewinn ermittelt.1 Bei der Methode, den Unternehmenswert anhand eines Prozentsatzes vom durchschnittlich erzielten Umsatz abzuleiten, handelt es sich eigentlich um ein Vergleichspreisverfahren, bei dem der Umsatz selbst nur dazu dient, die Größe der Praxis festzulegen.2 Aus diesem Umsatz wird dann der Goodwill mit Hilfe eines branchenüblichen Multiplikators ermittelt. Der Focus liegt hier für den Bewerter nicht auf der Kenntnis konkreter Transaktionspreise, sondern auf der Kenntnis branchentypischer Kennziffern nebst Gewinnbereinigung für Zwecke der Vergleichbarkeit.3
Die Probleme bei dieser Vorgehensweise liegen zum einen darin, ein entsprechendes Vergleichsunternehmen zu finden, und zum anderen in dem Ansatz der nachhaltig erzielbaren Umsätze sowie der Wahrscheinlichkeiten, mit denen der jeweilige Umsatz wiederkehrt.4
Die meisten Berufsangehörigen ermitteln den Wert aber heute noch nach der Umsatzmethode.5 Dabei hat der Multiplikator den einzigen Einfluß auf das Ergebnis. Der zu bestimmende Multiplikator beruht im allgemeinen auf branchenspezifischen Erfahrungssätzen und liegt heute für Wirtschaftsprüferpraxen zwischen 120 % und 140 %.6
Ausgehend von dem Durchschnitt der letzten drei bis fünf Jahresumsätze wird der so ermittelte Wert um individuelle Zu- und Abschläge modifiziert.7 Umsätze, die sich nicht wiederholen werden, werden ausgeschlossen und Umsätze, die sich über mehrere Perioden erstrecken, werden nur zeitanteilig berücksichtigt.8
Würde der Geschäftswert als Bruttowert interpretiert, müßte der Multiplikator korrigiert werden, um eine doppelte Erfassung des Substanzwertes zu vermeiden.1 In der Literatur wird vorgeschlagen, für den betriebsnotwendigen Substanzwert ein Betrag von 25 % bis 40 % des Umsatzes in Abzug zu bringen.2
2. Praxisbewertung im Rahmen der Auseinandersetzung
a. Ausscheiden von Gesellschaftern
Die Praxisbewertung im Rahmen der Auseinandersetzung erfordert eine Wertermittlung im Sinne der Vermittlungsfunktion. Ihre Besonderheit besteht darin, daß sie vom Gesetz angeordnet ist und daß, wenn die Beteiligten sich nicht einigen, die „Richtigkeit“ der Bewertung der richterlichen Prüfung unterliegt.3 Im Gegensatz zur Entscheidungswert- findung ist der Schiedswert vom Bewertungssubjekt losgelöst und stellt einen fairen Einigungspreis dar.4 Die Bewertungsregeln für den Gutachter richten sich meist nach den vertraglichen Vereinbarungen, daneben sollten aber, soweit dies im Einzelfall zulässig ist, die Grundsätze der betriebswirtschaftlichen Unternehmensbewertung Anwendung finden.5 Beachtet der Gutachter die Grundsätze der Rechtsprechung, so vermindert er sein Haftungsrisiko.6 Außerdem wird bei einer Wertfindung im Rahmen der Auseinandersetzung besonderer Wert auf die Nachvollziehbarkeit der Bewertung für die jeweiligen Adressaten und die genaue Erläuterung der Bewertung gelegt.7
Die Beziehungen der konfligierenden Parteien werden in dominierte und nicht dominierte Konfliktsituationen unterschieden.1 Dabei zeichnen sich nicht dominierte Konfliktsituationen dadurch aus, daß keine der Parteien gegen den Willen der anderen Partei eine Änderung der Eigentums- verhältnisse der zu bewertenden Praxis durchsetzen kann.2 Im folgenden sollen die Probleme in dominierten Konfliktfällen dargelegt werden, in denen die Entscheidung zur Eigentumsaufgabe unabhängig vom Willen zumindest einer beteiligten Partei fällt.3
Scheidet ein Partner aus einer Sozietät oder Kapitalgesellschaft aus oder wird eine Wirtschaftsprüferpraxis aufgelöst, gelangen die gesetzlichen Abfindungsregeln zur Anwendung, sofern keine vertraglichen Vereinba- rungen getroffen worden sind.4 Zur Berechnung der Abfindung wird dabei die Auflösung des Unternehmens unterstellt und der Verkehrswert ist als Berechnungsgrundlage anzusetzen.5 Die Besonderheit in solchen Fällen der Unternehmensbewertung liegt darin, daß nicht eine ganze Praxis, sondern nur ein Praxisanteil bewertet wird.6
b. Ehescheidung
Praxisbewertungen werden erforderlich, wenn der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft durch Ehescheidung beendet wird und zum Vermögen eines Ehegatten eine Wirtschaftsprüferpraxis oder die Beteiligung an einer solchen gehört.7 Auch an dieser Stelle zielt die Unternehmensbewertung auf einen fairen Einigungswert ab.8 Da Streitfälle dieser Art i.d.R. von Gerichten entschieden werden, wird hier nur die Bewertung nach Maßgabe der Rechtsprechung dargestellt, zumal sie sich im wesentlichen den Bewertungsmethoden der betriebswirtschaftlichen Theorie und der Bewertungspraxis angenähert hat.9
In solchen Fällen ergeben sich bei der Bewertung insbesondere für freiberufliche Praxen unabhängig vom gewählten Bewertungsverfahren Besonderheiten.
Gem. § 1373 BGB ist der Zugewinn der Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten das Anfangsvermögen übersteigt. Für die Vorgehensweise bei der Ermittlung des jeweiligen Vermögens gibt es keine rechtlich vorgeschriebene Bewertungsmethode.1 Eine konkrete Vorgabe für das anzuwendende Bewertungsverfahren wird lediglich für die Berechnung von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben gemacht.2 Ansonsten werden im Scheidungsrecht Kombinationsverfahren angewandt, die den Gesamtwert einer Praxis aus der Summe von Substanzwert und Geschäftswert errechnen, wobei der Goodwill auf Basis des Umsatzverfahrens ermittelt wird.3 Beim Ansatz des Substanzwertes als Bestandteil des Endvermögens ist besonders auf zum Stichtag noch ausstehende Honorarforderungen zu achten.4 Für das Ausfallrisiko sollte ein Abschlag vorgenommen werden.
Für Käufer und Verkäufer ergeben sich unterschiedlich hohe Werte bzgl. des immateriellen Wertes. Daher ist es fraglich, ob bei der Bewertung des Geschäftswertes von einem Fortführungswert oder von einem geringeren Veräußerungswert und damit vom Verkehrswert ausgegangen werden muß.5 Da bei jeder Praxisbewertung der individuelle Einzelfall zu betrachten ist, sollte berücksichtigt werden, ob der Praxisinhaber seine Kanzlei weiterführt oder ob er sie verkauft. Ferner besteht die Gefahr, daß zur Abfindung des Zugewinnberechtigten Finanzmittel durch Kreditaufnahme beschafft werden müssen, was sich wiederum auf die Finanzlage und somit auf den Nettovermögenswert des Verpflichteten auswirkt.6 Nach Ermittlung des objektivierten Wertes müssen daher in einem zweiten Schritt die individuellen Verhältnisse analysiert und bewertet werden.
Ein Teil des Goodwill ist jedoch nicht nur im Zusammenhang mit der Person des Wirtschaftsprüfers, sondern auch mit der Kanzlei selbst zu sehen.1 Somit bleibt zu klären, in welcher Höhe ein Geschäftswert anzusetzen ist.
Nur wenn der Veräußerungswert zu ermitteln ist, ist von dem errechneten Praxiswert die latente Steuerlast abzusetzen, da ertragsabhängige Steuern bei der Ertragswertermittlung erst dann abzuziehen sind, wenn sie den Unternehmenseigner wirtschaftlich belasten.2 Hierbei handelt es sich um Ertragsteuern, die entstehen, wenn durch den Verkauf der freiberuflichen Praxis ein Gewinn aus der Realisierung stiller Reserven erzielt wird.3
Ferner besteht bei Auseinandersetzungen zwischen Zugewinngemeinschaften ein Stichtagsproblem.4 Das Gesetz hat den Stichtag für die Berechnung des Zugewinns ausdrücklich geregelt.5 Da das Vermögen sowohl zum Tag der Eheschließung als auch zu dem Termin der Scheidung ermittelt werden muß, steht der Sachverständige zwei Bewertungsstichtagen gegenüber.6 Dabei ist der Zugewinnverpflichtete an einem hohen Anfangsvermögen interessiert, der Zugewinnberechtigte aber an einem hohen Endvermögen.7
Das Stichtagsprinzip verlangt, daß die am Stichtag maßgeblichen Verhält- nisse zu berücksichtigen sind und nur Erfolgsfaktoren in die Bewertung mit einzubeziehen sind, die am Bewertungsstichtag zumindest schon im Ansatz bestanden haben.8 Hinsichtlich der Bewertung des Anfangsvermögens ist dem Gutachter aber die Zukunft in aller Regel bekannt, und es tritt das Problem auf, ob er bei der Bewertung des Anfangsvermögens die ihm bekannte Zukunft verwerfen darf, oder ob er sich künstlich unwissend stellen muß.9
c. Erbauseinandersetzung
Wird die Praxis eines Wirtschaftsprüfers vererbt, so ist sie nach den Grundsätzen betriebswirtschaftlicher Unternehmensbewertung zu bewerten, soweit das Bewertungsverfahren nicht testamentarisch geregelt oder vertraglich vereinbart worden ist.1 Die Bewertung kann im Rahmen der Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft erforderlich sein oder zur Berechnung des Pflichtteilsanspruches eines Berechtigten dienen, der von der Erbfolge ausgeschlossen wurde.2 Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des gesetzlichen Erbteils und ist ein Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages.3 Unter dem Wert des Nachlasses ist der voraussichtlich erzielbare Veräußerungspreis zu verstehen.4 Auch hier wird der Goodwill nach der Umsatzmethode ermittelt und ergibt zusammen mit dem Substanzwert den Gesamtwert einer Praxis.5
Im Todesfall eines Berufsangehörigen ist von einer externen Verwertung der Praxis auszugehen.6 Für den Gutachter ergibt sich also aufgrund der Personenbezogenheit auch hier das Problem, Einflußfaktoren abzugrenzen, die unabhängig vom Ableben des Erblassers weiterwirken.7 Entsprechend sind latente Steuern wertmindernd zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob der Verkauf der Praxis tatsächlich geplant ist.8
C. Abschließende Bemerkungen
I. Zusammenfassung der Untersuchung
Die Bewertung einer Wirtschaftsprüferpraxis kann grds. durch die Ermittlung subjektiver Grenzpreise als Entscheidungsgrundlage oder durch die Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswertes als Vermittlungswert gegenläufiger Interessen erfolgen.1
Die Betriebswirtschaftslehre favorisiert heutzutage die reine Ertragswert- methode, die den Wert eines Unternehmens als Barwert der künftigen Nettoeinnahmen versteht, die aus dem Unternehmen erzielbar sind.2 Aufgrund der strengen Personenbezogenheit erscheint es fragwürdig, die Erkenntnisse der betriebswirtschaftlichen Bewertungslehre unverändert auf kleine Praxen anzuwenden.3
Die Umsatzmethode ist das Verfahren, das auch nach aktuellem Stand in der Bewertungspraxis üblich ist. Vielfach dient ein nach diesem Praktikerverfahren ermittelter Wert auch als Ausgangsgröße für weitere Verhandlungen oder andere Wertfindungsmethoden.4 Andere Unternehmensbewertungsmethoden wie die Mittelwertmethode oder die Übergewinnmethode gelten als nicht mehr fachgerecht.5
Die bei Steuerberaterpraxen angewandten Prozentsätze sind in den achtziger Jahren von 100 % - 120 % des Praxisumsatzes bis auf 140 % in 1987 gestiegen.6 Diese Multiplikatoren erhöhten sich bis Anfang der neunziger Jahre, waren dann aber wieder rückläufig. Aufgrund der Einführung der Residenzpflicht gem. § 28 Abs. 1 Satz 2 WPO mußten insbesondere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Niederlassungen in den neuen Bundesländern unterhielten, Angehörige des Berufsstandes vor Ort einsetzen.7 Die steigenden Kosten verringerten den Wert der Kanzleien, die Prozentsätze für die Bewertung nach dem Umsatzverfahren sanken.
Zur Zeit nimmt die Zahl der Berufseinsteiger stark zu, somit steigt die Nachfrage nach Freiberuflerpraxen und die in der Praxis angewandten Multiplikatoren steigen wieder; sie liegen derzeit zwischen 120 % und 140 %, wobei gute Wirtschaftsprüferpraxen mehr erzielen.1 George gab 1995 als Höchstsatz für den Faktor 155 % an.2
II. Kritik an den Ergebnissen
Die Konkretisierung einzelner Faktoren durch die Berufsorganisationen empfiehlt sich jedoch nicht, da dies eine schematisierte Vorgehensweise provoziert, bei der individuelle Faktoren vernachlässigt werden.3
Für die Preisfindung kleiner und dementsprechend stark personenbezogener Praxen von Wirtschaftsprüfern oder Steuerberatern könnten die allgemeinen Methoden der Unternehmensbewertung herangezogen werden.4 Wenn die Bewertung aber zu schematisch nach den allgemeinen Grundsätzen vorgenommen wird, ergeben sich rein rechnerische Werte, die häufig das Vielfache tatsächlich gezahlter Kaufpreise ausmachen.5
Die Ertragswertverfahren erfordern eine Prognose der künftigen Einnah- menüberschüsse, die Unsicherheit solcher Ertragsprognosen kann aber im Kalkulationszinsfuß berücksichtigt werden.6 Die Rechtsprechung akzeptiert dabei Zuschläge von zwei bis vier Prozentpunkten.7 Da damit bei einem landesüblichen Zinssatz von 7 % ein Risikoabschlag von dem zu errechnenden Ertragswert von 28,5 % bis 57 % verbunden ist, ergibt sich eine Spanne, die zeigt, wie problematisch eine Ermittlung nach dem reinen Ertragswertverfahren ist.8
Wendet man das modifizierte Ertragswertverfahren zu Kontrollzwecken ergänzend zur Umsatzmethode an, ergeben sich u.U. unterschiedliche Ergebnisse. Dann im Zweifelsfall den Wert der Ertragswertmethode zu verwenden, würde das Umsatzverfahren überflüssig machen.1
III. Ausblick
Durch den von den „Big Six“ ausgelösten Preiskampf und die große Anzahl von Wirtschaftsprüfern, die nach 1989 eingestellt worden sind, wird eine Umverteilung stattfinden, die die Prozentsätze vom Umsatz wieder sinken lassen wird.2
Die Preise für Wirtschaftsprüferpraxen dürften also wieder etwas fallen, die Methode, nach der sie in der Praxis ermittelt werden, wird sich aber aufgrund der Praktikabilität nicht ändern. Evtl. werden Angehörige des Berufsstandes vereinzelt die modifizierte Ertragswertmethode zu Kontrollzwecken ergänzend anwenden.
Wäre der Erwerber einer Wirtschaftsprüferpraxis hauptsächlich daran interessiert, wieviel finanzielle Mittel er einer Kanzlei letztendlich entnehmen kann, so würde er Ertragsprognosen auf Basis eines externen Praxiswertes anstellen. Nach der neueren Literatur setzen sich modifizierte Ertragswertverfahren in der Bewertungspraxis auch stärker durch als bisher. Gerade ein Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater geht aber im Gegensatz zu gewerblichen Investoren in geringerem Maße von finanziellen Erwägungen aus. Daher bleibt der Preis einer solchen Freiberuflerpraxis in solchem Ausmaße Verhandlungssache, daß das einfach zu handhabende Umsatzverfahren weiterhin Anwendung finden wird und besondere Umstände im Umfeld der zu erwerbenden Kanzlei nur im Multiplikator Berücksichtigung finden.
Den vergleichsorientierten Verfahren gehört die Zukunft, sobald Online- Dienste und Datenbanken eine größere Verbreitung finden und ihre Nutzung kostengünstiger erfolgen kann.1 Dies wird auch durch den
Umstand verstärkt werden, daß über die Hinterlegung von Jahresab- schlüssen bei den Registergerichten der Zugriff zu Daten vergleichbarer Unternehmen erleichtert wird.1
Literaturverzeichnis
Barthel, Carl W. [Ertragswertverfahren, 1995]: Unternehmenswert: Die nutzenorientierten Bewertungsverfahren - Zur Fragwürdigkeit des sogenannten „Alleingültigkeitsanspruches des Ertragswertverfahrens“, in: DStR, 33. Jg. (1995), S. 343-351
Barthel, Carl W. [Vergleichsorientierte Bewertungsverfahren, 1996]: Unternehmenswert: Die vergleichsorientierten Bewertungsverfahren - Vergleichswert schlägt Ertragswert, in DB, 49. Jg. (1996), S. 149-163
Breidenbach, Berthold [Überlegungen, 1991]: Überlegungen zur Ermittlung des Wertes einer Steuerberaterpraxis, in DStR, 29 Jg. (1991), S. 47-53
Dörner, Wolfgang [WP-Handbuch, Bd. II, 1992]: Die Unternehmens- bewertung, in: WP-Handbuch 1992, Band II, 10. Auflage, Düsseldorf 1992, S. 1-136
Englert, Joachim [Bewertung, 1996]: Die Bewertung von Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterpraxen, 7. Aufl., Düsseldorf 1996
Gratz, Kurt [Bewertung, 1987]: Bewertung von Freiberufler-Praxen bei Veräußerung und Auseinandersetzung, in: DB, 40. Jg. (1987), S. 2421- 2426
IdW [Stellungnahme HFA 2/1983]: Stellungnahme HFA 2/1983 des Hauptfachausschusses des IdW - Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen, in: Die Fachgutachten und Stellungnahmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer auf dem Gebiete der Rechnungslegung und Prüfung, Stand: 14. Erg.-Lfg. September 1996, Düsseldorf 1996
IdW [Stellungnahme HFA 2/1995]: Stellungnahme HFA 2/1995 des Hauptfachausschusses des IdW - Zur Unternehmensbewertung im Familien- und Erbrecht, in: Die Fachgutachten und Stellungnahmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer auf dem Gebiete der Rechnungslegung und Prüfung, Stand: 13. Erg.-Lfg. Dezember 1995, Düsseldorf 1995
George, Heinz [Praxiswerte, 1995]: Aktivierung und Abschreibung von Praxiswerten, in: DB, 48. Jg. (1995), S. 896-898
Kaminski, Horst [WP-Handbuch, Bd. I, 1992]: Berufsorganisationen, in: WP-Handbuch 1992, Band I, 10. Auflage, Düsseldorf 1992, S. 1-126
Klingelhöffer, Hans [Besprechung, 1991]: Zugewinnausgleich und freiberufliche Praxis - zugleich Besprechung des Urteils des BGH vom 24.10.1990, in: FamRZ, 38. Jg. (1991), S. 882-885
Knief, Peter [Wirtschaftsprüferpraxen, 1978]: Neue Ansätze zur Bewertung von Wirtschaftsprüfer- und/oder Steuerberaterpraxen, in: DStR, 16. Jg (1978), S. 21-27
Kotzur, Hubert [Goodwill, 1988]: Goodwill freiberuflicher Praxen und Zugewinnausgleich, in: NJW, 41. Jg. (1988), S. 3239-3244
Moxter, Adolf [Grundsätze, 1983]: Grundsätze ordnungsmäßiger Unter- nehmensbewertung, 2. Aufl., Wiesbaden 1983
Peemöller, Volker H. [Ansätze, 1994]: Ansätze zur Wertermittlung von Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüferkanzleien, in: DStR, 25. Jg. (1994), S. 914-920
Peemöller, Volker H. [Unternehmensbewertung, 1995]: Unternehmens- bewertung in Deutschland - Ergebnisse einer Umfrage bei dem steuerberatenden Berufsstand, in: DStR, 26. Jg. (1995), S. 1202-1208
Piltz, Detlev Jürgen [Rechtsprechung, 1982]: Die Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung, 1. Aufl., Düsseldorf 1982
Piltz, Detlev Jürgen [Rechtsprechung, 1994]: Die Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung, 3. Aufl., Düsseldorf 1994
Piltz, Detlev Jürgen/Wissmann, Eike [Scheidung, 1985]: Unternehmens- bewertung beim Zugewinnausgleich nach Scheidung, in: NJW, 38. Jg. (1985), S. 2673-2684
Quick, Reiner [Management Buy-Out]: Management Buy-Out und Unter- nehmensbewertung, in: BuW, 46. Jg. (1992), S. 145-151
Richardt, Harald [StB-Handbuch, 1990]: Unternehmensbewertung , in: Schriften des deutschen wissenschaftlichen Steuerinstituts der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten e.V. - Beck’sches SteuerberaterHandbuch 1990, 3. Aufl., Bonn 1990, S. 1383-1437
Rid, Max [Scheidung, 1986]: Nochmals: Unternehmensbewertung beim Zugewinnausgleich nach Scheidung, in: NJW, 39. Jg. (1986), S. 1317- 1318
Schiffer, K. Jan [Richtiger Ansatz, 1997]: Gibt es einen „richtigen“ Ansatz zur Bewertung von Unternehmen?, in: Schiffer, Peters & Partner, hrsg. im Internet (http://www.schiffer.de:80/index5.html), Bonn - Bad Godes- berg 1997
Schmidt-Raquet, M. [Stichtagsproblem, 1986]: Unternehmensbewertung bei Zugewinnausgleich - Ein Stichtagsproblem, in: DB, 39. Jg. (1986), S. 1484-1485
Then Bergh, Wilhelm [Sonderheiten, 1985]: Sonderheiten der Preisfindung für Kleinunternehmen und freiberufliche Praxen - Konzeption zur praktischen Durchführung, in: WPg, 38. Jg. (1985), S. 171-174
Unkelbach, Peter [Praxiswert, 1988]: Ermittlung des Praxiswertes von Steuerberaterpraxen, in: DStR, 26. Jg. (1988), S. 631-635
Wollny, Paul [Praxisübertragungen, 1990]: Unternehmens- und Praxis- übertragungen: Kauf, Verkauf, Anteilsübertragungen in Zivil- und Steuerrecht, 2. Aufl., Ludwigshafen (Rhein) 1990
[...]
1 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 228
2 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 228
3 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen, Rechtsprechung, 1994, S. 33
4 Vgl. Breidenbach, Berthold: Überlegungen, 1991, S. 48
5 Vgl. dazu BFH-Urteil v. 13.3.1991, I R 83/89, in: DStR, 29. Jg. (1991), S. 813-814
1 Vgl. Peemöller, Volker H., Ansätze, 1994, S. 914
2 Vgl. Wollny, Paul: Praxisübertragungen, 1990, S. 380
3 Vgl. Breidenbach, Berthold: Überlegungen, 1991, S. 49
1 Vgl. Wollny, Paul: Praxisübertragungen, 1990, S. 378
2 Vgl. Schiffer, K. Jan: Richtiger Ansatz, 1997
3 Vgl. bspw. aktuelle NWB-Hefte
4 Vg l. Kaminski, Horst: WP-Handbuch, Bd. I, 1992, S. 92-93; Richardt, Harald: StBHandbuch, 1990, S. 1385-1386
5 Vgl. Then Bergh, Wilhelm, Sonderheiten, 1985, S. 172
6 Vgl. Then Bergh, Wilhelm, Sonderheiten, 1985, S. 172
7 Vgl. Gratz, Kurt, Bewertung, 1987, S. 2426
5 Vgl. Then Bergh, Wilhelm, Sonderheiten, 1985, S. 172
1 Vgl. Wollny, Paul: Praxisübertragungen, 1990, S. 377
2 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 1
3 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 225
4 Vgl. Knief, Peter: Wirtschaftsprüferpraxen, 1978, S. 22
1 Vgl. Gratz, Kurt, Bewertung, 1987, S. 2422
2 Vgl. Knief, Peter: Wirtschaftsprüferpraxen, 1978, S. 23
3 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 140-142
4 Vgl. Peemöller, Volker H.: Ansätze, 1994, S. 916-917
5 Vgl. Peemöller, Volker H.: Ansätze, 1994, S. 915
6 Vgl. Knief, Peter: Wirtschaftsprüferpraxen, 1978, S. 23
7 Vgl. Peemöller, Volker H.: Ansätze, 1994, S. 916
1 Vgl. Knief, Peter: Wirtschaftsprüferpraxen, 1978, S. 23
2 Vgl. Gratz, Kurt, Bewertung, 1987, S. 2422
3 Vgl. Peemöller, Volker H.: Ansätze, 1994, S. 916-917
4 Vgl. Unkelbach, Peter: Praxiswert, 1988, S. 631-632
5 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 48
6 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 49
7 Vgl. Wollny, Paul: Praxisübertragungen, 1990, S. 299
2 Vgl. Gratz, Kurt, Bewertung, 1987, S. 2422
1 Vgl. Dörner, Wolfgang: WP-Handbuch, Bd. II, 1992, S. 126
2 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 81
3 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 49
4 Vgl. IdW: Stellungnahme HFA 2/1983, Düsseldorf 1996, S. 101
5 Peemöller, Volker H.: Unternehmensbewertung, 1995, S. 1207
6 Peemöller, Volker H.: Unternehmensbewertung, 1995, S. 1207
7 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen, Rechtsprechung, 1990, S. 5
1 Vgl. Gratz, Kurt, Bewertung, 1987, S. 2422
2 Vgl. IdW: Stellungnahme HFA 2/1983, Düsseldorf 1996, S. 115
3 Vgl. IdW: Stellungnahme HFA 2/1983, Düsseldorf 1996, S. 112
4 Vgl. Dörner, Wolfgang: WP-Handbuch, Bd. II, 1992, S. 31
5 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen, Rechtsprechung, 1994, S. 19-20
6 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen, Rechtsprechung, 1994, S. 20
7 Vgl. Barthel, Carl W.: Ertragswertverfahren, 1995, S. 347
8 Vgl. Quick, Reiner: Management Buy-Out, 1992, S. 150
1 Vgl. Quick, Reiner: Management Buy-Out, 1992, S. 150
2 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen/Wissmann, Eike: Scheidung, 1985, S. 2674
3 Vgl. IdW: Stellungnahme HFA 2/1983, Düsseldorf 1996, S. 104
4 Vgl. IdW: Stellungnahme HFA 2/1983, Düsseldorf 1996, S. 125-126
5 Vgl. Breidenbach, Berthold: Überlegungen, 1991, S. 48
1 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 95
3 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 97
4 Vgl. Breidenbach, Berthold: Überlegungen, 1991, S. 50
5 Vgl. Breidenbach, Berthold: Überlegungen, 1991, S. 50
6 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 96
7 Vgl. Gratz, Kurt, Bewertung, 1987, S. 2422
1 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 51
2 Vgl. Breidenbach, Berthold: Überlegungen, 1991, S. 49
3 Vgl. Barthel, Carl W.: Vergleichsorientierte Bewertungsverfahren, 1996, S. 157
4 Vgl. Knief, Peter: Wirtschaftsprüferpraxen, 1978, S. 24
5 Vgl. bspw. aktuelle NWB-Hefte
6 Vgl. bspw. aktuelle NWB-Hefte
7 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 51
8 Vg l. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 51
1 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 52
2 Vgl. bspw. Knief, Peter: Wirtschaftsprüferpraxen, 1978, S. 25
3 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen/Wissmann, Eike: Scheidung, 1985, S. 2675
4 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen, Rechtsprechung, 1982, S. 16
5 Vgl. Dörner, Wolfgang: WP-Handbuch, Bd. II, 1992, S. 23
6 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen, Rechtsprechung, 1990, S. 5
7 Vgl. Schiffer, K. Jan: Richtiger Ansatz, 1997
1 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 225
2 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 225
3 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 226
4 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 227
5 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 228
6 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 227
7 Vgl. Dörner, Wolfgang: WP-Handbuch, Bd. II, 1992, S. 24-25
8 Vgl. IdW: Stellungnahme HFA 2/1995, Düsseldorf 1995, S. 287
9 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen, Rechtsprechung, 1994, S. 4
1 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 243
2 Vgl. § 1376 Abs. 4 BGB, § 2049 BGB
3 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 258
4 Vgl. Klingelhöffer, Hans: Besprechung, 1991, S. 885
5 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 257
6 Vgl. Dörner, Wolfgang: WP-Handbuch, Bd. II, 1992, S. 25
1 Vgl. Kotzur, Hubert: Goodwill, 1988, S. 3239
2 Vgl. Dörner, Wolfgang: WP-Handbuch, Bd. II, 1992, S. 82
3 Vgl. Klingelhöffer, Hans: Besprechung, 1991, S. 885
4 Vgl. Schmidt-Raquet, M.: Stichtagsproblem, 1986, S. 1484
5 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen/Wissmann, Eike: Scheidung, 1985, S. 2676
6 Vgl. Schmidt-Raquet, M.: Stichtagsproblem, 1986, S. 1484
7 Vgl. Schmidt-Raquet, M.: Stichtagsproblem, 1986, S. 1485
8 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 230
9 Vgl. Schmidt-Raquet, M.: Stichtagsproblem, 1986, S. 1485
1 Vgl. Dörner, Wolfgang: WP-Handbuch, Bd. II, 1992, S. 24
2 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen, Rechtsprechung, 1982, S. 40
3 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen, Rechtsprechung, 1982, S. 40
4 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 262
5 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 262
6 Vgl. Knief, Peter: Wirtschaftsprüferpraxen, 1978, S. 26
7 Vgl. Dörner, Wolfgang: WP-Handbuch, Bd. II, 1992, S. 24
8 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 263
1 Vgl. Gratz, Kurt, Bewertung, 1987, S. 2426
2 Vgl. Moxter, Alfred, Grundsätze, 1983, S. 176
3 Vgl. Then Bergh, Wilhelm, Sonderheiten, 1985, S. 173
4 Vgl. Barthel, Carl W.: Vergleichsorientierte Bewertungsverfahren, 1996, S. 159
5 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen/Wissmann, Eike: Scheidung, 1985, S. 2674
6 Vgl. Gratz, Kurt, Bewertung, 1987, S. 2421
7 Quelle: Gespräch mit Prof. Dr. Karl Kurz, WP/StB, WPK Düsseldorf, am 27.03.1997 18
1 Quelle: Gespräch mit Prof. Dr. Karl Kurz, WP/StB, WPK Düsseldorf, am 27.03.1997
2 Vgl. George, Heinz: Praxiswerte, 1995, S. 896
3 Vgl. Englert, Joachim: Bewertung, 1996, S. 53-54
4 Vgl. Then Bergh, Wilhelm, Sonderheiten, 1985, S. 174
6 Vgl. Rid, Max: Scheidung, 1986, S. 1318
7 Vgl. Piltz, Detlev Jürgen/Wissmann, Eike: Scheidung, 1985, S. 2679, m.N.
8 Vgl. Rid, Max: Scheidung, 1986, S. 1318
1 Vgl. Breidenbach, Berthold: Überle gungen, 1991, S. 52
2 Quelle: Gespräch mit Prof. Dr. Karl Kurz, WP/StB, WPK Düsseldorf, am 27.03.1997 20
1 Vgl. Barthel, Carl W.: Vergleichsorientierte Bewertungsverfahren, 1996, S. 162
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Abkürzungsverzeichnisses?
Das Abkürzungsverzeichnis ist in dieser Leseprobe nicht enthalten.
Was sind die verschiedenen Rechtsformen einer Wirtschaftsprüferkanzlei?
Eine Wirtschaftsprüferkanzlei kann als Einzelpraxis, als Sozietät in der Rechtsform einer BGB-Gesellschaft, als Personengemeinschaft oder als Berufsgesellschaft (OHG, KG oder PartG) geführt werden. Auch die Gesellschaftsform einer AG oder GmbH ist möglich.
Was ist der Praxiswert und wie unterscheidet er sich vom Gesamtwert?
Der Praxiswert wird hier gleichgesetzt mit Goodwill sowie Geschäfts- oder Firmenwert und bezeichnet den über den Substanzwert hinausgehenden immateriellen Wert der Wirtschaftsprüferpraxis. Der Gesamtwert ergibt sich aus der Summe von Substanzwert und Praxiswert.
Was versteht man unter internem und externem Praxiswert?
Der interne Praxiswert wird bei Praxisverkauf oder Aufnahme eines Gesellschafters ermittelt, wenn der bisherige Inhaber in der Firma bleibt. Der externe Praxiswert wird berechnet, wenn der bisherige Inhaber ausscheidet.
Welche Methoden werden zur Ermittlung des Praxiswertes angewandt?
Es werden das Ertragswertverfahren und die Umsatzmethode angewandt. Im Rahmen des Umsatzverfahrens wird auf den normalisierten, periodisch abgegrenzten Jahresumsatz Bezug genommen.
Warum ist die Bewertung einer freiberuflichen Praxis heute notwendig?
Die Notwendigkeit des Praxisverkaufs wird anerkannt, wenn er aus Gründen der Berufsunfähigkeit, Alters- oder Hinterbliebenenversorgung vollzogen wird oder wenn die Erben eines Freiberuflers die Praxis verkaufen. Auch Vermögensbewertungen aus familienrechtlichen Anlässen machen eine Bewertung erforderlich.
Wie wird der Substanzwert definiert?
Der Substanzwert wird im engeren Sinne, also in Anlehnung an den handelsrechtlichen Bilanzwert, betrachtet. Er setzt sich aus den aktivierungsfähigen materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen zusammen (BGA, EDV-Anlagen, Software, Materialien, Bibliothek, evtl. Praxisräume).
Was ist das Ertragswertverfahren?
Beim Ertragswertverfahren wird der Goodwill einer Praxis durch die nachhaltig erzielbaren Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben ermittelt und diese durch einen Kapitalisierungszinssatz auf den Bewertungsstichtag abgezinst.
Was ist die modifizierte Ertragswertmethode?
Diese Methode ist eine Anpassung des reinen Ertragswertverfahrens, die berücksichtigt, dass der Goodwill von Freiberuflerpraxen grundsätzlich reproduzierbar ist und dass der Kaufinteressent als Entscheidungsalternative die Neugründung einer eigenen Praxis hat. Es wird kein Ewigkeitsertrag kapitalisiert, sondern eine begrenzte Zeit unterstellt.
Was ist die Umsatzmethode?
Bei der Umsatzmethode wird der gesuchte Wert als Vielfaches vom Umsatz ermittelt. Der Goodwill wird mit Hilfe eines branchenüblichen Multiplikators ermittelt.
Was sind dominierte und nicht dominierte Konfliktsituationen im Rahmen der Auseinandersetzung?
Nicht dominierte Konfliktsituationen zeichnen sich dadurch aus, dass keine der Parteien gegen den Willen der anderen Partei eine Änderung der Eigentumsverhältnisse der zu bewertenden Praxis durchsetzen kann. In dominierten Konfliktfällen fällt die Entscheidung zur Eigentumsaufgabe unabhängig vom Willen zumindest einer beteiligten Partei.
Wie erfolgt die Praxisbewertung im Falle einer Ehescheidung?
Im Scheidungsrecht werden Kombinationsverfahren angewandt, die den Gesamtwert einer Praxis aus der Summe von Substanzwert und Geschäftswert errechnen, wobei der Goodwill auf Basis des Umsatzverfahrens ermittelt wird.
Wie erfolgt die Praxisbewertung im Falle einer Erbauseinandersetzung?
Die Bewertung erfolgt nach den Grundsätzen betriebswirtschaftlicher Unternehmensbewertung, soweit das Bewertungsverfahren nicht testamentarisch geregelt oder vertraglich vereinbart worden ist. Der Goodwill wird nach der Umsatzmethode ermittelt und ergibt zusammen mit dem Substanzwert den Gesamtwert einer Praxis.
Welche Faktoren beeinflussen den Wert einer Wirtschaftsprüferpraxis?
Der Wert einer Wirtschaftsprüferpraxis wird hauptsächlich durch den Grad der Personengebundenheit, die Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter sowie die Struktur der Klientel bzw. der Aufträge beeinflusst.
- Quote paper
- Lars Michel (Author), 1996, Unternehmensbewertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95332