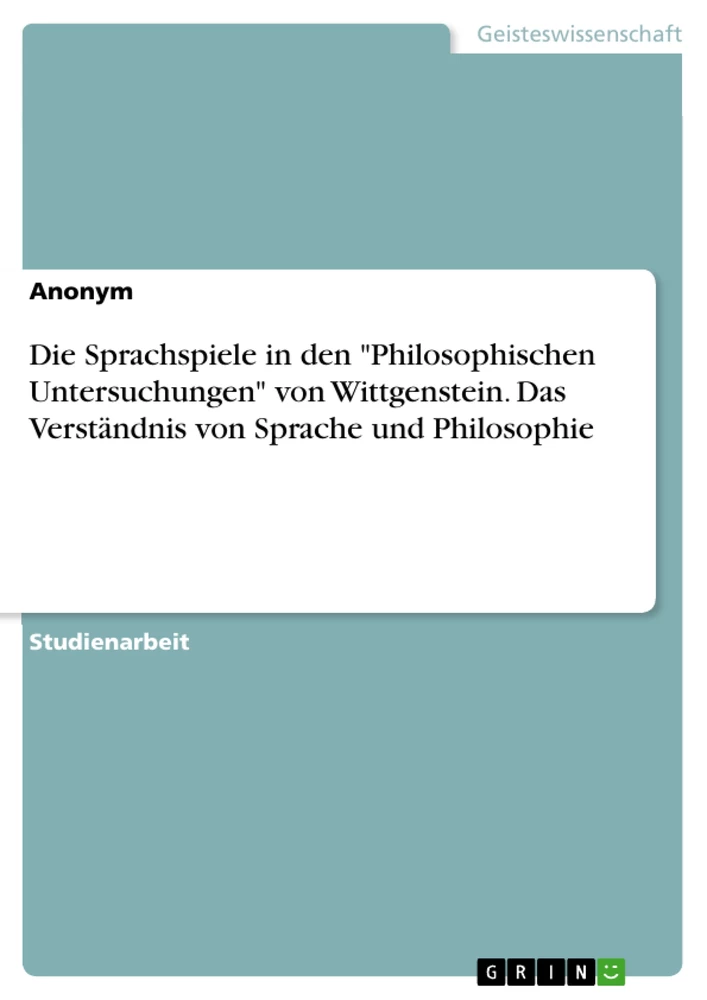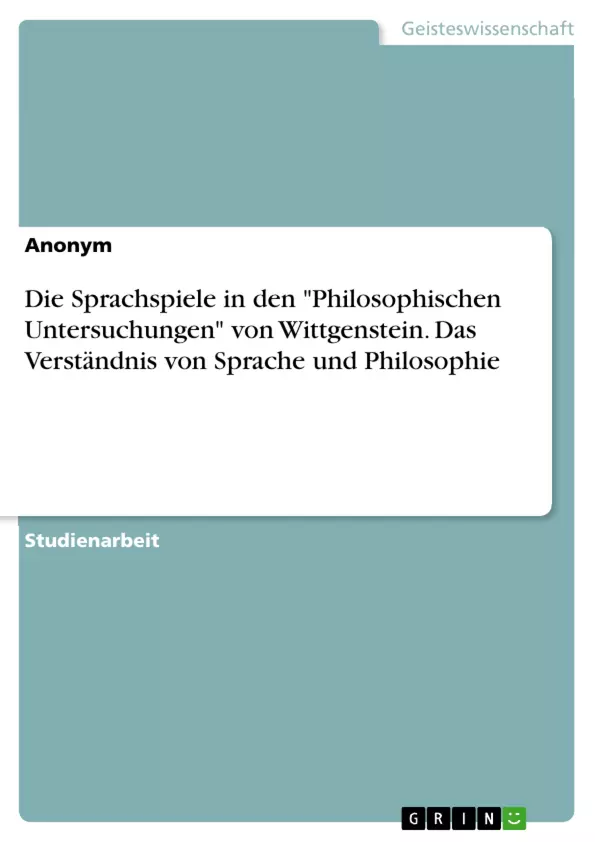In dieser Arbeit soll die Rolle von Sprachspielen in Wittgensteins Philosophie beleuchtet, eingeordnet und interpretiert werden. Dies stützt sich maßgeblich auf die sogenannte Spätphase seiner Philosophie, insbesondere den "Philosophischen Untersuchungen".
Die Arbeit beginnt mit der Klärung von zentralen Begriffen der Philosophischen Untersuchungen, insbesondere die des Sprachspiels, seiner Eigenschaften und Beispiele. Darauf folgt eine Interpretation, in der gezeigt werden soll, welche Implikationen sein Verständnis von Sprache und Philosophie mit sich bringt und gegen welche Denkrichtungen es sich wendet. Abschließend wird sein Werk einer Kritik unterzogen, wobei Stärken und Schwächen seiner Überlegungen abgewogen und abschließend resümiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wittgensteins Sprachspiele
- Sprache und Praxis
- Gebrauchstheorie der Sprache
- Familienähnlichkeiten
- Erlernen und Praxis von Sprachspielen
- Benennungen
- Regeln als Wegweiser
- Praxis des Regelfolgens
- Regeln und das Unbestimmte
- Grenzen und Grenzüberschreitung
- Zum Aufbau und Theorietisiebarkeit, sowie mögliche Kritik an den PU
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Wittgensteins Konzept der Sprachspiele und seine Bedeutung in seiner Spätphilosophie, vor allem in den „Philosophischen Untersuchungen“. Ziel ist es, die Rolle der Sprachspiele in Wittgensteins Denken zu beleuchten und in den Kontext seiner Kritik an traditioneller Philosophie einzuordnen.
- Sprache als ein Konglomerat von Sprachspielen
- Bedeutung von Regeln und Praxis in Sprachspielen
- Kritik an der „idealen Sprache“ und der theoretischen Philosophie
- Der „Gebrauch“ der Sprache und seine Beziehung zu Lebensformen
- Wittgensteins Ansatz im Vergleich zu anderen philosophischen Strömungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Sprachspiele in Wittgensteins Philosophie ein und stellt den Kontext der „Philosophischen Untersuchungen“ dar. Sie betont Wittgensteins Ablehnung einer rein theoretischen Herangehensweise an Sprache und Philosophie.
- Wittgensteins Sprachspiele: Dieses Kapitel erörtert den zentralen Begriff des Sprachspiels in Wittgensteins Werk. Es wird erläutert, wie Sprachspiele den „Gebrauch der Worte“ als ein Spiel verstehen, das bestimmten Regeln folgt und somit Sprache für den Menschen interpretierbar macht.
Schlüsselwörter
Sprachspiele, Philosophische Untersuchungen, Sprachgebrauch, Regeln, Praxis, Lebensformen, Philosophie, Kritik an der theoretischen Philosophie, logischer Positivismus, ideale Sprache, Gebrauchstheorie der Sprache, Familienähnlichkeiten, Wittgenstein, Sprache und Denken.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ludwig Wittgenstein unter einem „Sprachspiel“?
Ein Sprachspiel ist eine Einheit aus Sprache und den Handlungen, in die sie verwoben ist. Es betont, dass die Bedeutung eines Wortes durch seinen Gebrauch in der Praxis entsteht.
Was besagt die „Gebrauchstheorie der Sprache“?
Die Bedeutung eines Wortes ist nicht ein Gegenstand, auf den es zeigt, sondern seine Verwendung innerhalb eines bestimmten Sprachspiels und einer Lebensform.
Was sind „Familienähnlichkeiten“?
Wittgenstein nutzt diesen Begriff, um zu erklären, dass Begriffe nicht durch ein einziges gemeinsames Merkmal definiert sind, sondern durch ein Netz überlappender Ähnlichkeiten.
Welche Rolle spielen Regeln in Sprachspielen?
Regeln fungieren als Wegweiser. Die Praxis des Regelfolgens ist ein soziales Phänomen, das innerhalb einer Gemeinschaft erlernt wird.
Warum kritisiert Wittgenstein die traditionelle theoretische Philosophie?
Er sieht philosophische Probleme oft als Ergebnis von Sprachverwirrungen an, die entstehen, wenn Sprache aus ihrem alltäglichen Gebrauch (Sprachspiel) herausgerissen wird.
Was ist eine „Lebensform“ im Kontext der PU?
Eine Lebensform ist der soziale und kulturelle Hintergrund, der Sprachspielen ihren Sinn verleiht. Sprache zu verstehen bedeutet, eine Lebensform zu teilen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Die Sprachspiele in den "Philosophischen Untersuchungen" von Wittgenstein. Das Verständnis von Sprache und Philosophie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/953470