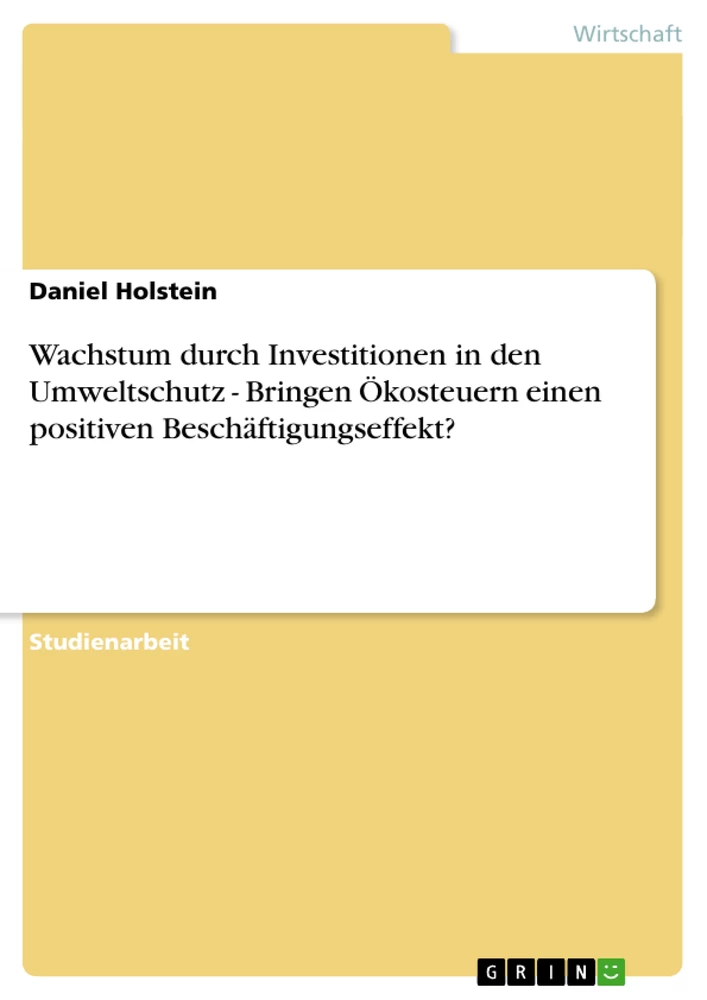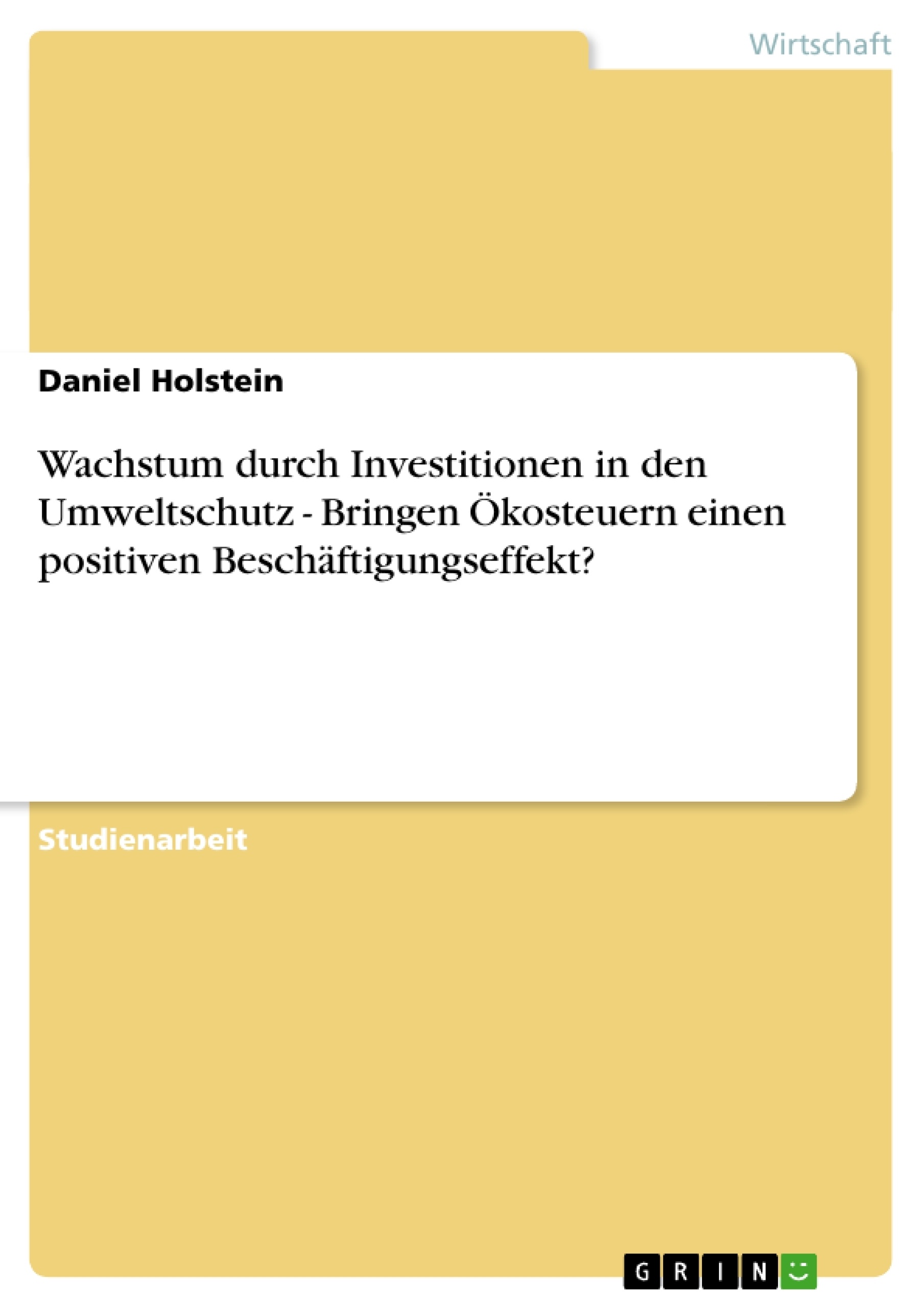Inhaltsverzeichnis
1) Einleitung
2) Wachstum und Beschäftigung
3) Wie Ökosteuern funktionieren sollen
4) Auswirkungen einer ökologischen Steuerreform auf den Arbeitsmarkt
4.2 Innovationseffekt
4.3 Effizienzsteigerung - Modernisierung der Volkswirtschaft
4.4 Studienergebnisse
4.5 Warum sich die Studienergebnisse unterscheiden
4.6 Zusammenfassung
5) Schlußbetrachtung
6) Literaturverzeichnis
Einleitung
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist zu einem der meist diskutierten Bereiche in diesem Land geworden. Grundsätzlich gibt es zwei Wege, die Beschäftigtenzahl zu erhöhen. Einmal durch Wachstum der Volkswirtschatf, zum anderen durch eine Arbeitszeitpolitik. Dabei wird versucht, die vorhandene Arbeit möglichst gerecht auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Arbeitszeitverkürzung, Abbau von Überstunden, Teilzeitarbeit und Job- Sharing sind nur einige wenige Möglichkeiten in diesem Rahmen.
Diese Hausarbeit wird sich vornehmlich mit dem Wachstumspfad auseinandersetzen. Dabei geht es zunächst um den Zusammenhang zwischen Wachstum und Beschäftigung und den daraus resultierenden Problemen, wie der steigenden Umweltbelastung oder dem neueren Phänomen des `Jobless Growth', des Wachstums ohne einen Arbeitsplatzgewinn. Als Alternative werden in diesem Kapitel mit dem Titel `Wachstum und Beschäftigung' das `Qualitative Wachstum' eingeführt und Voraussetzungen für die gesellschaftliche Umsetzung diskutiert. Als ideales Mittel werden dabei die Einführungen von Ökosteuern in das bestehende System gesehen. Dabei wird in Kapitel 3 zunächst einmal das grobe Konzept mit seinen implizierten Effekten dargestellt. Nach dieser Einführung in die Konzeption einer ökologischen Steuerreform kommt es zu einer weitergehenden Betrachtungsweise. Warum soll es zu einer Zunahme der Beschäftigung kommen ? Zunächst wird dabei eher theoretisch argumentiert. Im späteren Verlauf werden mehrere Modellrechnungen zu diesem Thema angeführt - welche sich teilweise gerade hinsichtlich des Beschäftigungseffektes im größerem Umfang unterscheiden. Dieser Umstand wird anschließend reflektiert. Am Ende dieses 4. Kapitels erfolgt eine Zusammenfassung über die Effekte einer ökologischen Steuerreform, auch hinsichtlich der Frage, ob man sie in einem nationalen Alleingang durchführen könnte In der Schlußbetrachtung erfolgt dann nocheinmal eine abschließende Bewertung über die Sinnhaftigkeit von Ökosteuern und es werden Probleme bei ihrer Einführung kurz diskutiert.
Zum Schluß dieser Hausarbeit wurde die Zeit etwas knapp. Gelitten hat darunter einmal die Unterlegung meiner Aussagen mit Quellen. Leider ist es mir auch nicht gelungen vermehrt negative Stimmen zu dem Beschäftigungseffekt und der dahinterstehenden Theorie ausfindig zu machen. Es wird deswegen oft ein Weg vorgezeichnet, ohne das Alternativen diskutiert werden.
Wachstum und Beschäftigung
Das wirtschaftliches Wachstum die Vorraussetzung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze ist, dürfte schon auf den ersten Blick einleuchtend sein. Wenn keiner mehr kauft oder investiert als vorher, warum sollten dann Unternehmen ihre Produktion erweitern und deswegen neue Leute einstellen ? Das Problem sitzt aber noch viel tiefer. In kapitalistischen Wirtschaftssystem streben die meisten Beteiligten nach Gewinn- und Nutzenmaximierung. Praktisch heißt dies, daß Verbraucher immer versuchen werden, daß billigste und beste Produkt zu kaufen. Dementsprechend versuchen die anbietenden Unternehmen ihre Produkte anzubieten, damit sie ihre Marktposition halten oder Anteile neu gewinnen können. Um den Vorsprung vor den Konkurrenten zu halten, muß ständig rationalisiert werden, also die Produktivität erhöht werden. Dies passierte in der Vergangenheit und noch heute dadurch, daß Menschen durch Maschinen ersetzt werden. Unter dem Aspekt der angestrebten Vollbeschäftigung muß jetzt aber die Wirtschaft an anderer Stelle wachsen, damit die aufgrund des fortlaufenden Rationalisierungsprozesses freigesetzten Arbeitskräfte wieder in `Lohn und Brot' kommen können (vgl BINSWANGER,1981,73f). Gerade für ein Land wie die Bundesrepublik ist dies von Wichtigkeit, weil die sozialen Sicherungssysteme aus dem Faktor Arbeit finanziert werden.
Der Rationalisierungsdruck ist dabei in den letzten Jahren aufgrund der Globalisierung der Wirtschaft und den weltweiten Überkapazitäten noch gestiegen, so daß immer stärker an der Entlassungsschraube gedreht wird ( von WEIZSÄCKER,1994,26).
Momentan befinden wir uns in Deutschland in der Situation, daß wir zwar ein Wachstum auf niedrigem Niveau in den letzten Jahren hatten, daraus aber kein positiver Beschäftigungseffekt folgte. Dieser sogenannte `jobless growth', das Wachstum ohne Beschäftigungsgewinn, resultiert aus der stark gestiegen Produktivität in den letzten Jahren. Arbeitsintensive Branchen sind aufgrund des Strukturwandels geschrumpft, andere Unternehmen, gerade in den neuen Technologien die mit wenigen Angestellten große Umsätze machen, sind gewachsen.
In diesem Zusammenhang wäre auch eine reine Arbeitszeitpolitik erfolglos, die sich ausschließlich auf die Umverteilung von Arbeit konzentriert, weil sie keine echten neuen Arbeitsplätze schaffen würde und der Abbau weiter gehen würde.
Das oben beschriebene mengenmäßige oder auch quantitative Wachstum der Volkswirtschaft ist momentan weder sehr erfolgreich im Hinblick auf die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, noch steht diese Wirtschaftsweise im Einklang mit der Natur. Die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden gefährdet nachhaltig die Grundlagen, auf denen sich der Mensch bewegt. Das größte Problem dabei ist der sogenannte Treibhauseffekt.
Durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Öl und Kohle wird Kohlendioxid freigesetzt, was zu einer Aufheizung der Erdatmosphäre führt mit vielfältigen Folgen.
Schon 1972 hat der Club of Rome (MEADOWS,1972) eine absehbare Grenze unseres bisher praktizierten Wachstums prognostiziert. Doch entscheidend geändert hat sich nichts im Umgang mit den Ressourcen dieser Erde und seinem Ökosystem.
Das Landesinstitut für Schule und Bildung in NRW (www.learn-line.de/) hat einmal, gestützt u.a. auf die Berechnungen von LEIPERT ( 1989), ausgerechnet, was wir bereits heute ausgeben,um die negativen sozialen und ökologischen Folgewirkungen von Produktion und Konsum auszugleichen. Diese Ausgaben für die sogenannten `Defensiven Kosten' beinhalten z.B. Umwelterhaltungskosten, Umweltschäden an Mensch und Tier, Kosten der Urbanisierung oder die Abfallbeseitigung. Sie sind von 5.6% 1970 auf 12.8% des Bruttosozialproduktes im Jahre 1991 gestiegen und sind somit um das dreifache des BiP- Anstieges gewachsen (Zeitschrift für angewandte Umweltwissenschaft, 1996, 121f). Das Problem bei diesen defensiven Ausgaben ist, daß sie sich negativ auf die Preise auswirken und Teile des Produktivitätszuwachses egalisieren. Die erreichte Produktivitätssteigerung muß wieder teilweise für neue Filteranlagen, Kläranlagen oder die gestiegenen Kosten für die Müllbeseitigung ausgegeben werden. So kann sich im Laufe der Zeit ein Wettbewerbsnachteil herauskristallisieren, der langfristig den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet.
Einen Ausweg aus dieser Situation - wir brauchen Wachstum, um die Beschäftigtenzahl zu erhöhen, aber kein quantitatives - ist der Weg des qualitativen Wachstums. Darunter wird folgendes verstanden :
-> ,,Qualitatives Wachstum meint ... eine reale Erhöhung des Angebots von Gütern, die das Leben lebenswerter machen, also nicht einfach der Vergeudung dienen oder Schäden verursachen, deren Behebung mit Kosten verbunden ist, die den Ertrag aus der Produktion der Güter übersteigt."
(BINSWANGER,1981,81)
-> das zweite wesentliche Element eines qualitativen Wachstums ist die Entkopplung des Sozialproduktwachstums mit dem Energie- und Rohstoffverbrauch, also mit einer Senkung des Energie- und Materialverbrauchs pro Produktionseinheit . Ziel sollte dabei sein, daß nicht mehr Rohstoffe aus der Natur verbraucht werden, als diese im gleichen Zeitraum wieder bereitstellen kann bzw. nicht mehr Abfall- und Schadstoffe emittiert werden, als die ökologischen Kreisläufe verarbeiten können. Trotz dieser Entkopplung ist Wirtschaftswachstum immer noch möglich,
,, können Investitionen getätigt, Gewinne erzielt und wenn möglich Lohnerhöhungen vorgenommen werden, aber nicht mehr allein durch Forcierung der Arbeitsproduktivität und des Ressourcenverbrauchs." (BINSWANGER,1981,82) Wie können die Ziele eines qualitativen Wachstums verwirklicht werden ?
In der Anfangszeit , als man allmählich in einer breiten Öffentlichkeit die Gefährlichkeit der heutigen Wirtschaftsweise erkannte, hoffte man noch, daß der Mensch aus eigenem Interesse zu einer Verhaltensänderung kommen würde. Bei einigen war auch das der Fall, doch die Mehrzahl der Betroffenen änderte ihre Lebensweise kaum.
Was als Umsteuerungsmöglichkeiten von staatlicher Seite noch bleiben sind gesetzliche Verordnungen und erhöhte steuerliche Belastungen.
In derBundesrepublik begegnete man der steigenden Umweltverschmutzung zunächst mit dem Ordnungsrecht, also der Festlegung von einzuhaltenden Grenzwerten, Nachweispflichten, Prüfungen, Sanktionen und ähnliches. Diese Maßnahmen sind meistens am Ende der Produktionskette angesiedelt und animieren nicht zu Optimierungslösungen. Gleichzeitig können sie kurzfristig zu Wettbewerbsnachteilen führen, weil erhöhte Ausgaben für den Umweltschutz auf die Verkaufspreise Auswirkungen haben. Diese Out-Put oder sogenannten `end-of-pipe'- Maßnahmen wird es auch weiterhin noch geben müssen, aber mittlerweile sind intelligentere Lenkungssysteme entwickelt worden mit dem Anspruch, daß wenn man clever ist an Investitionen in den Umweltschutz noch verdienen kann. Der Anreiz dazu erfolgt über eine InPut- Besteuerung der verbrauchten Güter die die Umwelt nachhaltig schädigen, wie z.B. Öl oder Kohle. Man versucht also die Subjekte am Markt dazu zu bewegen von vorneherein weniger Ressourcen zu verbrauchen, damit am Ende ein geringerer schädlicher Out-Put steht. Es müssten zwar am Anfang vermehrt Investititionen in energie- und rohstoffsparende Maßnahmen getätigt werden, doch nach einiger Zeit würden sich diese wieder amortisieren, weil ja weniger ausgegeben werden muß für Energie und Rohstoffe.
In den letzten Jahren ist das Konzept von solchen Ökosteuern verstärkt in die öffentliche Diskussion getreten. Sie haben den Anspruch gleichzeitig die Umwelt nachhaltig zu entlasten, was auf die Dauer zur Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschlands beiträgt, als auch mittelfristig positiven Einfluß auf den Arbeitsmarkt zu haben. Im folgenden soll dieses Konzept erläutert werden
3) Wie Ökosteuern funktionieren sollen
Steuerlich belastet werden soll in erster Linie die Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Benzin und Gas. In einigen Konzepten (Bündnis'90/ Grüne) gibt es darüber hinaus auch eine Belastung des Stroms aus Kernkraftwerken. Darüber hinaus gibt es Überlegungen für eine höhere Besteuerung von Flächenverbrauch, Abfall, Wassernutzung und bestimmten Schadstoffausstößen. Die Verteuerung erfolgt dabei nicht auf einmal, sondern in jährlichen Steigerungsraten, wie z.B. im DIW-Modell (1994) mit realen 7% über 10 Jahre.
Öko-Steuern basieren auf dem Verursacherprinzip: Durch die höhere Besteuerung von Energieträgern sollen die Preise die 'ökologische Wahrheit' sagen. Derzeit tauchen die volkswirtschaftlichen Kosten, die z. B. durch den Verkehr entstehen, nirgends auf. Sie werden von der Allgemeinheit bezahlt. Darunter fallen z.B. die Kosten für Gebäudeschäden, Lärm, Unfälle oder aber die Behandlung von Atemwegserkrankungen. Das Umweltbundesamt (1997) hat die externen Kosten durch den Verkehr für das Jahr 1994 einmal ausgerechnet ( zusammengefaßt in www.wuppertal-forum.de/ wuppertal- bulletin/WBd/WBd_3_97/JL_PV_1.htm ). Danach liegen sie in einer Größenordnung von 130Mrd. DM pro Jahr. Die verkehrsbezogenen Steuern addieren sich auf ca. 70 Mrd. DM p.a. Zieht man steuerliche Subventionen ( Mineralölsteuerbefreiung für die Luftfahrt und die gewerbliche Schiffahrt, Sonderab- schreibungen, Gasölverbilligungen etc.) ab, ergibt sich netto eine "unbeglichene Rechnung" von etwa 70 Mrd. DM im Jahr . In diesem Zusammenhang ist auch die geforderte Benzinpreiserhöhung der Grünen zu verstehen, die sehr viel Unverständnis ausgelöst hat. Mittlerweile gibt es mehrere Vorschläge über die Höhe der Besteuerung. Sie reichen von ,,10 MRD ( Wirtschaftsminister Rexrodt ) bis rund 300 Mrd. DM (Grüne). Während Rexrodt nach 10 Jahre den Preis für die KiloWatt- Stunde Strom um 3Pf angehoben hätte, würden die radikalsten Vorschläge (DIW/ Grüne) im gleichen Zeitraum zu einem Aufschlag von 11 Pfennig führen. Der Liter Benzin wäre nach 10 Jahren durch das DIW- Modell um 38 Pf, durch das FÖS- Modell um 75 Pf und nach dem der Grünen um etwa 3.50 DM teurer."(WOLF/ KRÄMER, 1995,1073)
Öko-Steuern sind nach den meisten Konzepten aufkommensneutral. Das bedeutet, die Einnahmen durch die Energiesteuer werden in voller Höhe, aber an anderer Stelle, den Arbeitnehmern und Arbeitgebern wieder zurückgegeben (Rückerstattung). Indem Umwelt stärker und Arbeit weniger belastet wird, sollen Kilowattstunden und nicht länger Menschen arbeitslos gemacht werden. Eine solche Umschichtung im Steuersystem ist der Grundgedanke einer Ökologischen Steuerreform. In diesem Zusammenhang wird auch von einer doppelten Dividende gesprochen - weniger Umweltbelastung gekoppelt mit mehr Beschäftigung.
Gleichzeitig soll es auch zu einem Innovationsboom bei den regernativen Energien und bei den Energieeinspartechniken kommen, was sich wiederum positiv auf die Exportchancen in diesen Bereichen , die im `Kommen' sind, auswirkt.
Bei den Rückerstattungsmodellen kristallisieren sich in letzter Zeit folgende Möglichkeiten heraus . Auf der Arbeitgeberseite sollen die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt werden. Auf der Arbeitnehmerseite entweder auch dies oder die Senkung der Einkommenssteuer, so daß im Endeffekt ein höherer Nettolohn bleibt. Bei Rentnern, Studenten, Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern, die nicht von der Senkung der Lohnnebenkosten oder Einkommenssteuer profitieren, sollen die staatlichen Zuweisungen (Bafög, Rente ...) erhöht werden, damit sie nicht zu den Verlierern einer ökologischen Steuerreform werden. Ursprünglich wurde noch an eine Senkung der Mehrwertsteuer gedacht. Doch mittlerweile gibt es auf EU- Ebene feste Vereinbarungen, daß sich die Sätze mittelfristig angleichen sollen. Da Deutschlands Mehrwertsteuersatz zu den niedrigsten in der ganzen Union gehört, fällt diese relativ aufwandslose Möglichkeit weg.
Als geistiger Vater von Ökosteuern kann der englische Ökonom Artur C. Pigou genannt werde. Er hatte bereits 1920 empfohlen eine Steuer in Höhe der Differenz zwischen den privaten und volkswirtschaftlichen Kosten der Umweltschäden zu erheben. Diese nach ihm benannte Pigou-Steuer soll die Verursacher aus finanziellen Eigeninteresse dazu animieren, die besteuerten Umweltbelastungen abzubauen, bis ihre Vermeidungskosten genau den eingesparten Steuern entsprechen.
In der `neueren' Zeit war es vor allen Dingen BINSWANGER, der als erster anfang der 80er Jahre mit dem Vorschlag aufwartete, das eingenommene Geld aus Steuern auf den Umweltverbrauch zur Bezuschussung der Rentenkasse zu nutzen. Richtigen Schwung und eine Beachtung in der breiten Öffentlichkeit bekam die Debatte um eine ökologische Steuerreform im Jahre 1994, nachdem das Deutsche Institut für Wirtschaft (DIW) im Auftrag von Greenpeace zu einem positiven Fazit im Hinblick auf ihre allgemeinen wirtschaftlichen Auswirkungen kam. Danach ist es wieder relativ ruhig geworden -bis zur Erstellung des Wahlprogrammes der Grünen ( März `98) , welches eine deutliche Spritpreiserhöhung im Rahmen einer ökologischen Steuerreform vorsieht .
Die politischen Akteure im Bonner Parlament haben, wie nicht anders zu erwarten war, unterschiedliche Bewertungen und Vorschläge zu Ökosteuern. Während die Grünen und die SPD in geringerem Volumen nachdrücklich für die Einführung einer ökologischen Steuerreform plädieren, sieht man im Regierungslager sehr viel Verzagen. Die FDP sieht in ihren Programmentwürfen eine sehr gering dosierte Einführung vor, die ausschließlich auf den privaten Verbrauch gerichtet ist. In der CDU zeichnet sich in den letzten Jahren ein Wandel ab , doch wird aus wahltaktischen Gründen eine ökologische Reform des Steuerwesens vor sich hergeschoben. Die CSU kann als der der größten Gegner einer ÖSR im Bundestag bezeichnet werden.
Auf EU- Ebene gab es schon mehrere Vorstöße zur Einführung von Ökosteuern, der letzte `ernsthafte' scheiterte 1994. Momentan geht eher das Bestreben dahin, die Energiebesteuerungssätze anzugleichen, was für Deutschland aber keine wesentlichen Auswirkungen hätte, da man auf diesem Gebiet zu den Spitzenreitern gehört. ( Die Woche,4.4.97,18)
Trotzdem steht es auch nach Verwirklichung des Binnenmarktes den einzelnen Mitgliedsländern zu, Ökosteuern nach eigenem Ermessen einzuführen. Dänemark, Schweden, die Niederlande, Finnland, Österreich und Belgien sind dabei als Vorreiter zu sehen. Doch geht die Ensthaftigkeit dieser Ansätze nicht sehr weit, wie RIBBE/SEIFERT (1995) im Wuppertal- Bulletin zitiert werden :
,,Marktwirtschaftliche Instrumente im Umweltschutz gibt es bereits in vielen Ländern Europas. Die bisher eingeführten Regelungen sind vornehmlich geeignet, sektoral Detailprobleme zu lösen bzw. für Steuereinnahmen zu sorgen. Ein wirklich umfassender Ansatz, um über Ökosteuern einen grundlegenden Wandel des Wirtschaftssystems zu erzielen, ist allerdings nicht erkennbar."(www.wuppertal-forum.de/wuppertal- bulletin/WBd/WBd_3_96/WB_3_96_JV_NP_III.htm)
Deswegen ist es auch schwer, aufgrund der Erfahrungen in diesen Ländern etwas über einen möglichen Beschäftigungseffekt zu konstatieren.
4) Auswirkungen einer ökologischen Steuerreform auf den Arbeitsmarkt
Grundgedanke bei der Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen einer ökologischen Steuerreform ist die Umschichtung der Steuereinnahmen weg vom Faktor Arbeit hin zum Ressourcenverbrauch.
Lohnsteuer, Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung haben die Kosten der Arbeit immer weiter in die Höhe gerieben: Ihr Anteil am Steueraufkommen stieg von 53,7 Prozent (1970) auf 65,6 Prozent (1996). Im gleichen Zeitraum ist die steuerliche Belastung des Ressourcenverbrauchs (das sind im wesentlichen die Steuern auf Mineralöl und Kraftfahrzeuge) von sieben auf 5,5 Prozent gesunken. Es ist also immer teurer geworden, Arbeitskräfte einzustellen, und immer billiger, die Umwelt zu verschmutzen. Die gleiche Entwicklung läßt sich auch in den anderen OECD- Staaten feststellen. Bei einer jährlichen Anhebung der Energiesätze um 7% errechnen KREBS/ REICHE, daß der Steueranteil auf den Umweltverbrauch von heute 5.5% auf 13.6% bis zum Jahr 2008 steigen wird. Gleichzeitigt kommt es zu einer Entlastung des Faktors Arbeit auf 58.2 %. ( vgl. KREBS/REICHE,1998,56)
Warum kann diese Steuereinnahmen- Umschichtung NettoArbeitsplätze bringen ?
Wie bereits im 2. Kapitel ausgeführt ist die Gewinnmaximierung ein grundlegendes Element einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, d.h. es werden vielfältige Anstrengungen unternommen die Effizienz zu steigern und Einsparungen vorzunehmen, um Marktpositionen zu halten oder zu gewinnen. . In der Vergangenheit kam es dabei meistens zu den sogenannten Rationalisierungsinvestitionen I, wobei der teure Faktor menschliche Arbeitskraft durch Maschinen bzw. billigere Energie ersetzt wurde ( Investitionen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität).
Durch die Änderungen im Steuersystem soll nun den Unternehmen der Anreiz gegeben werden, ihre Gewinnmaximierunsstrategien auf die Einsparung von Energie zu konzentrieren. Unter den neuen Konstellationen kann es jetzt dazu kommen, daß zur Senkung der Stückkosten und des Unternehmenserfolges eher der Energie- / Ressourcenverbrauch durch die Anschaffung neuer Maschinen und Technologien gesenkt wird, als das Menschen entlassen werden (Rationalisierungsinvestitionen II - ressourcen und energiesparende Investitionen) (BINSWANGER,1981,77f). Das Geld für diese andere Art der Investition fehlt nicht im gesamtwirtschaftlichen Kreislauf, da eine ökologische Steuerreform aufkommensneutral wäre.Als ersten theoretischen Effekt könnte man also nennen, daß es durch eine ökologische Steuerreform zu keinen nenneswerten Arbeitsplatzverlusten kommen wird, bzw. daß vorhandene Tendenzen zur Abeitsplatzrationalisierung entgegengewirkt wird. Wo bleibt aber der prognostizierte positive Beschäftigungseffekt ?
Dieser entsteht dadurch, daß es durch eine ökologische Steuerreform zu einer Nachfrageverschiebung hin zu arbeitsintensiveren Produkten kommt.
,, Grund für den Arbeitsplatzgewinn ist, daß die konventionelle Energiewirtschaft überdurchschnittlich kapitalintensiv ist. Das bedeutet, daß sie ihre Produkte und Gewinne hauptsächlich mit Maschinen erwirtschaftet und nur wenig menschliche Arbeitskraft einsetzt." ( KREBS/REICHE,1998,73).
Sowohl eine nachhaltige Energiewirtschaft als auch der vermehrte Einsatz von Energiesparmaßnahmen sind wesentlich arbeitsintensiver.
So betrug die Wertschöpfung pro Beschäftigter in der Energiewirtschaft 1995 295.000DM, im Bauinstallationsgewerbe ( u.a. Elektro-, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation) hingegen 77.000 DM bei einem Beschäftigten (Statistisches Jahrbuch 1997). Das Baugewerbe wäre eines der größten Gewinner einer ökologischen Steuerreform. Wenn man nun die Zahlen aus dem Statistischen Jahrbuch hochrechnet, müßten bei gleicher Wertschöpfung im Vergleich zur herkömmlichen Energiewirtschaft 3 Nettoarbeitsplätze mehr entstehen. Netto, weil die Energieversorgung mit ihrer Großtechnologie, wir wir sie heute kennen, einem großen Schrumpfungsprozess ausgesetzt sein wird. Das gleiche gilt auch für den Maschinenbau, der in Folge einer Steuerreform mit mehr Aufträgen für energie- und ressourcensparende Maschinen rechnen müßte. Hier beträgt das Verhältnis zur Energiewirtschaft in puncto Wertschöpfung pro Beschäftigter etwa 2 zu 1 (Statistisches Jahrbuch,1997,194).
Problematisch wären die Auswirkungen einer ökologischen Steuerreform auf energieintensive Branchen wie Stahl, Eisen, Papier oder die Grundstoffchemie. Verteuerte Energiepreise würden gerade ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit einschränken. Dies gilt besonders für die Chemieindustrie,die wegen ihrer `Leistungsstärke' einer der deutschen Schlüsselbranchen ist. In diesem Zweig ist es aufgrund des Druckes des Weltmarktes von einer Qualitätskonkurrenz zu einer Preiskonkurrenz gekommen ( ROBINET/ LUCAS,1994,13), wo jede höhere steuerliche Belastung zu Wettbewerbsnachteilen führt.
Deswegen fordert z.B. die Enquete- Kommission `Schutz der Erdatmosphäre' des Deutschen Bundestages (1993), daß diejenigen Sektoren von einer Energiesteuer befreit werden, deren Energiekostenanteil über 3.75% des Bruttoproduktionswertes liegt und deren Exportanteil über 15% des Umsatzes ausmacht.
Mittlerweile geht die Diskussion eher in die Richtung, diese Unternehmen nur bis zu einem gewissen Prozentanteil, z.B. 3.75% zu besteuern, damit sie auch ein ökonomisches Interesse an der Energieeinsparung `bekommen'. Ein anderer Ansatz ist die Änderung des Einkommens- und Körperschaftssteuerrecht für energieintensive Branchen. Jede Energieeinsparung könnte dann zu einem steuerfreien Gewinn gemacht werden (SCLEGELMILCH/GÖRRES,1996,121f).
Ökologisch als auch ökonomisch sind diese Ausnahmeregelungen zu vertreten, weil bei einer Abwanderung ins Ausland die Arbeitsplätze auf lange Sicht verloren wären, zum anderen aber anzunehmen ist, daß die globale Umweltbelastung steigt, weil Deutschland zu den Ländern mit den höchsten Umweltstandards gehört.
Neben den Branchen die von den ausgelösten Energiesparmaßnahmen profitieren, gibt es aber auch noch andere wirtschaftliche Bereiche, die von einer ökologischen Steuerreform profitieren. Hier sind in erster Linie arbeitsintensive Unternehmen im Dienstleistungsbereich gemeint. Durch die Senkung der Arbeitgeberbeiträge bei der Sozialversicherung haben sie einen Nettogewinn, wenn man vorher die gestiegenen Energiekosten abzieht. Hintergedanke ist nun, daß sie ihre Vorteile auf die Preissenkung ihrer Produkte umlegen und diese wiederum mehr nachgefragt werden, mit dem Effekt das mehr Leute eingestellt werden, weil mehr produziert bzw. bereitgestellt werden muß.
MEINECKE (1997) hat einmal für die verschiedene Ökosteuer-Modelle durchgerechnet, was arbeitsintensive Betriebe wie die Quelle Schickedanz AG, die Steilmann GmbH sowie die AEG Haushaltsgeräte GmbH durch die Rückerstattungssätze gewinnen. Auf der Belastungsseite rechnet er die gestiegenen Kosten für Strom und den Raumwärmebedarf ein, als auch die evtl. gestiegenen Kosten der Vorlieferer. Die Kompensationsseite wird durch die Reduktion der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung berücksichtigt. Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen :
,,Quelle könnte unter Einbeziehung der Transporte je nach ÖSR-Vorschlag bereits im ersten Jahr zwischen DEM 1 Mio. (FÖS) und DEM 7 Mio. (BUND) an Kosten einsparen. Kumuliert über zehn Jahre unter Beachtung von steigenden Steuersätzen betrüge die Entlastung zwischen DEM 53 Mio. (B90/Die Grünen) und DEM 181 Mio. (DIW). Steilmann könnte in den deutschen Produktionsbetrieben im ersten Jahr eine Nettoentlastung von DEM 0,2 Mio. (FÖS) bis zu DEM 1,5 Mio. (BUND) erzielen, kumuliert auf zehn Jahre betrüge die Einsparung DEM 14,5 Mio. (FÖS) bis zu DEM 43 Mio. (BUND).
AEG könnte nach den Berechnungen des BUND eine Entlastung von DEM 4,5 Mio. im ersten Jahr verbuchen." (www.wuppertal-institut.de/WBd/WBd_3_97/JL_NP_1.htm)
Die Einführung einer ökologischen Steuerreform könnte man auch als einen kleinen Schritt in Richtung einer Dienstleistungsgesellschaft verstehen. Dem Bereich, wo bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in puncto neue Arbeitsplätze die meisten Chancen gesehen werden. Der Dienstleistungsbereich ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ unterentwickelt, weil hier u.a. die hohen Lohnnebenkosten eine Bremsfunktion wahrnehmen.
Der grüne Aachener Umweltdezernet JÜTTNER (1995, 60) bestreitet den Zusammnehang von Senkung der Lohnnebenkosten und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit. Diese Senkung sei viel zu gering, um wirklich entlastend für die Unternehmen zu wirken. So bräuchte man 20 Mrd DM um die Personalkosten bei den Arbeitgebern um 1% zu senken, was sich wiederum nur in einem 0.3% preislichen Rückgang beim Endprodukt bemerkbar machen würde. Jüttner meint deswegen, daß positive Wachstumseffekte eher durch eine teilweise Investition der Ökosteuer- Einanhmen in den ÖPNV zu realisieren sein. Doch damit nimmt er eine Minderheitenmeinung in der Debatte ein. Besser nach KREBS/ REICHE (1998,87) sei es, die Mehreinnahmen des Staates durch die verringerte Arbeitslosigkeit für solche Zwecke zu verwenden. Hier wären auch Flankierungsmaßnahmen von besonders betroffenen Regionen und Sektoren zu berücksichtigen. Aufgrund ihrer Berechnungen, gestützt auf Daten des IAB kommen KREBS/ REICHE bei jeweils 100.000 neuen Stellen auf 4 Mrd DM zusätzliche Einnahmen seitens des Staates (weniger Unterstützung für die Bundesanstalt für Arbeit und mehr Einnahmen in den Sozialver- sicherungskassen)
4.2 Innovationseffekt
Es ist u.a. ein erwarteter Effekt einer ökologischen Steuerreform, daß aufgrund der steigenden Preise im Energiebereich, neue Maschinen, Technologien und Maßnahmen entwickelt und auf den Markt gebracht werden, weil dort eine Nachfrage besteht. Einmal in den Produktionsprozessen der Unternehmen, um ihre Fertigungskosten zu senken und zum anderen soll es Produktinnovationen geben, ausgelöst durch ein geändertes Nachfrageverhalten der mit erhöhten Umweltabgaben belasteten Haushalte. Für neue Produkte bedarf es eines erhöhten Forschungsaufwandes, welcher die Vorraussetzung für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie darstellt. Eine Studie, die diesen Zusammenhang stützen kann, ist die von RECHSTEINER (1993,310f).
Er zeigt auf, daß es scheinbar eine Verbindung gibt von hohen Energiepreisen und dem wirtschaftlichen Erfolg eines Landes. Den Wirtschaftserfolg bestimmt er als Mischparameter aus Wirtschaftswachstum, Patentanmeldungen, Leistungsbilanz und Energieverbrauch.
,, Die Untersuchung [RECHSTEINER]legt die Hypothese nah, daß hohe Energiepreise energiesparende Innovationen fördern, was wiederum zu einem geringeren Energieverbrauch und schließlich auch zu steigender Exporttätigkeit führt." (www.learn-line.nrw.de/themen/ecoeco/dok/rechst.htm)
Diese Aussagen werden durch zwei Erfahrungen aus der Vergangenheit bestätigt. Nachdem die TA Luft beschlossen wurde, mußten viele deutsche Unternehmen teure Filteranlagen aus Japan kaufen, um ihre Emissionen zu verringern. Japan hatte in diesem Fall einen sogenannten `First Mover Advantage', weil sich ihre Industrie schon viel früher mit der Reinhaltung der Luft `auseinandersetzen' mußte (SCHLEGELMILCH,1994,139f). Sowohl energieeinsparende Techniken als auch die regenerativen Energien werden einer der großen Märkte der Zukunft sein. Wer als erster hier richtig anfängt zu forschen hat am Ende die Nase mit den besten Produkten vorne und hat dementsprechende Beschäftigungsgewinne. Ein anderes Beispel sind die erfolgten Einsparerfolge nach dem Ölpreisschocks in den 70er Jahren.
,, In Folge des Ölpreisschocks in den 70er Jahren ist etwa die Produktion von 10 Energieeffizienztechniken (u.a. Brenner, Gasturbinen, Wärmepumpen und Heizkessel) im Zeitraum von 1976 bis 1990 um 75% auf 7.2 Mrd Mark (in Preisen von 1985) gestiegen und lag damit beträchtlich über dem Durchschnitt des Produktionszuwachses des verarbeitenden Gewerbes in jener Zeitperiode." (KREBS/REICHE,1998,72)
4.3 Effizienzsteigerung - Modernisierung der Volkswirtschaft
Der Innovationseffekt hinsichtlich weiterer Energieeinsparmaßnahmen kann nur schwer eingeschätzt werden. Was dagegen gut quantifizierbar ist, sind die Einsparmöglichkeiten die mit heutigem Wissensstand und Techniken bereits zu realisieren sind. So schätzt z.B. das WUPPERTAL-INSTITUT/ ÖKO-INSITUT (1994,21), daß sowohl unser privater und öffentlicher, als auch industrieller Energieverbrauch um 45% senkbar wäre. Ernst Ulrich von Weizsäcker und Amory Lovins ( 1995) haben außerdem versucht in ihrem vielbeachteten Buch `Faktor 4' aufzuzeigen, daß die Mehrzahl unserer Produkte und Dienstleistungen mit nur einem viertel des heute benötigten Energiebedarfes bereitgestellt werden könnten. Das Einsparpotential an Energie existiert schon heute, was ein Faktor beim Gelingen einer ökologischen Steuerreform hinsichtlich des Beschäftigungseffektes wäre. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die Energieverteuerung nicht zu gering und nicht zu schleichend ausfällt. Sonst könnte es passieren, das Haushalte und Unternehmen nicht investieren in Einspartechniken, weil ihnen der (zeitliche) Aufwand im Verhältnis zum Gewinn zu gering erscheint.
Auch langfristig hat eine Effizienzrevolution ,angestoßen durch eine Steuerreform, einen Effekt auf die Volkswirtschaft. Wie bereits in Kapitel 2 ausgeführt, wird ein Teil des Produktivitätwachstums wieder durch steigende Umweltausgaben egalisiert. Wenn es geschafft werden könnte, diese sich gegenseitig bedingenden Faktoren zu entkoppeln (siehe `qualitatives Wachstum'), dann wäre dies ein großer Schritt in Richtung `zukünftige Wettbewerbsfähigkeit'.
Hier wäre aber auch eine erhöhte steuerliche Belastung von Müll und Wasser gefragt.
4.4 Studienergebnisse
Nach der theoretischen Erläuterung warum eine ökologische Steuerreform Arbeitsplätze bringen kann, geht es jetzt darum zu gucken, was finanzwissentschaftliche Modellrechnungen prognostizieren. Sie versuchen gesellschaftliche Realität zu simulieren oder anders formuliert wer und was wie reagiert, wenn bestimmte Variablen im System verändert werden. Die Glaubwürdigkeit solcher Untersuchungen ist zwar schwer nachvollziehbar, weil jeder mit bestimmten Annahmen alles ausrechnen kann, als auch der Schwierigkeit Realität in ein mathematisches Modell zu packen - doch kann man gewisse Tendenzen ausmachen, gerade wenn man mehrere Studien berücksichtigt.
Im folgenden werden 3 Untersuchungen ausführlicher vorgestellt, die sich hinsichtlich ihrer Ergebnisse stark unterscheiden. Ergänzt wird dies durch eine kurze Auflistung der noch existierenden Untersuchungen zum Thema Beschäftigungseffekte von Ökosteuern . Anschließend erfolgt eine Analyse warum sich die Ergebnisse der einzelnen Studien teilweise sehr weit voneinander entfernen.
A) DIW- Studie
Die Studie die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag von Greenpeace erstellt hat ist wohl das bekannteste seiner Art, auch weil es die erste durchgerechnete Modellversion zu den wirtschaftlichen Folgewirkungen einer ökologischen Steuerreform war.
Das DIW Modell bezieht sich auf einen fiktiven Grundpreis von 9 DM je Gigajoule für alle Energieträger, ausgenommen den regenerativen. Dieser Grundpreis wird jährlich real um 7 % gesteigert auf einen Zeitraum von 10 Jahren. Dadurch würde das erwartete Steueraufkommen nach 8.6 Mrd DM im ersten Jahr auf über 120 Mrd DM im letzten Jahr der Berechnung steigen ( bezogen auf Preise von 1990 ).Die Rückerstattung kommt zu rund 70% den Arbeitgebern durch Senkung ihrer Sozialvericherungs- Beiträge zugute. Die restlichen 30% werden durch einen sogenannten `Öko-Bonus' pro Kopf ausgeschüttet. Als positiven Beschäftigungseffekt werden 610.000 Tsd neue Stellen errechnet, im Vergleich zu einer Entwicklung ohne eine ÖSR. Methodisch gab es Kritik seitens anderer Forschungsinstitute. So würde das Modell zu wenig auf die Außenhandelsbeziehungen eingehen und sich auf sektorale und regionale Folgewirkungen überhaupt nicht beziehen. Dies gelte besonders für die Stahl- und Eisenbranche.
B) RWI- Studie
Der Titel der 1996 erschienen Studie lautet : `Regionalwirtschaftliche Wirkung von Steuern und Abgaben auf den Verbrauch von Energie - das Beispiel NRW `. Auftraggeber war das Düsseldorfer Wirtschaftsministerium. Bei der Studie geht das RWI von einer progressiv ansteigenden Steuer aus, um jährlich real 7%. Ausnahmeregelungen für energieintensive Sektoren wurden nicht berücksichtigt. Als Folgewirkungen werden 400.000 wegfallende Stellen prognostiziert, wobei 236.000 Tsd alleine auf die Eisen- und Stahlbranche entfallen. Der Jobverlust in den `Verliererbranchen' einer ÖSR wird wesentlich höher als der Jobgewinn in `Gewinnerbranchen' eingeschätzt. (www.wuppertal-institut/wb/wb3_96)
,, Zu hoffen, daß sich mit der Verteuerung des Faktors Energie über einen wie auch immer gearteten Marktmechanismus quasi automatisch neue Arbeitsplätze schaffen lassen, wäre nicht nur naiv, sondern wirtschaftlich unverantwortlich."
resümiert das RWI. Die Reaktion des Auftraggebers, Wolfgang Clement war eindeutig :
,, Eine Ausgestaltung einer neuen Energiesteuer in den Formen, wie sie in der RWIStudie analysiert wurden, kann nicht ernsthaft gewollt werden." ( beide Zitate : www.wuppertal-institut/wb/wb3_96)
C) `Meyer'-Studie
Sehr großes Aufsehen erregte eine Studie des Ökonomen Bernd MEYER u.a.
( 1997,www.oec.uni-osnabrueck.de/fachgeb/makro/co2paper.html) mit dem Titel `Was kostet eine CO2- Reduktion'. Mit ihrer Modellsimulation PANTA RHEI (`alles fließt'), daß mit über 10.000 Gleichungen rechnet, haben sie die bisher umfangreichste Analyse zu den Folgewirkungen einer ÖSR vorgelegt. Im einzelnen erklärt das Modell für jede Branche (58) die Entwicklung bestimmter Einflußfaktoren wie Löhne, Materialeinsätze, Investitionsnachfrage, Ex- und Importe, Gewinne, Vorleistungslieferungen, Konsumnachfrage sowi die Preise im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang. Als Ergebnis wird ein positiver Beschäftigungseffekt von 1.5Mio neuen Stellen ausgewiesen. Grund sei hier vor allen Dingen, daß bei der Rückerstattung auschließlich die Arbeitgeber in Form einer Senkung ihrer Sozialversicherungs-Beiträge bedacht werden. Bei einer paritätischen Senkung sowohl der Arbeitgeber als auch Arbeitnehmeranteile an den Sozialversicherungsbeiträgen käme es `nur' zu einem Arbeitsplatzgewinn von 600.000 Tsd Stellen. Bei einer ausschließlichen Entlastung der Haushalte würde es einen negativen Beschäftigungseffekt geben. Nicht berücksichtigt bei den Berechnungen wurde die Entwicklung auf dem Solarstromsektor, weil hier keine verläßlichen Daten vorlagen.
Der Umfang der steuerlichen Belastung ist im Vergleich zu anderen Studien sehr hoch.
Leider wurde keine Einschätzung über die Seriösität dieser Studie gefunden, was nicht heißt, daß es sie nicht gibt.
/// an dieser Stelle erfolgt eigentlich eine tabellenartige Aufstellung weiterer Studien über den Beschäftigungsefffekt einer ÖSR. Kann ich bei Bedarf an eure Mail- Adresse schicken (daniel.holstein@post.uni-bielefeld.de) ////
4.5 Warum sich die Studienergebnisse unterscheiden
Was auffällig bei den vielen bisher veröffentlichen Studien ist, sind ihre teilweise weit auseinanderliegenden Prognosen Dies betrifft allgemein die wirtschaftliche Entwicklung und besonders den Effekt auf die Beschäftigtenzahl. Angesichts dieser Ungereimtheiten haben die Schweizer Forschungsinstitute Infras und Ecoplan (1996) im Auftrag der EU die verschiedenen Studien und ihre Ergebnisse verglichen, um Gründe für die Abweichungen zu ermitteln.
Ausschlaggebend sind nach ihren Ergebnissen (zusammengefaßt unter www.wuppertal- forum.de/wuppertal-bulletin/ WBd/WBd_3_97/TR_NP_3.htm) :
- unterschiedliche Annahmen über ökonomische Rahmenbedingungen als auch deren Entwicklung - verschiedene Modellszenarien im Hinblick auf Ausgestaltung und Kompensation
- unterschiedliche Annahmen hinsichtlich der Reaktionen der beteiligten ( Innovationsreaktionen, Investitionsverhalten, Tarifauswirkungen etc. )
- bei vielen Studien ( siehe RWI ) werden Ausnahmeregelungen für energieintensive Branchen nicht berücksichtigt.
- ,, Auch die Tatsache, daß in den Modellen in der Regel vorhandene `no-regrets'- Effizienzpotentiale - also ökonomisch vorteilhafte Maßnahmen zu effizienter Energieproduktion und - verwendung - keine Beachtung fänden, führe zu unrealistischen und übermäßig pessimistischen Vorraussagen."(www.wuppertal- forum.de/wuppertal-bulletin/ WBd/WBd_3_97/TR_NP_3.htm)
In der Zusammenfasung der verschiedenen Studien kommen die Forschungsinstitute zu folgender Feststellung :
,, Beschäftigung und Sozialprodukt werden von einer ÖSR tendenziell positiv beeinflußt, wenn diese schrittweise eingeführt wird, aufkommensneutral ist und zu realen Preiserhöhungen der Energieträger von maximal 4% pro Jahr führt.. Wesentlich höhere Steuersätze oder der Verzicht auf eine Rückersattung des Steueraufkommens an Haushalte und Wirtschaft führen dagegen zu einer höheren Arbeitslosigkeit und einem Sinken des Sozialproduktes. Positive Beschäftigungswirkung sind besonders bei einer Senkung der Abgabenlast auf Arbeit - und hier besonders auf gering qualifizierte Arbeit- zu erwarten."
(www.wuppertal-forum.de/wuppertal-bulletin/ XXX)
4.6 Zusammenfassung
Vielfach ist die Ablehnung weiter Bevölkerungskreise nicht nachvollziehbar, wenn es um die Einführung einer ökologischen Steuerreform geht. Das Ökosteuern bei richtiger Umsetzung auf keinen Fall einen Arbeitsplatzverlust bedeuten dürfte als gesicherte Erkenntnis angenommen werden. Man baut dabei auf eine wirtschaftliche Entwicklung, bei der das allgemeine Wirtschaftswachstum stärker ausfällt als der Produktivitätsfortschritt. Dies wird erreicht durch eine Umschichtung des Steueraufkommens - nicht mehr der Faktor Arbeit soll so stark besteuert werden, sondern der Energie- und Rohstoffverbrauch. In Folge kommt es zu einer Verlagerung von energie- und maschinenintensiven Produktionen hin zu arbeitsintensiven Produkten und Dienstleistungen.
,, Bislang haben wir uns im wesentlichen darauf konzentriert, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, das heißt immer weniger Menschen mußten immer effizienter Güter herstellen und Dienste leisten. Wenn der Faktor Arbeit aber entlastet, der Umweltverbrauch hingegen stärker belastet wird, investieren Unternehmen in die Ressourcen- statt in die Arbeitsproduktivität. Kilowattstunden und nicht Menschen werden `arbeitslos gemacht'" (REICHE, FR vom 27.3'98).
Eine vollständige Rückerstattung der eingenommenen Ökosteuern ist dabei die Vorraussetzung für ihre positiven gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen. Es wird Jobverluste in einigen Branchen geben, wie in der herkömmlichen Energiewirtschaft und anderen energieintensiven Sektoren, doch entstehen an anderer Stelle im Energieeinsparbereich oder im Dienstleistungsbereich wesentlich mehr Stellen.
Diesen positiven Arbeitsplatzeffekt könnte man noch durch eine Deregulierung der Strommärkte verstärken. Aufgrund der monopolartigen Organisierung der deutschen Energieversorgung liegen die Preise deutlich höher im Vergleich zu den europäischen Nachbarn. Ineffiziente Strukturen wegen fehlender Konkurrenz und enorm hohe Gewinne solcher Monopolunternehmen wie die RWE sind die Ursachen dafür. Durch einen Wettbewerb in diesem Sektor werden die Preise fallen - analog dazu könnte dies durch eine erhöhung der Ökosteuern wieder kompensiert werden. Mit den zusätzlichen Einnahmen könnten die Lohnnebenkosten noch deutlicher gesenkt werden.
Die meisten Gutachten, vor allen die von MEYER(1997) u.a. und dem DIW (1994) gehen davon aus, daß die Einführung einer ökologischen Steuerreform auch im nationalen Alleingang zu bewältigen wäre. Ihre Untersuchungen sind auch auf diesem Hintergrund konzipiert. Aufgrund der Rückerstattungskomponente hat das DIW (1994b,9)ausgerechnet, daß es lediglich zu Preiserhöhungen von 0.6% im 5.Jahr einer ÖSR-Einführung und 1.3% im 10.Jahr kommen würde. Vernachlässigbare Größen, wenn man die anderweitigen Effekte einer ökologischen Steuerrefom betrachtet. KREBS/REICHE (1998,86) konstatieren auch in diesem Zusammenhang, ,, daß eine ökologische Steuerreform nur verhältnismäßig geringe Auswirkung auf das Bruttosozialprodukt und andere wirtschaftliche Daten hat. Viel größeren Einfluß auf die Wirtschaft haben vor allen die Tarifpolitik, die Wechselkurse und die Zinssätze sowie andere Annahmen über Blastizität, die Flexibilität der Arbeitsmärkte, Innovationen und Investitionsverhalten."
Eine ökologische Steuerreform wäre das beste was der Volkswirtschaft der Bundesrepublik im Moment passieren könnte, deswegen sollte man nicht auf eine Lösung im Rahmen der `Europäischen Union' warten. Erwartungsgemäß werden ihre Vorschläge den kleinsten Nenner aller Mitgliedsstaaten repräsentieren und somit für die Umwelt und die vorhandene Arbeitslosigkeit keine nennenswerten positiven Effekte auslösen.
5 Schlußbetrachtung
Ökosteuern sind nicht der Königsweg zur Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit. Ihr Potential kann irgendwo zwischen 300.000 - 800.000 Tsd neuen Stellen angesiedelt werden - nicht viel bei einem Fehlbetrag von 4 - 7.5 Mio fehlenden Arbeitsplätzen in dieser Republik. Doch kann eine ökologische Steuerreform als Beitrag gesehen werden zur mittel- bis langfristigen Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Aufgrund der Entlastung der Umwelt muß in Zukunft weniger an Schadensbegrenzung in diesem Bereich ausgegeben werden, was dazu führen kann das wirkliche Produktivitätszuwächse entstehen und es nicht zu einem sogenannten Leerlauf in der Wirtschaft kommt, was sich wettbewerbsschädigend auswirken kann. Positiv auswirken tut sich in der Zukunft auch die gesteigerten Investitionen in Forschung und Entwicklung angestoßen durch höhere Energiekosten . Ökosteuern können bei richtiger Umsetzung ein ideales Mittel sein um die Ziele des qualitativen Wachstums zu verwirklichen, ohne das es dabei zu negativen Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Wohlstand kommt. Wer richtig investiert braucht im Endeffekt in der Regel keine Mehrbelastung fürchten. Gleichzeitig wird der Umweltverbrauch durch den Einsatz von energie- und rohstoffsparenden Maßnahmmen nachhaltig gesenkt. Folge ist eine deutliche Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energie/ Rohstoffverbrauch. Ökosteuern wären ein gesellschaftliches Lenkungselement, was die Wirtschaftsweise in diesem Land verändern könnte. Wurde überwiegend in den letzten Jahren im Sinne der Luhmannschen Systemtheorie neue Teilsysteme ausdifferenziert um die Folgen der Umweltverschmutzung in den Griff zu bekommen, wird jetzt durch eine steigende InPut- Besteuerung auf fossile Brennträger an den Ursachen angesetzt.
Wann es zu einer politischen Umsetzung einer `wirklichen' ökolgischen Steuerreform kommt ist durch den Parteitag der Grünen im März '98 ungewisser geworden. Durch ihre Forderungen zum Spritpreis innerhalb einer ÖSR haben sie eine große Unsicherheit hinsichtlich eines ökologischen Wandels in der Bevölkerung ausgelöst - was ihnen die Regierungsbeteiligung kosten könnte. Eine positive Einstellung zu einer ÖSR war in diesem Land nicht weit verbreitet, aber aufgrund ihrer großen Wirkung auf das wirtschaftliche Gefüge bedarf es einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung. Hier sind vor allen Dingen die Politiker aller Parteien gefragt.
Der FÖS äußert sich auf diesem Hintergrund folgendermaßen :
,, Wegen der ökologischen Dringlichkeit und vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um die Steuerreform gibt der FÖS dem sofortigen Einstieg mit einem möglichst einfachen, wettbewerbsneutralen und konsensfähigen Konzept den Vorzug vor einem ökologisch idealen Modell, das größere Umstellungen und Widerstände erzwänge und deshalb - wenn überhaupt - nur langfristig zu verwirklichen wäre."
(www.wuppertal-forum.de/wuppertal-bulletin/wpd/tr_pv_2.htm)
Welcher Weg - light oder strong - bei einer ökologischen Steuerreform der richtige ist, kann momentan schwer beurteilt werden. Will man das Ganze auf einmal und bekommt am Ende vielleicht gar nichts oder geht man ersteinmal den Weg des geringsten Widerstandes um wenigsten ein bißchen umzusteuern.
Was sicherlich die Akzeptanz und den Erfolg einer Steuerreform beeinflussen würde, wäre die Integration in ein sogenanntes `Bündnis für Arbeit', wo sich Gewerkschaften, Arbeitgeber und die Regierung gemeinsam darüber unterhalten, wie die Arbeitslosigkeit verringerbar ist. Dies würde signalisieren, daß die Einnahmen aus einer Ökosteuer wirklich für etwas sinnvolles verwandt werden und nicht in irgendwelchen staatlichen Haushaltslöchern verschwinden.
6) Literaturverzeichnis
BINSWANGER,H.-Chr. u.a (1981) :Wirtschaft und Umwelt , Stuttgart DIE WOCHE (1997) : Affentanz ums goldene Kalb, 4.4'97, 18
DIW (1994) : Wirtschaftliche Auswirkungen einer ökologischen Steuerreform, 1994 Köln DIW (1994b) : Wirtschaftliche Auswirkungen einer ökologischen Steuerreform - Kurzfassung, 1994 Köln
Enquete - Kommission `Schutz der Erdatmosphäre ' (1993) : Ergebnisprotokoll der Arbeitsgruppe Energie am 17.5.1993, Bonn 1993
Infras/ Ecoplan (1996) : Gesamtwirtschaftliche Wirkungen einer ökologischen Steuerreform zu beziehen über : Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale CH- 3000 Bern
JÜTTNER (1995) : XXX, 58-60 In : Anhörung der Fraktion Bü'90/Grüne zur Einführung ökologischer Steuer (o.s.ä.) 1995 (gefunden in Weinbrenner- Materielsammlung P III.1)
KREBS, C./ REICHE, D. (1998) : Die ökologische Seuerreform- Was sie ist, Wie sie funktioniert,Was sie uns bringt, Berlin 1998
LEIPERT, Christian (1989) : Die heimlichen Kosten des Fortschritts. Wie Umweltzerstörung das Wirtschaftswachstum fördert, Frankfurt a.M. 1989
MEADOWS, Denis (1972) : Die Grenzen des Wachstums: Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart 1972
MEINECKE, Mario (1997) : Einzelwirtschaftliche Auswirkungen einer ökologisch-sozialen Steuerreform untersucht am Beispiel Quelle Schickedanz AG und zweier Vorleistungsbetriebe In : Schriftenreihe des IÖW 118/97, Berlin 1997
RECHSTEINER, R. (1993) : Sind hohe Energiepreise volkswirtschaftlich ungesund ? In : Gaia, Heft 2/93, 310-327
REICHE, DANYEL (1998) : Ökologische Steuerreorm- der richtige Weg In : Frankfurter Rundschau 27.März 1998
ROBINET/ LUCAS (1994) : Umweltschutz und Umweltqualität als Standortfaktor, Marburg 1994
SCHLEGELMILCH, Kai (1996) : Umweltstandort Deutschland - ökolgische Steuerreform als notwendige Rahmenbedingung. In : Gewerkschaftliche Monatshefte 1996, Jg 47, 138-149
SCHLEGELMILCH, K./ GÖRRES, A. (1996) : Ökologische Steuerreform : Pro und Kontra - Eine Antwort auf die häufigsten Einwände der Kritiker. In : Zeitschrift für angewandte Umweltwissenschaft 1996, 121-133 Statistisches Jahrbuch 1997, Wiesbaden
Umweltbundesamt ( 1997) : Nachhaltiges Deutschland. Wege zu einer dauerhaft- umweltgerechten Entwicklung, Berlin 1997
WEIZSÄCKER von, E.-U. (1994): Umweltpolitik in der Rezession : Wir brauchen die ökolgische Steuerreform erst recht. In : SCHMIDT,E./ SPELTHAHN, S. : Umweltpolitik in der Defensive - Umweltschutz trotz Wirtschaftskrise, Frankfurt a.M. 1994
WEIZSÄCKER von, E.-U./ LOVINS, A.B. (1995) : Faktor vier : Doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch, München 1995
WOLF, F.-O./ DRÄGER,K. (1995) : Teure Energie. Billige Arbeit - Eine grüne Kritik der Ökosteuer. In : Blätter für deutsche und internationale Politik 1995, Jg 40, 1071-1082
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument behandelt die ökologische Steuerreform (ÖSR) in Deutschland, insbesondere ihre Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und Umwelt.
Was sind Ökosteuern?
Ökosteuern sind Steuern, die auf den Verbrauch von Ressourcen oder die Umweltverschmutzung erhoben werden, um umweltschädliches Verhalten zu reduzieren. Die Einnahmen sollen aufkommensneutral an Arbeitgeber und Arbeitnehmer zurückgegeben werden.
Wie sollen Ökosteuern funktionieren?
Ökosteuern verteuern primär fossile Brennstoffe wie Kohle, Benzin und Gas. Die höheren Preise sollen die "ökologische Wahrheit" widerspiegeln und Anreize für Energieeinsparungen und den Einsatz regenerativer Energien schaffen.
Was ist der Grundgedanke einer ökologischen Steuerreform?
Der Grundgedanke ist die Umschichtung der Steuerlast weg vom Faktor Arbeit (Löhne, Sozialversicherungsbeiträge) hin zum Ressourcenverbrauch. Dadurch sollen Arbeitsplätze geschaffen und die Umwelt entlastet werden.
Was bedeutet "doppelte Dividende" im Zusammenhang mit Ökosteuern?
"Doppelte Dividende" bedeutet, dass eine ökologische Steuerreform gleichzeitig zu einer geringeren Umweltbelastung und zu mehr Beschäftigung führen soll.
Wie sollen die Einnahmen aus Ökosteuern zurückerstattet werden?
Die Einnahmen sollen durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeber und/oder die Senkung der Einkommensteuer für Arbeitnehmer zurückerstattet werden. Für Rentner, Studenten, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger sollen die staatlichen Zuweisungen erhöht werden.
Welche Auswirkungen haben Ökosteuern auf energieintensive Branchen?
Verteuerte Energiepreise können die internationale Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Branchen wie Stahl, Eisen, Papier oder der Grundstoffchemie einschränken. Daher werden in der Diskussion oft Ausnahmeregelungen für diese Sektoren gefordert.
Was ist der Innovationsboom im Kontext von Ökosteuern?
Die Erwartung, dass durch steigende Energiepreise neue Maschinen, Technologien und Maßnahmen im Bereich der Energieeinsparung entwickelt und auf den Markt gebracht werden.
Was sind die verschiedenen Studienergebnisse zu den Beschäftigungseffekten von Ökosteuern?
Die Studienergebnisse variieren stark, von positiven Beschäftigungseffekten von bis zu 1,5 Millionen neuen Stellen (Meyer-Studie) bis hin zu einem Verlust von 400.000 Stellen (RWI-Studie). Das DIW Modell errechnet 610.000 Tsd neue Stellen.
Warum unterscheiden sich die Studienergebnisse so stark?
Die Unterschiede resultieren aus unterschiedlichen Annahmen über ökonomische Rahmenbedingungen, Modellszenarien, Annahmen über das Verhalten der Akteure (Innovation, Investition, Tarifpolitik) und die Berücksichtigung von Ausnahmeregelungen für energieintensive Branchen.
Könnte eine ökologische Steuerreform im nationalen Alleingang durchgeführt werden?
Die meisten Gutachten gehen davon aus, dass eine ökologische Steuerreform auch im nationalen Alleingang bewältigt werden könnte.
Was ist die Schlussfolgerung des Dokuments?
Ökosteuern sind nicht die alleinige Lösung für die Massenarbeitslosigkeit, können aber einen Beitrag zur mittel- bis langfristigen Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland leisten. Sie können ein Mittel zur Verwirklichung des qualitativen Wachstums sein, ohne negative Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Wohlstand.
Was sind defensive Kosten?
Ausgaben, um die negativen sozialen und ökologischen Folgewirkungen von Produktion und Konsum auszugleichen.
Was bedeutet qualitatives Wachstum?
Qualitatives Wachstum meint eine Erhöhung des Angebots von Gütern, die das Leben lebenswerter machen und die Entkopplung des Sozialproduktwachstums mit dem Energie- und Rohstoffverbrauch.
- Citation du texte
- Daniel Holstein (Auteur), 1998, Wachstum durch Investitionen in den Umweltschutz - Bringen Ökosteuern einen positiven Beschäftigungseffekt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95392