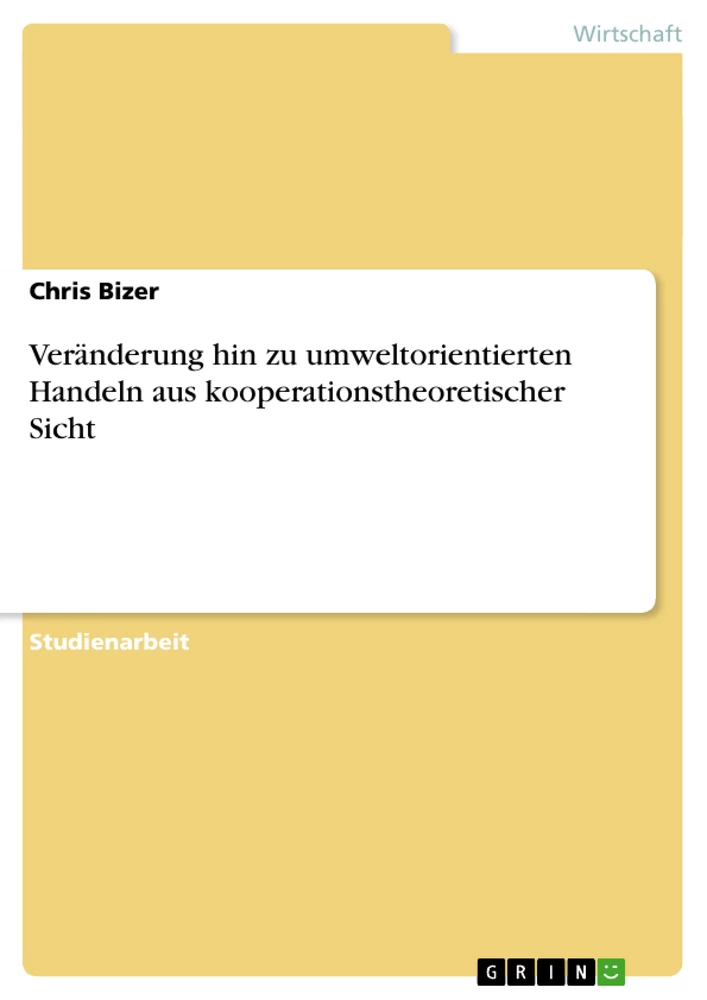Gliederung der Hausarbeit
EINLEITUNG
GLIEDERUNG DER ARBEIT
1.1 DEFINITION VON KOOPERATIVEM HANDELN
1.2 SPEZIFIKA UND PROBLEME VON KOOPERATIVEM HANDELN IM UMWELTBEREICH
2 DARSTELLUNG DER BASISTHEORIEN
2.1 DIE ÖKONOMISCHE THEORIE
2.1.1 MENSCHENBILD DER ÖKONOMIE
2.1.2 UMWELTPROBLEME IN DER ÖKONOMISCHEN THEORIE
2.1.2.1 Externe Effekte
2.1.2.2 Öffentliche Güter
2.1.3 LÖSUNGSANSÄTZE DER ÖKONOMISCHEN THEORIE
2.1.3.1 Pigou-Steuer
2.1.3.2 Coase Theorem
2.1.3.3 Spieltheorie
2.1.3.3.1 Einfache Spiele - Ein Beispiel
2.1.3.3.2 Wiederholte Spiele
2.1.3.3.3 Soziale Dilemmata
2.1.3.3.4 Lösungsversuche Sozialer Dilemmata
2.1.3.4 Fazit
2.2 ETHISCHE KONZEPTE
2.2.1 VORWORT
2.2.2 ABGRENZUNG: ÖKONOMIK UND E THIK
2.2.3 NORMENBEGRÜNDUNG: THEORETISCHE POSITIONEN DER E THIK
2.2.3.1 Non-Kognitivismus
2.2.3.2 Kognitivismus
2.2.4 NORMENDURCHSETZUNG: DER SYSTEMATISCHE ORT DER MORAL IN DER MARKTWIRTSCHAFT
2.2.4.1 Eine non-kognitivistische Betrachtung
2.2.4.2 Kognitivistische Institutionenökonomik
2.2.4.2.1 Unternehmensethik als Ordnungselement ( Æ Steinmann/Löhr )
2.2.4.2.2 Integrative Institutionenethik (Æ Peter Ulrich)
2.2.5 KRITIK UND V ERGLEICH DER KONZEPTE
2.3 DER EVOLUTIONSTHEORET ISCHE ANSATZ
2.3.1 EVOLUTIONSBIOLOGIE
2.3.1.1 „Survival of the fittest“
2.3.1.2 Versuch und Irrtum / Mutation und Selektion
2.3.2 THEORIE DER SOZIOKULTURELLEN EVOLUTION
2.3.2.1 Der evolutionäre Erfolg des Menschen
2.3.2.1.1 Die Kommunikation
2.3.2.1.2 „theory of mind“
2.3.2.1.3 Die emotionale Intelligenz
2.3.2.2 Erweiterte Evolutionsmechanismen des Menschen
2.3.3 THEORIE DER KOOPERATION
2.3.3.1 Theoretische Grundlagen
2.3.3.1.1 Verwandtschaftstheorie
2.3.3.1.2 Reziprozitätstheorie
2.3.3.1.3 Spieltheorie
2.3.3.2 Eine evolutionäre Kooperationsthese
2.3.3.2.1 Entstehung von Kooperation
2.3.3.2.2 Kooperation und Kultur
2.3.3.2.3 Stabilität und Widerstandsfähigkeit
2.3.3.3 Kooperation im Umweltbereich
2.3.3.3.1 Der ideale, umweltbewußte Kooperator
2.3.3.3.2 Beurteilung des Idealmodells
2.3.4 DISKUSSION DER EVOLUTIONSTHEORIE
3 BEDEUTUNG VON STAAT, BETRIEB UND GRUPPE IM KOOPERATIONSKONTEXT
3.1 DER STAAT
3.1.1 ROLLE DES STAATES IN DEN DREI THEORIERICHTUNGEN
3.1.2 PRAKTISCHE IMPLIKATIONEN
3.2 GRUPPEN
3.2.1 INTERNER UND EXTERNER E INFLUß DER GRUPPE AUF DAS INDIVIDUUM
3.2.1.1 Interne Faktoren
3.2.1.2 Externe Faktoren
3.2.2 ERGEBNIS
3.2.3 PRAKTISCHE IMPLIKATIONEN
3.3 DER BETRIEB
4 BRENT SPAR - E IN SITUATIVES BEISPIEL
5 FAZIT UND ANREGUNGEN
6 LITERATURVERZEICHNIS
Einleitung
Täglich stehen in allen großen Städten dieser Welt die Autofahrer zur Rush-hour im Stau, obwohl sie wissen, daß sie mit dem öffentlichen Nahverkehr auch an ihr Ziel kommen würden. Die Meere werden mit modernster Technik seit Jahren leergefischt, wodurch sich die Fischer selber ihre Lebensgrundlage entziehen. In Afrika weidet eine viel zu große Anzahl von Tieren auf empfindlichen Boden, dadurch dehnen sich Wüstengebiete immer weiter aus.
All dies sind Situationen, bei denen eine langfristige, ökologische Lösung notwendig wäre, diese aber oftmals nicht umgesetzt wird. Für eine Lösung der Probleme wäre Kooperation und damit kurzfristiger individueller Nutzenverzicht nötig.
Wie kommt jedoch unter dieser Annahme, der Mensch als kurzfristiger Nutzenmaximierer, das Verbot der Versenkung von radioaktivem Abfall im Meer oder Car-sharing Organisationen zustan- de? Wie lassen sich Institutionen wie Greenpeace und Brot für die Welt erklären, wenn der Mensch grundsätzlich nicht bereit ist, Kosten zu übernehmen ohne dafür eine direkte Gegenleis- tung zu erhalten?
Die Hausarbeit beantwortet die Frage, inwieweit Kooperation im Umweltbereich möglich ist und unter welchen Rahmenbedingungen Individuen kooperieren. Es wird untersucht, welche praktische Maßnahmen zur Förderung von Kooperation unternommen werden könnten. Dabei werden drei Theorieansätze aus den Disziplinen Ethik, Evolutionstheorie und Ökonomik als Diskussionsgrund- lage benutzt.
Gliederung der Arbeit
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Teile:
Im ersten Teil wird der Begriff der Kooperation besonders der Kooperation im Umweltbereich als Grundlage für diese Arbeit geklärt. Zum Verständnis der hier betrachteten theoretischen Grund- konzepte werden diese im zweiten Teil allgemein vorgestellt. Dabei werden Erklärungsansätze für Kooperation und Kooperation im Umweltbereich gegeben. Der dritte Teil ist eine Zusammenfüh- rung der drei Theorien in den für die Kooperation relevanten Bereichen: Gruppe, Betrieb und Staat. Die erarbeiteten Beiträge der Disziplinen zur Kooperation werden im vierten Teil auf eine konkrete Entscheidungssituation, den Fall Brent Spar, bezogen. Der fünfte Teil beinhaltet Schlußbemerkun- gen der AutorInnen und ein Fazit.
1.1 Definition von kooperativem Handeln
Kooperation ist in der Realität in den unterschiedlichsten Ausprägungen zu beobachten. Jede theoretische Disziplin hat ihren eigene Definition mit spezifischen Besonderheiten.1
Diese Arbeit verwendet vier Aussagen über Kooperation:
Kooperation ist in einem sozialen Umfeld zu sehen. Die kooperierenden Individuen und Institutionen handeln gemeinsam und zielgerichtet. Sie erwarten dabei (und bedingen dies durch ihre Kooperation) eine positivere Auszahlung als bei individuellem Handeln.
1.2 Spezifika und Probleme von kooperativem Handeln im Um- weltbereich
Eine biozentrische Definition von Umwelt lautet: „die Umwelt ist die gesamte Umgebung eines Organismus oder einer Organismengruppe, die von einem Wirkungsgefüge abiotischer, biotischer und antrophogener Faktoren ausgemacht wird, zu denen der Organismus (die Organismen) in direkten und indirekten Wechselbeziehungen steht (stehen), deren Qualität für die Existenz und das Wohlbefinden des/der Lebewesen(s) entscheidend ist.“2
Ausgehend von den Definitionen für Kooperation und Umwelt ist Kooperation im Umweltbereich durch folgende spezifische Merkmale gekennzeichnet:
- Die Faktoren, die auf die Umwelt einwirken, bedingen sich und die Umwelt auf nicht genau zu bestimmende Weise. Ursache/Wirkungsbezüge sind zwar zu bestimmen, aber nicht quantitativ zu erfassen. Der Zusammenhang der individuellen Handlung Autofahren und schadstoffreiche Luft ist bekannt, aber das Ausmaß der Schädigung nicht. Auch die Rückwirkung der schad- stoffreichen Luft auf den menschlichen Organismus, ist nicht in Zahlenverhältnissen auszudrü- cken.
- Es ergibt sich eine variable Gruppengröße der Kooperation im Umweltbereich. Kooperation wird in unterschiedlich großen Gruppen, mit unterschiedlicher Anzahl von Individuen, getätigt. Dabei finden sich individuelle Kooperationen sowie internationale Kooperation von Staaten. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind jedoch immer global.
- Die Bildung des Umweltbewußtseins entsteht aus der persönlichen Situation des Individuums. Externe Beeinflussungen sind Gruppen, die Öffentlichkeit und unter anderem staatliche Aktivitäten. Der Schutz der Umwelt ist damit eine Wertgröße im Zielsystem des Individuum.
- Viele Kooperationen im Umweltbereich zielen auf die Produktion eines öffentlichen Gutes. Der Nutzen des Gutes wird je nach Umweltbewußtsein des Individuum bewertet . Da zur Erstellung des öffentlichen Gutes meist hohe individuelle Kosten getragen werden müssen, führt das Individuum eine Kosten-Nutzen-Analyse durch. Bei dieser Entscheidung werden langfristige und der Allgemeinheit dienende Nutzenkomponenten häufig vernachlässigt.
- Der Mensch neigt dazu, Auszahlungen, die in der Zukunft liegen, zu diskontieren. Umweltbe- wußtes Handeln zeigt jedoch selten direkte Auswirkungen, sie sind meist zeitverzögert.
- Das Umweltbewußtsein der Menschen deckt sich selten mit ihrem Handeln, da in der speziel- len Entscheidungssituation sich das Individuum oft für die individuelle Nutzenmaximierung contra Kooperation entscheidet (ökologische Verhaltenslücke).
Diese Merkmale von Kooperation im Umweltbereich zeigen die zu berücksichtigenden Spezifika und Probleme auf. Trotzdem ist Kooperation zwischen Individuen, Gruppen und Nationen ein beobachtbares Phänomen, obwohl die Gegenleistung „nur“ im Erhalt unser aller Existenzgrundla-Hausarbeit: Kooperation Christian Bizer, Mark Jennerke, Sabine Gerardge, Gesundheit und Wohlbefinden besteht. Erklärungsansätze dieses Verhaltens, aber auch die der Kooperationsverweigerung, werden im weiteren Verlauf der Arbeit anhand der Ökonomie, Ethik und evolutorischer Ansätze erläutert.
2 Darstellung der Basistheorien
In diesem Kapitel werden die Basistheorien allgemein kurz vorgestellt und die Elemente hervorgehoben, die sich auf Kooperation und den Umweltbereich beziehen.
2.1 Dieökonomische Theorie
Dieser Teil untersucht, inwieweit die ökonomische Theorie Kooperation zuläßt und legt gleichzeitig begriffliche Grundlagen, auf die der ethische und der evolutionstheoretische Ansatz zurückgreifen.
2.1.1 Menschenbild der Ökonomie
Wichtig für das Verständnis der ökonomischen Theorie ist es, sich erst einmal das zugrundeliegende Menschenbild klarzumachen. Die klassische mikroökonomische Theorie geht vom Konstrukt des Homo oeconomicus aus. Er wird charakterisiert durch folgende Eigenschaften3:
Egoistische Nutzenmaximierung
Der Homo oeconomicus strebt nach Maximierung des eige- nen individuellen Nutzens. Handeln aus altruistischen Moti- ven ist ausgeschlossen. Er strebt immer nach einer Maxi- mierung und gibt sich nicht mit Teilerfolgen (Satisficing4 ) zufrieden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieses Menschenbild impliziert, daß Homo Oeconomica nur dann kooperieren, wenn sich für sie persönlich so ein höherer Nutzen als bei individuellem Agieren realisieren läßt. Kooperation aus altruistischen Motiven, aus Gewissengründen oder für einen übergeordnetes Ziel, ist per Definition ausgeschlossen.
2.1.2 Umweltprobleme in der ökonomischen Theorie
In die mikroökonomischen Theorie werden Umweltschädigungen über zwei Konstrukte mit einbe- zogen:
2.1.2.1 Externe Effekte
Die meisten Umweltschädigungen sind das Resultat von externen Effekten. Um diese Effekte zu erklären, muß man sich die Funktion des Preismechanismus nochmals vor Augen führen. Knappe Ressourcen, nach denen eine hohe Nachfrage besteht, erzielen auf einem freien Markt einen hohen Preis. Haushalte und Produzenten werden diese Ressourcen nur sparsam einsetzen oder auf billigere Substitute umsteigen. Es bildet sich über den Markt eine effektive Allokation aller Ressourcen.
Dieser Mechanismus funktioniert aber nur unter der Annahme, daß sich alle Auswirkungen der Produktion oder des Konsums auf den Preis niederschlagen5. Es kann aber durchaus geschehen, daß die Handlungen eines Akteurs die Produktions- und Konsummöglichkeiten anderer verändern, ohne daß sich dies vollständig und ausschließlich in den relativen Preisen niederschlägt. Somit definieren sich externe Effekte als Beeinflussungen, die gewissermaßen am Preissystem vorbei den direkten Nutzen betreffen und die vom Preismechanismus nicht koordiniert werden können6. Es gibt vielfältige Beispiele für Externalitäten sowohl auf Konsumenten als auch auf Produzenten- seite. Für Abgase oder Lärmbelästigung durch den Autoverkehr ist beispielsweise kein direkter Preis zu zahlen. Auf Produzentenseite wird gerne auf das Beispiel einer Papierfabrik, die einen Fluß verschmutzt und einen Fischereibetrieb, der sauberes Wasser benötigt, verwiesen. Für die Verschmutzung des Flußwassers muß die Fabrik nichts bezahlen. Sie wird nach Belieben Wasser verbrauchen und damit den Fischereibetrieb schädigen. Dies zeigt, daß das Vorhandensein exter- ner Effekte zu ineffizienten Allokationen führen kann7.
2.1.2.2 Öffentliche Güter
Eng verbunden mit dem Phänomen der externen Effekte sind öffentliche Güter. Bei der Produktion öffentlicher Güter kommt es zu Marktversagen. Dies geschieht entweder, weil es nicht möglich ist, Konsumenten vom Gebrauch der Güter auszuschließen oder weil der Konsum nicht rivalisierend ist8. Ein Beispiel für ein öffentliches Gut, auf das beide Kriterien zutreffen, sind Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung9. Sie kommen allen Individuen gleichermaßen zugute und es stört die Nutzer nicht, wenn mehr Individuen daraus Nutzen ziehen. Darüber hinaus ist der Ausschluß einzelner Individuen vom Nutzen der Maßnahmen nicht möglich.
Problematisch bei der Produktion öffentlicher Güter ist, daß die Konsumenten, das Menschenbild des Homo Oeconomicus vorausgesetzt, aus Gründen, die im Rahmen sozialer Dilemmata noch genauer erörtert werden, nicht bereit sind, für ihre Produktion Beiträge zu leisten. Sie hoffen, daß andere für die Produktion bezahlen und betätigen sich sozusagen als "Schwarzfahrer". Aus diesem Grund stellt der Staat viele öffentliche Güter, wie Straßen, Parks, Sicherheit und Landesverteidigung zur Verfügung und zwingt die Bürger, durch das Eintreiben von Steuern, sich an den Produktionskosten zu beteiligen.
2.1.3 Lösungsansätze der Ökonomischen Theorie
Der erste Ansatz der mikroökonomischen Theorie zum Umgang mit Umweltproblemen und zum Erreichen von Kooperation ist der Versuch der Internalisierung externer Effekte und somit eine Rückführung der Externalitäten in das Preissystem.
2.1.3.1 Pigou-Steuer
Den erste Vorschlag dazu machte 1920 A. C. Pigou10. Als Ausgleich für den durch Externalitäten entstandenen gesellschaftlichen Schaden, soll der Staat eine Steuer festlegen. Diese Steuer soll genau der Höhe des entstandenen Schadens entsprechen. Dadurch würden die gesellschaftlichen Kosten in die Kalkulation der Haushalte und Produzenten eingehen und eine effiziente Lösung erreicht werden.
In Situationen, in denen gemeinsam die Steuer abgewendet werden könnte, würden rationale Individuen Kooperationen eingehen. Denkbar wäre zum Beispiel der Bau einer gemeinsamen Kläranlage für ein Wohngebiet oder mehrere Industriebetriebe, solange die Kosten unterhalb der erhobenen Steuer liegen würden.
Die Verwirklichung dieses theoretisch einleuchtenden Konzepts stellt sich in der Praxis jedoch als unmöglich heraus, da sich die pareto-optimale Steuerhöhe nicht festsetzen läßt. Es müßte ein Mechanismus zur Bestimmung und Bewertung des gesellschaftlichen Schadens gefunden werden. Auch eine befriedigende Annäherung wäre nur mit beträchtlichem administrativem Aufwand denk- bar11.
2.1.3.2 Coase Theorem
Ronald H. Coase versuchte 1960 in seinem Aufsatz "The Problem of Social Cost" den Nachweis zu führen, daß eine Internalisierung auch ohne direkte staatliche Eingriffe möglich ist. Sein Ansatz geht davon aus, das die Eigentumsrechte aller von der Externalität betroffenen Güter klar definiert sind und es möglich ist sie durchzusetzen12. In einer solchen Situation könnten der Verursacher und der Betroffene des externen Effekts in direkte Verhandlungen treten, und sich auf eine Ent- schädigungszahlung einigen. Durch diese Ausgleichszahlung würde die Externalität wieder inter- nalisiert werden. Dem Staat hätte nur noch dafür zu sorgen, daß die Eigentumsrechte einklagbar sind.
Problematisch wird dieser Ansatz durch die Einbeziehung von Transaktionskosten. Eine Einigung zwischen wenigen Betroffenen kann man sich noch vorstellen. Liegt aber ein Fall von vielen Verur- sachern und vielen Geschädigten, wie bei den meisten Umweltproblemen, vor, schließen die prohibitiv hohen Transaktionskosten eine Einigung faktisch aus13. Auch dürfte es im Umweltbe- reich sehr schwierig sein, alle Eigentumsrechte, zum Beispiel für saubere Luft, an Akteure zu verteilen.
2.1.3.3 Spieltheorie
Bei der Spieltheorie handelt es sich um einen Theoriezweig der mikroökonomischen Theorie. Wichtige Vertreter, die 1994 gemeinsam für ihre Arbeit mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, sind John Nash, John C. Harsanyi und Reinhard Selten14.
Die grundlegende Idee der Spieltheorie besteht darin, Situationen, in denen sich Menschen durch ihr Verhalten gegenseitig beeinflussen können, dadurch abzubilden, daß die Handlungsspielräume der Akteure durch "Spielregeln" beschrieben werden. Da diese Regeln die Verhaltensmöglichkeiten exakt beschreiben, lassen sich Aussagen darüber treffen, welche der möglichen Handlungen von rationalen Spielern gewählt werden15. Das wohl bekannteste und am meisten zitierte Spiel im Rahmen der Spieltheorie ist das Gefangenendilemma.
Spieltheoretische Modelle bestehen aus folgenden Elementen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten16
2.1.3.3.1 Einfache Spiele - Ein Beispiel
Die Funktionweise eines einfachen Spiels läßt sich gut am obigen Fabrik/Fischerei-Beispiel ver- deutlichen. Nehmen wir an, unterhalb der Fabrik wären zwei Fischzüchter ansässig, und der Pa- pierfabrikant wäre für 5 Geldeinheiten zum Bau einer Kläranlage bereit. Die Kläranlage würde, da es wieder sauberes Wasser gibt, jedem Fischer einen Gewinn von 4 Geldeinheiten bringen. Die Fischer stehen nun vor der Frage, ob sie sich die Kosten der Kläranlage teilen sollen oder ob sie darauf hoffen, daß der andere Fischer die Anlage komplett bezahlt. Es ergibt sich folgende Aus- zahlungsmatrix17:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um dieses Spiel lösen zu können, muß man nochmals eine zusätzliche Unterscheidung treffen: Handelt es sich um ein kooperatives oder ein nicht-kooperatives Spiel? Vorab werden noch zwei Begriffe eingeführt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nichtkooperatives Spiel
Bei einem nichtkooperativen Spiel haben die Spieler nicht die Möglichkeit, miteinander zu verhandeln oder bindende Verträge zu schließen18. Für diesen Fall existiert für obiges Beispiel ein NashGleichgewicht in dominanten Strategien19. Es ist für jeden Fischer immer besser, nicht zu zahlen, da egal was der andere Fischer macht, er immer besser gestellt ist. Dies ergibt ein Gleichgewicht, das nicht pareto-optimal ist, da die Umwelt weiter verschmutzt wird und beide Fischer bei Kooperation ein höheres Einkommen erzielen könnten.
Kooperatives Spiel
Von einem kooperativen Spiel spricht man, wenn die Spieler die Möglichkeit haben, miteinander zu verhandeln und bindende Verträge zu schließen20. Dies dürfte obiges Beispiel besser modellieren, da Fischzüchter anders als beim klassischen Gefangenendilemma, normalerweise nicht in Gefängniszellen eingesperrt sind. Vollständige Information über eigene und fremde Erträge vorausgesetzt, könnten sich die Fischer darauf einigen, die Kläranlage gemeinsam zu bezahlen. Eine pareto-optimale Allokation wäre erreicht.
2.1.3.3.2 Wiederholte Spiele
Eine Erweiterung der Single-Shot-Spiele, die in obigen Abschnitt besprochen wurden, sind wie- derholte Spiele, also das mehrfache Durchführen des gleichen Spiels. Bei wiederholten Spielen haben die Spieler die Möglichkeit zu versuchen, das Verhalten des Gegenspielers in zukünftigen Spielen durch ihre Strategieentscheidung zu beeinflussen21. Wichtig ist bei wiederholten Spielen, ob das Spiel eine endliche aber bestimmte Zahl von Durchführungen gespielt wird oder ob es eine unendlich beziehungsweise eine unbestimmte Zahl von Durchführungen wiederholt wird.
Das Chainstone Paradoxon
Im endlichen Fall ist nach dem Chainstone Paradoxon eine Rückwärtsinduktion möglich22. Ist das Spiel so angelegt, daß es eine dominante, nicht kooperative Strategie gibt, wird der Spieler in den ersten Spielen zwar versuchen, durch Kooperation den anderen zu beeinflussen. Im letzten Spiel entfällt diese Motivation, er wird die nicht kooperative Alternative wählen. Dieser Schluß läßt sich nun auch auf das vorletzte Spiel übertragen, da es jetzt ja sozusagen das letzte Spiel ist. Wiederholt man diesen Vorgang, gelangt man bis zum ersten Spiel. Die wiederholte Durchführung hat somit keinen Einfluß auf das Ergebnis.
Anders sieht es im unendlichen Fall aus. Hier ist keine Rückwärtsinduktion möglich, da es kein definitiv letztes Spiel gibt. Die Akteure können versuchen, sich zu beeinflussen und so langfristig zu einen höheren Nutzen zu gelangen.
Die Tit-for-Tat Strategie
In diesem Zusammenhang als besonders effektiv hat sich die von Anatol Rapoport vorgeschlagene Tit-for-Tat Strategie bewiesen. Sie beruht auf den "wie du mir, so ich dir"-Prinzip. Man beginnt kooperativ und wählt dann in der nächsten Runde immer die Strategie, die der Mitspieler in der vorhergehenden Runde gewählt hat. Nimmt ein Spieler die "Schwarzfahr-Option" war, wird er in der nächsten Runde dafür durch Defektieren bestraft.
2.1.3.3.3Soziale Dilemmata
Die Beschreibung des Phänomens der sozialen Dilemmata geht auf eine Arbeit von Hardin aus den Jahre 1969 zurück23. Soziale Dilemmata entstehen in Situationen, in denen viele Individuen einen Beitrag zur Produktion eines öffentlichen Gutes leisten müßten24. Die meisten Umweltprobleme lassen sich auf solche Situationen zurückführen. Zur Reinhaltung der Meere müßten viele Anrainer Beiträge leisten, indem sie auf Einleitungen von verschmutzen Abwässern und auf die Verklappung von Müll verzichten. Um das Ozonloch zu schließen, müßte weltweit auf die Produktion von FCKWs verzichtet werden. Jeder müßte dadurch seinen Beitrag leisten, daß er FCKWfreie Produkte zu einem höheren Preis kauft.
Wir werden uns die Funktionsweise sozialer Dilemmata am Beispiel des Autoverkehrs genauer anschauen. Jeder kennt das Phänomen, zur Rush-hour bricht regelmäßig der Verkehr in den Innenstädten zusammen. Die Autofahrer stehen im Stau, die Abgase verpesten die Luft, die An- wohner werden durch den Krach belästigt. In Bangkok, einer Stadt mit extremen Verkehrsproble- men, kommt es täglich zum totalen Verkehrszusammenbruch. Deswegen sind viele Pendler dazu übergegangen, nach Dienstschluß noch einige Stunden in der Innenstadt zu bleiben und erst in den Abendstunden den Versuch zu wagen, in die umliegende Orte zurückzufahren. Eine sinnvolle Lösung wäre die Beschränkung des privaten Verkehrs und eine Umstellung auf öffentlichen Nah- verkehr. Aus Sicht der einzelnen Autofahrer verursacht der Verzicht auf ihr Auto jedoch Kosten in Form von Einschränkung der Beweglichkeit, Zeitverlust etc. Nimmt ein Autofahrer diese Kosten auf sich, würde er zur Produktion eines öffentlichen Gutes, nämlich des Gutes "Umweltqualität der Innenstadt" beitragen.
Für einen Homo oeconomicus ergibt sich jedoch als dominante Strategie, weiter das Auto zu benutzen und darauf zu hoffen, daß andere Individuen Beiträge in Form von Verzicht leisten. Die ideale Situation für einen einzelnen Autofahrer wäre, wenn er sein Auto weiter benutzen und alle anderen Autofahrer darauf verzichten würden. Er wäre weiterhin mobil und könnte sich, auf den jetzt freien Straßen der Innenstadt, optimal bewegen.
Diese Enscheidung läßt sich auch an einem Zahlenbeispiel belegen. Nehmen wir an, wir hätten eine Gruppe von 10 Leuten, die jeweils einen Beitrag von 0.5 Einheiten zu Produktion eines öffentlichen Gutes leisten müßten25. Die Zahl Zehn ist gewählt, um die Tabelle übersichtlich zu halten. Bei größeren Gruppen kommt der Effekt noch stärker zum tragen, da die individuellen Beitrage noch weniger ins Gewicht fallen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wie man sieht, sind die Auszahlungen in der unteren Zeile immer höher als die Auszahlungen in der Oberen. Es ist für den Spieler immer besser, keinen Beitrag zu leisten, da er so, egal was die anderen tun, immer besser gestellt ist. Er betätigt sich sozusagen als "Schwarzfahrer", da er hofft, von den Beiträgen der anderen mitzuprofitieren.
Dieses Beispiel zeigt, wie individuell rationales Verhalten in Dilemmasituationen zu einem kollektiv nicht rationalen Ergebnis führen kann26.
Für Kooperationspotentiale im Umweltbereich zeichnen soziale Dilemmata ein recht düsteres Bild. Sie zeigen, daß rationale Individuen, die dem Menschenbild des Homo oeconomicus entsprechen,in keinem Fall kooperieren würden, da Kooperation den Verzicht auf individuellen Nutzen und somit irrationales Verhalten bedeuten würde.
2.1.3.3.4Lösungsversuche Sozialer Dilemmata
Um dieses Dilemma aufzubrechen, werden wir drei Faktoren näher betrachten: Die Gruppengröße, das zugrundegelegte Menschenbild und die Rolle des Staates.
Kritik am Homo Oeconomicus
Um die Aussagefähigkeit sozialer Dilemmata bewerten zu können, ist es wichtig, ihre Prämissen auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen. Eine zentrale Modellprämisse ist die des Homo oeconomicus. Sind wir wirklich alle sachlich kalkulierende Rationalisten? In der Realität lassen sich zahlreiche Gegenbeispiele beobachten. Viele Menschen spenden für wohltätige Zwecke, setzen sich persön- lich für das Wohle der Allgemeinheit ein oder sind einfach nur hilfsbereit. Die Psychologie hat in über 1000 Experimenten Gefangenen-Dilemma-Situationen untersucht27. Es zeigte sich, daß die Probanden sich recht unterschiedlich verhielten. Es war kein reines Freifahrverhalten anzutreffen, aber die Individuen verhielten sich auch nicht nur kooperativ. Die Experimente ergaben, daß die Kooperationsbereitschaft individuell und je nach Gruppenzugehörigkeit stark differiert. Eine Gruppe Psychologiestudenten zeigte sich beispielsweise viel kooperationsbereiter als eine Kontrollgruppe, die nur aus VWL-Studenten bestand28. Diese Forschungen legen es nahe, daß das Konstrukt des Homo oeconomicus nicht dem Menschen der Realität entspricht. In Anlehnung an Becker ließe sich ein anderes Menschenbild, das des "Administrative Man" formulieren29:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein solches Menschenbild vorausgesetzt, liegt es nahe, Gründe und Grenzen von Kooperationsbereitschaft weniger in den Auszahlungen zu suchen, wie es die ökonomische Theorie betreibt, sondern eher psychologische, soziale oder kognitive Gründe zu suchen.
Gruppengröße und Verhandlungen
Ein wichtiger Einflußfaktor bei der Lösung sozialer Dilemmata ist die Gruppengröße30. Es wäre zum Beispiel denkbar, daß Individuen miteinander verhandeln und sich in selbstbindenden Verträ- gen darauf einigen, Beiträge zu leisten. Dies ist in kleinen Gruppen durchaus vorstellbar. In größe- ren Gruppen sind Verhandlungen wegen der prohibitiv hohen Transaktionskosten jedoch ausge- schlossen31. Es ist unvorstellbar, daß sich alle Autofahrer in Verhandlungen darauf einigen, ihre Autos stehen zu lassen.
Gruppengröße und soziale Normen
Die Gruppengröße hat auch entscheidenden Einfluß auf die Herausbildung sozialer Normen. Wenn eine Belegschaft aufgefordert wird, einen Beitrag zu einem Betriebsfest zu entrichten, wird dazu jeder bereit sein und auf keinen Fall an dem Fest teilnehmen, ohne seinen Beitrag geleistet zu haben. Anders als beim Homo oeconomicus zählt in kleinen überschaubaren Gruppen nicht nur der Gewinn, sondern auch das soziale Ansehen. Es können sich Normen, wie der Zwang zur Kooperation in Gemeinschaftsangelegenheiten, herausbilden32. Durch soziale Ächtung bestehen funktionierende Sanktionsmechanismen gegen Schwarzfahrer33. Normen werden in spieltheoreti- sche Modelle in Form einer neuen Spielregel integriert. Heinz Holländer hat in einem Aufsatz die Entstehung solcher Normen untersucht34. Normen seien als das Ergebnis eines sozialen Aus- tauschprozesses zu begreifen, in dem Menschen Beiträge zur Erstellung von öffentlichen Gütern leisten, um dadurch soziale Anerkennung zu erhalten.
Schwieriger wird die Durchsetzung sozialer Normen in großen Gruppen. Die Individuen kennen sich nicht mehr gegenseitig und können aus der Anonymität heraus die Schwazfahreroption nutzen. So ist zu beobachten, daß in ländlichen Gemeinden eine höhere Bereitschaft zur Nutzung öffentlicher Wertstoffsammel-Kontainer besteht als in Großstädten.
Rolle des Staates
Wie schon in älteren Ansätzen, zum Beispiel der Picot-Steuer, fällt es auch in Situationen sozialer Dilemmata leicht, nach dem Staat zu rufen, der die Individuen zur Kooperation zwingt. Die reich- haltige Palette von Maßnahmen, die dem Staat dazu zur Verfügung steht, wird im dritten Teil dieser Hausarbeit diskutiert. Bei allen staatlichen Lösungsversuchen sollte man aber immer im Hinterkopf behalten, daß Regulierungen über den Staat nur die zweitbeste Lösung sind35. Staatli- che Eingriffe verursachen immer Kosten, die im Fall freiwilliger Kooperation nicht entstanden wä- ren. Steuern müssen eingetrieben werden, Verbote überwacht und Verstöße bestraft werden.
Ein weiterer Kritikpunkt gegen Eingriffe des Staates ist, daß nicht gewährleistet ist, daß diese wirklich das wie immer auch definierte "Allgemeinwohl" im Auge haben36. Gründe dafür seien im politischen und administrativen System zu suchen.
2.1.3.4 Fazit
Insgesamt zeichnet die ökonomische Theorie für freiwillige Kooperationen im Umweltbereich ein recht düsteres Bild. Die Ansätze zur Internalisierung von externen Effekten scheitern, wie die Pigou-Steuer, an ihrer praktischen Umsetzung. Verhandlungslösungen, wie Coase sie vorschlägt, lassen sich auf Umweltprobleme nur selten anwenden, da meistens der Fall "Viele Verursacher - viele Geschädigte" vorliegt und Verhandlungslösungen aufgrund der hohen Transaktionskosten nicht möglich sind.
Die Spieltheorie versucht Situationen klar zu definieren, in denen es zur Kooperation kommt. Die Betrachtung sozialer Dilemmata zeigt allerdings, daß rationale Individuen immer die Schwarzfah-rer-Option wählen anstatt zu kooperieren. Die mit externen Effekten verbundenen Allokationsprob- leme, und damit auch die meisten Umweltprobleme, sind in einem dezentralen System, das allein auf individuellen Entscheidungen beruht, nicht zu lösen, weil eine Lösung Kooperation und damit irrationales Verhalten voraussetzt37. Dieses Dilemma läßt sich nur dadurch lösen, daß entweder vom Menschenbild des Homo oeconomicus abgewichen wird oder dem Staat die Aufgabe überge- ben wird, die Individuen durch Veränderung der Rahmenordnung zur Kooperation zu zwingen.
Diese Ergebnisse und insbesondere die Kritik am Homo oeconomicus, lassen viel Raum für ande- re theoretische Ansätze, denen es vielleicht besser gelingt, Kooperationssituationen zu modellie- ren. Der evolutionstheoretische und der ethische Ansatz werden nun im folgenden vorgestellt.
2.2 Ethische Konzepte
2.2.1 Vorwort
Der Duden versteht unter Ethik „die Lehre vom sittlichen Wollen und Handeln des Menschen in verschiedenen Lebenssituationen“. Zumal alles Handeln umweltabhängig bzw. umweltbezogen ist, können Handlungen, die phänomenologisch gleich erscheinen - z.B. kooperatives Handeln -, in verschiedenen Situationen mit ihren unterschiedlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen völlig anders einzuschätzen sein.38
Die Ethik bietet im Gegensatz zur Ökonomik kein Wissen an, das unmittelbaren ökonomischen Nutzen verspricht. Sie kann nur auf fundamentale Weise zum kritischen Nachdenken über Produk- te und deren Probleme beitragen. „Jede gewinnbringende Ware oder Unternehmung - vom Auto über die Flugreise bis zur Energiegewinnung - hat einen ökologisch wunden Punkt. Was auch nur im Verdacht steht, die Umwelt zu schädigen, ist schwerer zu verkaufen.“39 Aus diesen Gründen wird u.a. das stärker werdende ökologische Engagement der Akteure deutlich, da in fast allen gegenwärtigen Krisen „die Wirtschaft“ zentral beteiligt ist. Es genügt daher nicht mehr, rational- ökonomisches Handeln zu rekonstruieren, sondern es auch zu beurteilen bzw. zu kritisieren, und zwar nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch daraufhin, ob es als ethisch begründet er- scheint.
Aufgrund der aufgeführten Argumente liegt es nahe, besonders hier nach den moralischen Bezü- gen der Akteure, der Manager bzw. der Unternehmen zu fragen und gegebenenfalls Ansatzpunkte für eine Überwindung der Krisen auszumachen. Inwieweit die Ethik mit der Ökonomik Hand in Hand bei der Lösung der Probleme gehen kann, bzw. ökonomisch rational agierende Institutionen mit deren Bezugsgruppen kooperieren können, wird in der vorliegenden Hausarbeit nachgegan- gen.
2.2.2 Abgrenzung: Ökonomik und Ethik
Eine erste disziplinorientierte Unterscheidung geht davon aus, daß die Ökonomik eine auf wirtschaftliches, die Ethik eine auf moralisches Handeln gerichtete Wissenschaft ist.40 Beides sind also theoretische Disziplinen: So wie sich die Ökonomik als Wirtschaftstheorie von der tatsächlichen Wirtschaft unterscheidet, unterscheidet sich die Ethik als Moraltheorie von der tatsächlichen Moral, d.h. den herrschenden Normen und Werten.41
Beide Disziplinen betrachten das Problem der sozialen Ordnung, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven. Die klassische Ökonomie will die soziale Ordnung über die unsichtbare Hand desMarktes herstellen.42 Die ökonomische Theorie setzt dabei auf den Eigennutz der Individuen, welche einerseits den Altruismus ausschließt und andererseits den Egoismus fördert.43 Im Gegensatz dazu versucht die Ethik das Ziel der sozialen Ordnung durch allgemeine und freiwillige Befolgung verallgemeinerungsfähiger Normen zu erreichen - und dies jenseits der individuellen Vorteilskalkulation. Ziel der Ökonomik wie der Ethik ist es u.a., die Möglichkeiten freiwilliger Kooperation, d.h. ohne Zwangsmaßnahmen, aufzuzeigen.
2.2.3 Normenbegründung: Theoretische Positionen der Ethik
Traditonsgemäß wird die Ökonomik, eine auf egoistisches Verhalten aufgebaute Wissenschaft beschrieben. Doch die neuere Ökonomik ist offen gegenüber Zielsetzungen beliebiger Art, die insbesondere auch altruistischen Charakter haben kann.44 Doch wie lassen sich in der Ökonomik Normen begründen, die einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit einräumen und von den Akteuren auch eingefordert werden können ? Zur Beantwortung dieser Frage reicht es hier aus, zwei ethische Lager der Normenbegründung zu unterscheiden
2.2.3.1 Non-Kognitivismus
Der Non-Kognitivismus steht in deutlicher Nähe zur Ökonomik, da er sehr konsequenzialistisch45 eingestellt ist: Er bestreitet die rationale Begründbarkeit und damit die Allgemeinverbindlichkeit von Werturteilen. Es kommt vielmehr auf die Nützlichkeit bzw. auf das Ergebnis von Handlungen an, und nicht auf die Handlung selbst: Wenn man die Handlungsalternative X anstrebt, dann wird sich mit einer Wahrscheinlichkeit von P das Ergebnis Y einstellen. Damit sind Normenbegründungen aus non-kognitivistischer Perspektive hypothetische Imperative, d.h. man spricht darüber welche Handlungen einzusetzen sind, um bestimmte Ziele zu erreichen. „Hypothetisch“ bedeutet in die- sem Fall nicht, daß das Ergebnis unrealistisch ist, sondern daß es unter bestimmten Bedingungen zutreffend sein kann.
2.2.3.2 Kognitivismus
Der ethische Kognitivismus geht im Gegensatz zum Non-Kognitivismus davon aus, daß durch den Gebrauch von rational begründbaren Normen, die in der Vernunft verankert sind, ein Zugang zu dem eben genannten Begründungsproblem gefunden werden kann. Der Kognitivismus überprüft die Handlungen, Interessen und Präferenzen von Individuen auf ihre ethische Rechtfertigung. Kognitivistische Normenbegründungen legen also Handlungsregeln zugrunde. Es handelt sich dabei um inhaltlich unbestimmte Normen, wie dem kategorischen Imperativ von Kant („Handle stets so, als ob die Maxime deiner Handlung jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Ge- setzgebung gelten könnte“).46
Die heute einflußreichste kognitivistische Ethik ist die Diskursethik (der herrschaftsfreie Diskurs).47 Diese gibt allerdings nicht selbst schon inhaltliche Vorschriften oder Handlungsregeln darüber an, was zu tun sei, sondern fordert lediglich die bestmögliche Einhaltung einer Verfahrensregel, die besagt, wie man z.B. in Konfliktsituationen zu allgemeinverbindlichen inhaltlichen Normen kommen kann. Alle strittigen Fragen werden innerhalb eines freien Diskurses durch konsensfähige Argu- mente entschieden. Ein Diskurs ist gekennzeichnet durch die Norm einer unvereingenommenen, sachverständigen, zwanglosen und nicht-persuasiven Verständigung aller vom Problem Betroffe- nen.48 Hierbei setzt sie am Problem an, daß es immer mehr Betroffene, aber immer weniger Betei- ligte an wirtschaftlichen Entscheidungen gibt.49 Hintergrund der Diskursethik ist vor allem die Über- legung, daß Individuen diejenigen Regelungen am ehesten umsetzen, an deren Entscheidung sie selbst beteiligt waren. Die Nichteinhaltung bestimmter Normen durch einige Individuen kann da- durch weitestgehend begrenzt werden.
2.2.4 Normendurchsetzung: Der systematische Ort der Moral in der Markt- wirtschaft
Die Verfechter der klassischen Marktwirtschaft, wie Milton Friedman sehen die soziale Verantwor- tung der Unternehmen in dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip: „The social responsibility of busi- ness is to increase its profits.“50 Solange Gewinne erzielt werden, wird jegliches wirtschaftliche Handeln in einer Marktwirtschaft ethisch legitimiert. Eine systematische Annäherung beider Diszip- linen ist dadurch allerdings nicht gegeben. Erst mit den auftretenden und spürbar werdenden sozialen und ökologischen Problemen begann eine ethische Hinterfragung ökonomischer Prinzi- pien, wie z.B. der Gewinnmaximierung. Doch inwieweit die Ethik in der Ökonomik diffundiert ist unweigerlich mit der Frage verbunden, welchen systematischen Ort die Moral in der Marktwirt- schaft haben soll. Mit anderen Worten: Wie können sich (Kooperations-)Normen im egoistisch geprägtem Wettbewerb durchsetzen ?
Die Frage der Normendurchsetzung wird in unterschiedlicher Form durch unterschiedliche Theo- rien begleitet, die im folgenden beschrieben werden: In Deutschland haben sich drei Konzepte etabliert, die sich dieser Fragestellung angenommen haben. Hinsichtlich der Definition von Wirt- schafts- und Unternehmensethik bestehen keine Differenzen. Wirtschaftsethik bezieht sich nach allgemeinen Verständnis auf die Ebene der Wirtschaftsordnung (Schaffung der Rahmenbedingun- gen) und die Unternehmensethik wird schließlich auf die Ebene des einzelnen Unternehmens bezogen. Allerdings herrscht zuweilen Uneinigkeit darüber, welchen Stellenwert die Unterneh- mens- gegenüber der Wirtschaftsethik haben soll.51 Sie gehen zunächst alle von einer Theorie der Gesellschaft aus, die aber in ihrer Theorie der Normenbegründung entweder kognitivistischer oder eher non-kognitivistischer Natur sind. Sie unterscheiden sich also in der Bewertung der Ethik und der Ökonomik, d.h. ob sie sie gleichwertig betrachten oder ob sie die eine Disziplin über die andere stellen und damit gleichzeitig eine Dominanz beanspruchen.
2.2.4.1 Eine non-kognitivistische Betrachtung: Wirtschafts- und Unternehmensethik als Institutio- nenökonomik
(→ Karl Homann)
Die institutionelle Rahmenordnung bildet bei Homann den Schwerpunkt des ethischen Problems in der Wirtschaftsethik.
„ Die Bedeutung des Ordnungsrahmens für das moralische Handeln von Individuen und Unter-nehmen kann heute von niemanden mehr bestritten werden. Es ist insbesondere der Wettbewerb (der selbst eine ethische Begründung hat), der moralische Ideale und Normen nur dann durch einzelne (Unternhemen) zur Geltung kommen lassen kann, wenn diese auch für die Konkurrenten verpflichtend sind. In unserer Sprache:Der systematische Ort der Moral in der Marktwirtschaft istdie Rahmenordnung.“52
Damit siedelt Homann die Ethik bzw. die Moral zunächst in der Wirtschaftsordnung und nicht im Unternhemen selbst an. Homann spricht in diesem Sinne auch von Spielregeln und von Spielzü- gen. Demnach soll die Moral in den Spielregeln, und der Wettbewerb in den Spielzügen zur Gel- tung kommen.53
a) Wirtschaftsethik - die Konzeption einer Rahmenordnung
In dem Konzept von Homann ist die Rahmenordnung ethisch-normativ zu ermitteln und für die Unternehmen wettbewerbsneutral auzugestalten. Homann geht in seinem Konzept axiomatisch von einer Marktwirtschaft aus, in der Markt und Wettbewerb innerhalb der Rahmenordnung festge- legt sind. „Markt und Wettbewerb sind nicht nur effizient, sondern sind das bisher beste bekannte Mittel zur Verwirklichung der Solidarität aller Menschen und haben daher im Prinzip eine ethische Rechtfertigung.“54 Solidarität wird hier als die Zusammenarbeit der Menschen unter produktiven Regeln verstanden. Damit wird der Wettbewerb durch die Rahmenordnung ethisch legitimiert.
Der Wettbewerb und seine Dilemmastrukturen
Wie im Gefangenendilemma der Untersuchungsrichter nicht zwischen wahren oder falschen Ges- tändnissen unterscheiden kann, so kann der Markt nicht unterscheiden, ob z.B. ein Unternehmen im Wettbewerb wegen mangelnder Leistungsfähigkeit nicht mehr mithalten kann oder ob er aus moralischen Motiven nicht mehr mithalten will. Mit anderen Worten: Leistungschwäche und morali- sches Handeln werden im Wettbewerb gleichermaßen benachteiligt. Daher würden in modernen Gesellschaften altruistisch agierende Unternehmen eher aus dem Markt fallen. Es würde deswe- gen nach Homanns Einschätzung wenig helfen, wenn man von einem Unternehmer verlangen würde seine egoistischen, strategischen Handlungen durch eine altruistische, moralische Vernunft zu ersetzen. Mit anderen Worten: Man kann von den Unternehmern nichts verlangen, was ökono- misch keinen Sinn macht.55 Ein einzelnes Individuum kann sich eben diesen Strukturen, auch mit moralischen Vorleistungen56, nur schwer entziehen, da die ökonomische Handlungslogik wie ein Damokles-Schwert über die Unternehmen wacht. Der Wettbewerb weist nach Homann folglich Strukturen eines Gefangenendilemmas auf. Denn auch der prinzipiell kooperative Akteur würde die defektive Lösung in einer Gefangenendilemma-Situation wählen, wenn er annimmt, daß die andere Person ihm Schaden zufügen kann.
Gefangenendilemma-Strukturen bewirken demnach kollektive Selbstschädigungen.57 Werden im Wettbewerb schließlich öffentliche Güter zerstört, und dies ist fast immer der Fall, dann müssen von der Rahmenordnung her, dafür verantwortliche Dilemmastrukturen verhindert werden. Dilem- mastrukturen können nach Homann beherrschbar und produktiv sein, wenn es beispielweise gelingt mit der Schaffung von Anreizen, Kooperation ökonomisch lohnend zu gestalten. Theore- tisch bedeutet dies, daß man durch Änderung der Auszahlungsmatrix ein anderes Spiel erhält, in dem allgemein unerwünschtes Verhalten schon deswegen unterbleibt, weil es sich nicht lohnt. Wären Anreize nicht gegeben, dann würde der einzelne Akteur nur solange kooperieren, solange ihm aus seiner Vorteilskalkulation keine Nachteile bei einer Kooperation entstehen. Moral wird damit nicht zu einer individuellen Tugend, sondern zu einer Art Spielregel im Wettbewerb, die die Effizienz des Marktes bewahren soll. Ethik ist demnach paradigmatisch Wirtschaftsethik und Teil des betriebswirtschaftlichen Instrumentariums.
b) Unternehmensethik
Bei einer perfekt konzipierten Rahmenordnung werden auf der Ebene der Wirtschaftsethik die Individuen und Institutionen von ihrem unternehmerischen Handeln ethisch freigesprochen. Unternehmensethik - in dem Sinne, daß bei ethisch fragwürdigen Entscheidungen der rational agierende Unternehmer eine wirtschaftliche Lösung gegen eine normative Alternative eintauscht - wäre in einer perfekten Rahmenordnung theoretisch nicht begründbar. Dies ist zunächst aus der ethischen Perspektive eine rein non-kognitivistsiche Verhaltensweise, weil sie konsequentialistisch ist und das Ziel über die Handlung selbst stellt.
Homann konzidiert allerdings, daß eine perfekte Rahmenordnung praktisch nur schwer zu realisieren ist.58 Als Grund weist Homann u.a. hier auf unvollständige Verträge hin. Es handelt sich hierbei um Verträge, die komplex, kontingent und langfristig sind sowie mit Informations- und Transaktionskosten verbunden sind, und so nicht alle in der Zukunft liegenden Eventualitäten verzeichnen.59 Als Beispiel können hier internationale Abkommen genannt werden.60 Daher relativiert Homann seine Eingangs zitierte grundlegende These: „Der systematische - keineswegs einzige - Ort der Moral in der Marktwirtschaft ist die Rahmenordnung.“61 Bei einer difizitären Rahmenordnung müßte die Unternehmensethik die Rolle des Lückenbüßers übernehmen und etwaige Defizite dort ausgleichen, wo die Rahmenordnung nicht entsprechend etabliert ist. Dies ist aus systematischen Gründen immer mehr oder weniger der Fall.62 Bei Defiziten der Rahmenordnung bzw. bei unvollständigen Verträgen haben die Unternehmen nun zwei Strategien:
- Eine Wettbewerbsstrategie zur Verbesserung der Marktposition durch moralische Vorleistungen.63 Hier wird moralisches Engagement als Wettbewerbsparameter verstanden.64
- Eine politische Strategie zur Realisierung ethischer Forderungen durch Beiträge zum kollektiven Handeln. Damit wird auf eine Beeinflussung des Verhaltens der Konkurrenten gezielt und die Bereitschaft erklärt, sich als Gegenleistung ebenfalls den neuen Regeln zu unterwerfen.65 Dies kann z.B. über Branchenvereinbarungen66 geschehen.
Beide Strategien zielen letztendlich auf die individuelle Vorteilskalkulation. Zwar wird - und das sei vorweggenommen - von Homanns Kritikern oft vorgeworfen, daß sich seine rational agierenden Individuen und Institutionen in bestimmten Situationen strenggenommen doch kooperativ verhalten und demnach zu einem mehr normativ-stimulierten Verhalten tendieren müssen. Demgegenüber argumentiert Homann, daß eine augenscheinlich kooperative Handlung, auch ökonomisch einen Sinn macht - also rational geplant sein kann -, wenn bestimmte Vertragsdefizite durch Kooperation zum ökonomischen Vorteil behoben werden. Schließlich sind nach Homann Kooperation und Moral im Unternehmen als Instrumente zur Realisierung der Organisationsziele zu interpretieren.67
2.2.4.2 Kognitivistische Institutionenökonomik
Im Gegensatz zu der ökonomisch ausgerichteten Zielorientierung Homanns, spielen in den folgenden kognitivistischen Konzepten von Steinmann/Löhr und Ulrich, auch nicht wirtschaftliche Ziele eine Rolle. Damit wird die Bedeutung des Gewinnstrebens und der Wettbewerbsmechanismen zwar nicht gemindert, aber durch die kognitivistische Betrachtungsweise relativiert.
2.2.4.2.1 Unternehmensethik als Ordnungselement(ÆSteinmann/Löhr)
68 a) Der Wettbewerb und seine Konflikte
Im Mittelpunkt der Überlegungen von Steinmann/Löhr stehen Konflikte, die weder von dem Koor- dinationsinstrument des Marktes noch von der staatlichen Ordnungspolitik beseitigt werden kön- nen.
Die Markt- bzw. Wettbewerbswirtschaft bildet dabei das Standbein wirtschafts- und unterneh- mensethischer Überlegungen. Der Wettbewerbsbegriff wird allerdings, im Gegensatz zur neoklassischen Gleichgewichtstheorie, dynamischer aufgefaßt, da es für die Autoren aus Gründen der Konfliktregulierung manchmal sinnvoller ist, aus ethischen Überlegungen auf gewisse Gewinn- chancen zu verzichten. An dieser Stelle werden neue unternehmerische Handlungsmaxime gefor- dert. Gegenüber dem klassischen erwerbswirtschaftlichem Prinzip soll das Prinzip der gesell-schaftlichen Verantwortung im Sinne einer interessenausgleichenden Rolle der Unternehmensfüh- rung gegenüber den Bezugsgruppen treten, und eine mehr verständigungsorientierte Funktion einnehmen. Wäre die regulative Wirkung des Preismechanismus allein eine Bedingung, um die friedliche Koordination wirtschaftlicher Handlungen dauernd zu sichern, dann könnte man die Rolle des Managements auf das erfolgsorientierte Handeln beschränken.69 Als Konsequenz müßten politische Verständigungsprozesse dort Platz ergreifen, wo das ökonomische System, via optimale Allokation, die friedliche Koordination allein nicht mehr bewältigen kann.
b) Unternehmensethik
Die Definition von Unternehmensethik, nach Steinmann/Löhr ist aus der Analyse des Nestlé Skandal entstanden:70
„Unternehmensethik umfaßt alle durch dialogische Verständigung mit den Betroffenen begründe- ten bzw. begründbaren materialen und prozessualen Normen, die von einer Unternehmung zum Zwecke der Selbstbindung verbindlich in Kraft gesetzt werden, um die konfliktrelevanten Auswir- kungen des Gewinnprinzips bei der Steuerung der konkreten Unternehmensaktivitäten zu begren- zen.“71
Prinzipielle Richtigkeitsvermutung des Gewinnstrebens
Die Defizite des Markt- und Preissystems, welche z.T. den Schutz relevanter Interessengruppen unterlaufen, sollen durch eine Art Moralkodex gedeckt werden. Dieser Moralkodex versteht sich als „Dienstleistung der Unternehmensführung gegenüber den Bezugsgruppen“.72 Nach Steinmann kann aber nur eine langfristige Existenz des Unternehmens eine solche Dienstleistung sichern. Hierzu sind allerdings ausreichende Unternehmensgewinne erforderlich. Das Gewinnstreben erhält in dem Konzept von Steinmann/Löhr demzufolge eine „ prinzipielle Richtigkeitsvermutung “ und wird dabei keineswegs als unethisch diskriminiert.
Steinmann/Löhr gestehen aber ein, daß einzelne Unternehmen nur unter bestimmten Bedingun- gen in der Lage sind moralischen Forderungen in einer Wettbewerbswirtschaft nachzugehen. Allerdings bestehen sie weiterhin darauf, daß Unternehmen, sofern sie über eine hinreichende Rentabilität verfügen, auch die notwendigen Handlungsspielräume besitzen, moralische Forderun- gen zu erfüllen.73 Im praktischen Fall könnte dies bedeuten, daß die Unternehmen bei ausreichen- der Rentabilität beispielsweise Vorreiterrollen im ökologischen Bereich einnehmen sollten.74
Falls aber Unternehmen über diese Rentabilität nicht verfügen, besteht die Gefahr, daß die harte ökonomische Logik eingreift, und die Unternehmen um der Existenzsicherung willen auf der Stre- cke bleiben. Das Gewinnprinzip kann daher nur formaler Natur sein. Als Formalziel des unterneh- merischen Handelns benötigt das Gewinnstreben aber noch eine hinreichende Bedingung. Im Prinzip sind auch solche Mittelwahlen vereinbar, die zwar zur Erreichung des Gewinnzieles beitra- gen, aber ethisch nicht gerechtfertigt sind. Steinmann/Löhr halten an dieser Stelle eine genauere Betrachtung der Ziele und der Mittelwahlen für notwendig. Denn vom Übergang des Formalzieles (Gewinnerzielung) eines Unternehmens zum Sachziel (Unternehmensstretegie) durch bestimmte Mittelwahlen (Strategierealisierung), können Konflikte bei den Bezugsgruppen entstehen und so den Frieden gefährden. „Besonders unter den Imperativen der Strategierealisierung, lassen sich Ethik und Effizienz auf der Ebene der Managementfunktionen versöhnen.“75
Diskursethik76 als kommunikative Rationalität
Das Sachziel zur Erreichung des Formalziels sowie die Mittel zur Erreichung des Sachziels müs- sen also selbst noch einmal ethisch begründet werden. Dies ist dann auch der Ort, wo die Unter- nehmensethik situationsgerecht ansetzen muß - nämlich auf der Ebene der Entscheidungen -, weil die Betroffenen mit den Konsequenzen solcher Entscheidungen, in positiver als auch in negativer Hinsicht, leben müssen. Auf der Ebene des Sachziels gäbe es sehr wohl Handlungsspielräume, sonst wäre eine strategische Unternehmensplanung nicht möglich. Die Unternehmensethik müsse immer dann bemüht werden, wenn weder die sprachfreie Koordination des Marktes noch rechtli- che Regelungen zu ethisch sinnvollen Lösungen führen.77 Damit bedeutet Unternehmensethik nicht nur erfolgstrategisches, sondern auch verständigungsorientiertes Handeln.78
Das Fundament der Unternehmensethik kann bei Steinmann/Löhr nur dialogisch sein, d.h. auf einen diskursethischen Konsens beruhen. Neben den schon angeführten Determinanten der Dis- kursethik (Zwanglosigkeit, Unvoreingenommenheit etc.) erfolgt eine weitere Differenzierung der Sachverständigkeit zwischen technischen und normativen Fragen. Für die technischen Probleme sind die Experten verantwortlich, weil nicht von jedem Betroffenen verlangt werden kann, sich in technischen Sophistiken zurechtzufinden. In solchen Fällen, wo ein Konsens aller eingeschränkt möglich ist, sollen die Entscheidungsträger in einem fiktiven Diskurs durch einfache Pro- und Contra-Argumentation, das sich einstellende Defizit beheben. Dasselbe gilt auch für unternehmeri- sche Entscheidungen, die aus zeitlichen Gründen eine schnelle Abwicklung verlangen. Jedoch sei hier eingeräumt, daß die Experten für ihre getroffenen Entscheidungen Rechenschaft gegenüber den Betroffenen abzulegen haben. Steinmann bezeichnet diese praktische Form der Disursethik als kommunikative Rationalität.
Unternehmensethik als friedensstiftende Selbstverpflichtung
Unternehmensethik ist laut Steinmann und Koautoren demnach eine Lehre vom friedensstiftenden Handeln der Unternehmensführung79 bei Konflikten mit deren Bezugsgruppen. Diese Lehre be- steht in diesem Konzept vorrangig in dem Entwurf von geeigneten Verhaltensvorschriften zum friedlichen Umgang mit Konflikten.80 Die Unternehmensethik muß auf Selbstverpflichtung setzen, weil die Orientierungskraft einer ethischen Norm aus nichts weiter als der Einsicht in die Tragfähig- keit ihrer Begründung wächst.81 Für die Unternehmer gilt hier, Regeln der Selbstbeschränkung zu etablieren, die als ethische Kodizes publiziert werden und eine Reputationswirkung entfalten kön- nen. Die Selbstverpflichtung durch einen Moralkodex bildet einen Schwerpunkt der Unterneh- mensethik bei Steinmann/Löhr, denn ohne sie, würden Individuen zur Bewältigung von Konflikten auf das bestehende Recht, im Sinne eines Ordnungsrahmens zurückgreifen wollen. Der systema- tische Ort der Moral in der Marktwirtschaft wäre damit auf allen Entscheidungsebenen zu etablie- ren.
c) Wirtschaftsethik
Die Unternehmensethik muß von der spezifischen Ausprägung der marktwirtschaftlichen Ordnung und ihrer Handlungsvoraussetzungen ausgehen. Die Wirtschaftsethik ist der Unternehmensethik demnach zwar vorgelagert, doch macht die moralische Selbstverpflichtung eine Notwendigkeit zur integrativen Dynamik zwischen Wirtschafts- und Unternehmensethik zwingend. Veränderte ge- samtwirtschaftliche oder auch kultruelle Rahmenbedingungen sollten sich daher innerhalb der Wirtschaftsethik stets begründen, damit ein ethischer Status Quo verhindert werden kann. „Und es ist gewiß auch die Aufgabe von Unternehmen, sich an einem solchen Dialog zu beteiligen.“82
2.2.4.2.2 Integrative Institutionenethik(ÆPeter Ulrich)
Peter Ulrich hält die klassische, auf Adam Smith zurückgehende marktwirtschaftliche Ordnungs- konzeption für überholt, weil sie insbesondere mit den negativen externen Effekten83 wirtschaftli- chen Handelns nicht fertig wird. Das liberale Grundaxiom der Harmonie zwischen einzelwirtschaft- lichem und gesamtwirtschaftlichem Nutzen ist offensichtlich widerlegt, d.h. was für das einzelne Unternehmen gut ist, kann auf der Makroebene zu Schaden führen. So kann z.B. die Versenkung einer Ölplattform für das Unternehmen geringe Kosten verursachen, gesamtwirtschaftlich aber zu derartigen Umweltschäden führen, daß die Kosten der externen Effekte letztendlich höher einzu- stufen sind. Das ökonomische System belastet auf diese Weise immer weitere ökologische Le- bensbereiche.
a) Kommunikative Vernunft
Das Ziel von Ulrich ist nun die ökonomische Rationalität selbst zur Vernunft zu bringen, und zwar durch eine Transformation ihres tayloristischen Fundaments in ein kommunikatives Fundament im Sinne der Diskursethik. Ulrich spricht in diesem Zusammenhang von kommunikativer Vernunft, also der Fähigkeit des Menschen zum argumentativen Dialog. In den Unternehmen soll sich eine „kritisch-normative Konsensbildung über Sinnzusammenhänge“ etablieren, denn nach Ulrich „ist die dialogische Verständigung im ökonomischen Bereich unterentwickelt“, weil immer noch be- stimmte Rationalitätsmuster ihre Gültigkeit beanspruchen.84 Als gutes Beispiel kann hier u.a. die Operationalisierung des homo oeconomicus genannt werden; also dem Versuch, den Menschen zu objektivieren. Dadurch werden die Mittel und die Zwecke der Betriebswirtschaft immer irrationa- ler.
Als ein wesentliches Hindernis auf dem Wege zu dieser kommunikativen Verständigung identifiziert Ulrich das Fehlen einer demokratischen und offenen Unternehmensverfassung, die eine Verbesserung der Kommunikationskultur und -struktur gewährleisten soll. Die (Diskurs-)Ethik erhält in diesem Konzept Priorität auf allen Ebenen der Wirtschafts- und Unternehmensethik, die im folgenden kurz skizziert werden sollen.
b) Ebenen einer integrativen Wirtschafts- und Unternehmensethik
Die oberste Ebene bildet die unbegrenzte kritischeÖffentlichkeit aller mündigen Bürger. Sie ist zuständig für den unverzichtbaren Basiskonsens jeder Gesellschaft über politische Grundregeln. Die nächste Ebene spaltet Ulrich in zwei Stufen auf:
- „Die republikanische Unternehmensethik begründet die ordnungspolitische Mitverantwortung des Unternehmens.“85 Damit lehnt Ulrich, im Gegensatz zu Homann, eine ethische Entlastung der Unternehmen durch eine Rahmenordnung ab.86
- Die zweite Stufe bildet die Geschäftsethik. Sie „beschäftigt sich mit der Suche nach innovativen strategischen Synthesen von Ethik und Erfolg innerhalb der gegebenen Rechtsordnung.“87 Für Ulrich sind Unternehmen gesellschaftliche Einrichtungen, die zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele errichtet werden. Die Schwierigkeit bestimmte Ziele zu erreichen, liegen in den verschiedenen divergierenden Interessen der Betroffenen - innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Um einen funktionierenden Betrieb zu gewährleisten, muß das Management diese divergierenden Interessen zum Ausgleich bringen können. Als Instrument bietet Ulrich dafür eine Dialogethik an, die als Konsensusmanagement bezeichnet werden kann.
c) Konsensusmanagement
Das Konsensusmanagement muß normativ, strategisch und operativ ausgerichtet sein, damit allen Beteiligten und Betroffenen bei ökonomischen Entscheidungen die Chance eingeräumt werden, „ihre Vorstellungen von Lebensqualität, ihre Bedürfnisse und ihre Interessen zur Geltung zu brin- gen.“88
Das normative Management ist für den Aufbau unternehmenspolitischer Verständigungspotentiale zwischen der Unternehmung und den Interessengruppen verantwortlich. Sie ist dadurch für die Funktionsfähigkeit eines Unternehmens unentbehrlich und bildet das Fundament des strategischen und operativen Managements. Das strategische Management dient dem Aufbau strategischer Erfolgspotentiale. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß die betroffenen Gruppen über ein unge- fähres Machtgleichgewicht verfügen. Hier will Ulrich die Partizipationsrechte der vom unternehme- rischen Handeln Betroffenen als Grundrechte verankern, so daß alle - und nicht nur ökonomisch rationalen - sondern auch legitimen Interessen der Beteiligten zur Geltung kommen können. Machtgleichgewichte können beispielsweise durch eine Transformation des Privateigentums in ein neutrales Eigentum (z.B. Stiftung) erreicht werden. Erst dann können über eine kollektive Präfe- renzordnung die Unternehmensstrategien festgelegt werden.89 Die unternehmerische (Gewinn- )Zielfunktion wird dadurch von einer multidimensionalen Zielfunktion ersetzt. Ulrich setzt damit die traditionelle ökonomische Zweckrationalität der Shareholder-value-Gemeinschaft auf den Prüf- stand. und sozialökonomisiert sie.
Diese Überlegungen mögen für den einen oder anderen gerade in heutiger Zeit naiv klingen, aber die noch junge Konvergenz zwischen Kapital und Arbeit, bestätigt meiner Meinung nach den Trend, die Moral mit der Rentabilität zu versöhnen. Auch Steinmann/Schreyögg resümieren konziliant, daß die „Moral selbst einen Abbruch der traditionellen Neigungen verlangt.“90
Fixierte bzw. genormte Verfahrensregeln im operativen Management zum Aufbau der Produktivi- tätspotentiale, werden durch eine regulative, offene Unternehmensverfassung bei Ulrich ersetzt.
Mit anderen Worten: Es gibt in diesem Konzept keine Ethik, die inhaltliche Bestimmungen vorgibt, sondern die auf eine „Öffnung politisch-ökologischer Willensbildung hinarbeitet.“91
2.2.5 Kritik und Vergleich der Konzepte
Kritik an der non-kognitivitischen Perspektive
Die non-kognitivistische Ethik hat - vergleichbar mit der Ökonomik - mit Mittel-Zweck-Relationen zu tun; d.h. sie geht bei der Normenbegründung von einer individuell-rationalen Interessenverfolgung aus. An dieser Stelle liegt auch einer der Hauptkritikpunkte, die man im Konzept von Homann ausmachen kann: die axiomatische Betrachtung des homo oeconomicus. Auch wenn Homann gelegentlich anführt, daß nicht alle Menschen tatsächlich rationale Egoisten sind, so geht er den- noch systematisch von einer non-kognitivistischen Ethik aus. Diese Annahme birgt einige Schwie- rigkeiten in sich, die schon im Kapitel 2.1. eingehend behandelt wurden, und an dieser Stelle nun nicht mehr wiederholt werden müssen.
Kooperation ist in dem Konzept von Homann sicherlich kein Akt der „Nächstenliebe“, sondern folgt einfach dem marktwirtschaftlichem Kalkül der Maxime. Solange Kooperation sich ökonomisch positiv(er) auswirken kann, wird auch der Egoist in seinen Handlungsentscheidungen Kooperati- onsbereitschaft signalisieren. Daß aber Kooperationsgemeinschaften geschlossen werden können, die sich vornehmlich dem Wohl der Umwelt widmen, sind im Konzept von Homann nicht existent, da rein normative Beweggründe ausgeschlossen werden. Nur wenn die Rahmenordnung Defizite aufweist, kann die Unternehmensethik bestehende Löcher als Lückenbüßer ausfüllen. Selbst wenn die Unternehmensethik bei Homann, im Fall einer defizitären Rahmenordnung, eine ökonomische Begründung hat, lassen sich etwaige unvollständige Verträge auch auf soziale Kommunikation oder auf normative Motive zurückführen. Die Überwindung von Dilemmastrukturen verlangt aber auch eine diskursethische bzw. kognitivistische Eigenschaft der Akteure Dies läßt Homann letzt- endlich ungeachtet. Im Ergebnis zeigen diese Überlegungen, daß es nicht möglich ist, eine rein non-kognitivistische Ethik konsequent durchzuhalten.
Darüberhinaus fehlen im Konzept von Homann Angaben darüber, wie die Rahmenordnung aus- gestaltet werden müßte, damit Gefangenendilemma-Strukturen operationalisierbar gemacht wer- den können. Besonders dann, wenn die Etablierung von Normen durch den Konsens aller abgelei- tet wird, bleibt die Axiomatisierung des homo-oeconomicus fragwürdig. Setzt man schlichtweg egoistische Verhaltensweisen aller Individuen voraus, so wäre es nicht zu erklären, warum Bürger zur Wahl gehen.92
Kritik an der kognitivistischen Perspektive
Beide kognitivistischen Ansätze unterscheiden sich von dem pragmatischen Ansatz von Homann insbesondere dadurch, daß sie die Ethik in der Ökonomik systematisch zu integrieren versuchen. Dies macht sich u.a. dadurch deutlicht, daß die Unternehmensethik bei Steinmann/Löhr und Ulrich keine Lückenbüßerfunktion, sondern Teil der betriebswirtschaftlichen Instrumentarien ist. Der systematische Ort der Moral in der Marktwirtschaft ist nicht allein in der Rahmenordnung, sondern auf allen Ebenen der Entscheidungen zu suchen. Bei Steinmann/Löhr wird aber aus praktischen Gründen die Diskursethik durch die kommunikative Rationalität relativiert. Ulrich zieht hingegen die unbegrenzte kritische Öffentlichkeit aller mündigen Bürger in den Diskurs ein. In der betrieblichen Praxis kann dies allerdings zu einer Lähmung der notwendigen Handlungsbeweglichkeit in einer Wettbewerbswirtschaft führen.93 Die Einbeziehung der Öffentlichkeit in den Diskurs ist sicherlich ein Fortschritt gegenüber dem „kalten“ Konstrukt eines homo oeconomicus, es läßt aber Zweifel aufkommen, ob wirklich alle Bürger über die nötige ethische Kompetenz und moralische Verantwortung verfügen. Zumindestens läßt Ulrich diese Option offen.
Die potentielle Handlungsunfähigkeit ist aber auch bei Steinmann gegeben, aber meiner Meinung nach mit einer geringeren Intensität. Als praxisfern erweist sich auch die Vorstellung von Ulrich, daß vor der Festlegung der Unternehmensstrategien eine kollektive Präferenzordnung ausgebildet werden muß. Wenn dem so ist, würden nach Steinmann/Löhr die Beteiligten in einem „luftleeren Raum“ diskutieren.94
Die Diskursethik, so kooperationsfördernd sie auch sein mag, kann das Trittbrettfahren geradezu herausfordern, da bei der Frage, wer für die Kosten öffentlicher Güter aufkommen muß, leicht zu „Gunsten“ aller abgestimmt werden kann, und letztlich nicht derjenige sie trägt, der sie verursacht hat. In dem Konzept von Steinmann allerdings, sollen Unternehmen, die über eine gewisse Renta- bilität verfügen, Vorreiterrollen übernehmen. Fraglich ist nur, wie hoch die Rentabilität sein muß, damit das ökologische Engagement aktiviert werden kann. Eine reine Selbstverpflichtung reicht meiner Meinung nicht aus. Eine Ulrich`sche Transformation der Eigentumsordnung in Richtung neutralisiertes Kapital, kann zwar eher umweltökonomische Kooperationen initieren, bei roten Zahlen aber, darf man bei der Suche nach Verantwortlichen gespannt bleiben. Gerade das Tragen der Verantwortung für ein finanziell abgesichertes Unternehmen, läßt mehr die ökonomischen Prinzipien im Wettbewerb eingreifen. Die sehr moralische Vorstellung von Ulrich zur Bildung einer multidimensionalen Zielfunktion, lassen mich zweifeln, ob eine Shareholder-Gemeinschaft oder Manager auch moralische Interessen an ihre Kapitaleinbringung haben können. Ganz ausschlie- ßen möchte ich es nicht.
Es läßt sich nicht bestreiten, daß heute Manager u.a. moralische Ziele neben Rentabilitäts- und Gewinnzielen haben. Jedoch ordne ich persönlich diese Zielorientierung, ähnlich wie Homann, integrativ dem Gewinnstreben zu. Mineralölkonzerne verkaufen homogene Produkte, die sich lediglich in ihrer Farbe unterscheiden. Wenn es dem einen Konzern gelingt, beispielsweise über Imagebildung, dem Käufer einen gewissen Zusatznutzen (z.B.umweltfreundlich Förderung) zu geben, so kann sich dies positiv über den Umsatz auswirken.
Weitere Anregungen und Möglichkeiten, Umweltkooperationen zu etablieren, werden im Kapitel 5 "Fazit und Anregungen" genannt.
2.3 Der evolutionstheoretische Ansatz
„Evolutorische Prozesse sind durch die Fähigkeit charakterisiert, systemerhaltende Strukturen und Funktionen hervorzubringen.“95
Dieses Phänomen, Autopoese genannt, ist wahrscheinlich der Auslöser des Interesses wissen- schaftlicher Disziplinen an der aus der Biologie stammenden Evolutionslehre. Diese kann mit der Annahme von begrenzter Rationalität und durch Neuerungsmechanismen mit Umweltkomplexität umgehen. Diesem dynamischen Prozeß von Wandel und Entwicklung werden Erkenntnisgewinne nachgesagt, wo mechanische Modelle versagen. Der Evolutionsgedanke wurde als heuristisches Prinzip in nahezu allen Disziplinen aufgenommen. Diese (Teil)arbeit beantwortet die Frage, ob Kooperation, besonders Kooperation im Umweltbereich, durch die Evolutionstheorie erklärt werden kann und wo ihre Grenzen liegen. Praktische Implikationen folgen hauptsächlich im Kapitel drei der Gesamtarbeit.
Im ersten Abschnitt dieser Arbeit werden zwei Grundmechanismen der biologischen Evolution dargestellt. Die dem neuzeitlichen Menschen zugrundeliegenden erweiterten Evolutionsmecha- nismen stehen in einem soziokulturellen Kontext und werden im zweiten Abschnitt erläutert. Ab- schnitt drei wendet sich der Thematik des kooperativen Handelns zu. Im Gegensatz zur ökonomi- schen Theorie ist Kooperation durch die Evolutionstheorie erklärbar. Drei Theorieansätze werden dazu vorgestellt, die mit den erarbeiteten Grundlagen in eine Kooperationsthese münden. Umwelt- bewußtes kooperatives Handeln wird anschließend diskutiert. Dort findet sich auch die Beurteilung der Relevanz der erarbeiteten Aussagen der Theorie im Vergleich zur beobachtbaren Realität. Die Kritik findet sich im fünften Abschnitt wieder.
2.3.1 Evolutionsbiologie
Die Evolutionsbiologie und die Funktionsbiologie sind weitestgehend getrennte Gebiete der Biologie. Der Zweig der Funktionsbiologie befaßt sich mit der Frage der Organisation eines Systems. Die Evolutionstheorie befaßt sich dagegen mit der Kontinuität des Lebens, mit der Vererbung und der Erklärung der Vielfalt des Lebens.96 Eckpunkt der Evolutionsbiologie stellt Charles Darwin mit seinem 1859 veröffentlichtem Werk „Origin of Species“ dar. Daraus entwickelte sich die „Synthetische Theorie der Evolution“, die als Grundlage dieser Arbeit dienen soll.97
Evolution wird als fortschreitende Entwicklung definiert. Die biologische Definition zeichnet sich durch die Nennung ihrer Fokusse aus, demnach ist Evolution eine „Genpooländerung im Zuge der Generationenfolge mit dem Ergebnis der Höherentwicklung“98. Die Betrachtungseinheit der Evolutionstheoretiker ist im allgemeinen die Population und ihr Genpool, ihr genetisches Variationspotential. Diese Arbeit wird sich jedoch auf den ursprünglichen individualistischen Akzent von Darwin beziehen.99 Die Höherentwicklung erfolgt durch natürliche Selektion, die richtende, auslesende Kraft anhand von Merkmalsausprägungen (Phänotyp)100, die durch das zugrundeliegende Gen bestimmt werden. Die Wirkung der Selektion wird im nachfolgenden erklärt.
2.3.1.1 „Survival of the fittest“
Der Erklärungsansatz der Evolutionsbiologen richtet sich auf den Genotypus, auf das genetische Informati- onsprogramm eines Systems. Im Genotypus jedes Organismus sind Reaktionsmuster auf äußere Signale hinterlegt. Sie sind Ergebnis von zufälligen Selbstorganisationsprozessen des Organismus nach Naturgeset- zen im Kampf um das Dasein. Der Genotypus bedingt den Phänotypus, der bei jedem Organismus variiert. Zeichnet er sich durch vorteilhafte Eigenschaften im Überleben in der umgebenen Umwelt aus, besitzt der Organismus Selektionsvorteile. Die Selektion überleben nur die am besten an ihre Umwelt angepaßten Organismen („survival of the fittest “). Diese besitzen die beste Möglichkeit, Nachkommen zu zeugen.101 Dadurch werden sich die überlegenen Organismen gegenüber der Ursprungsform immer stärker durchset- zen und diese verdrängen, so entstehen Arten.
Evolution wird amÜberleben der Akteure und deren Replikationserfolg gemessen.
Kommt es zu relevanten Veränderungen in der Umwelt, wird das System entweder zugrunde gehen oder durch weitere Anpassung bestehen. Dieses geschieht durch zufällige Evolutionsmechanismen, deren Er- gebnis entscheidet, ob sie zum Überleben des Systems führen. Mit der evolutionären Perspektive läßt sich somit aus der Flut der Veränderungen des Systems in Bezug zur Umwelt die Wichtigkeit einer Anpassung an die Umwelt (Adaption) bestimmen.102 Dieses zeichnet den evolutionären Ansatz aus, es macht ihn sys- temerhaltend.
2.3.1.2 Versuch und Irrtum / Mutation und Selektion
Wie kommt es jedoch zu der Flut der Veränderungen? Die Synthetische Evolutionsbiologie nennt drei Basismechanismen: Mutation, Rekombination und Isolation, alle entstehen zufällig. Die Mutation sowie die Rekombination erhöhen die Variationsbreite des Genpools des Individuums. Die Isolation führt zu einer Trennung von Populationen und führt unter Umständen aufgrund von Nischenbildung zur Entwicklung von Tochterarten.103 Evolutionsmechanismen stellen somit einen Versuch im Versuch- Irrtum- Prozeß dar. Ihre Existenzchance wird durch die Selektion bewertet, oft stellen sie sich als Irrtümer heraus und werden nicht überleben.
Das Besondere des „Versuch-Irrtums-Prinzips“ ist die Vielfalt an Möglichkeiten. Es baut auf seine eigenen Ergebnisse und Strukturen auf und findet so auf vielen Ebenen statt. Überall wird in kleinsten Schritten experimentiert, somit erfolgt ein schrittweises Herangehen an die lokalen Umweltbedingungen oder -änderungen. Dadurch kann die Komplexität der Umwelt voll durchdrungen, wenn auch nicht im Ganzen erfaßt werden.
Das„Versuchs-Irrtums-Prinzip“ist ein optimales Suchverfahren zur Anpassung an die Umwelt.104 Mit dieser Darstellung der für diese Arbeit relevanten Grundlagen der Evolutionsbiologie, wird dieser Themenbereich verlassen. Die Theorie der soziokulturellen Evolution stellt ein Bindeglied zwischen biologischer Evolution und der Theorie der menschlichen Kooperation dar und wird daher im folgenden dargestellt.
2.3.2 Theorie der soziokulturellen Evolution
Die Theorie der soziokulturellen Evolution versteht „den historischen Prozeß des sozialen Wandels von Kulturen als einen langfristigen Evolutionsprozeß“.105 Damit ist der Zusammenhang von Kultu- ren, also deren Leistungen, Werke und Lebensbekundungen, Gegenstand der Analyse. Die evolu- tionäre Sichtweise führt uns zu der Frage, wie die Kultur des Menschen entstehen konnte.
2.3.2.1 Der evolutionäre Erfolg des Menschen
Die bisher erarbeiteten Grundlagen sind ihrem Prinzip nach für alle biologischen Systeme gleich. Jedoch hängt das Gleichgewicht zwischen den Evolutionsmechanismen hauptsächlich von drei Faktoren ab: der Populationsgröße, also dem verfügbaren genetischen Material, dem Umfeld und dem Lernvermögen des betrachtenden Systems. Der Mensch zeichnet sich besonders durch die Möglichkeiten seiner Lernprozesse gegenüber anderen Spezies aus. Es geht weit über das mole- kular vorprogrammierte Lernvermögen niederer Lebensformen hinaus.106 Daraus schuf er sich im Laufe seiner Evolution erlernte Verhaltensregeln, seine Kultur. Die aus dem erweiterten Lernver- mögen resultierenden besonderen Fähigkeiten des Menschen, werden im folgenden beschrieben.
2.3.2.1.1 Die Kommunikation
Kommunikation ist die Anpassung an den Partner um eine Eindeutigkeit der Verständigung zu erreichen. Für Kommunikation ist das Erkennen der eigenen Art anhand von chemischen Erken- nungszeichen die Voraussetzung. Zu diesen chemischen Reizen kommen taktile107 und optische, die die Stimmung und Reife des Partners verdeutlichen. Die zweite Phase der Kommunikation ist die Körpersprache, z.B. Imponiergehabe und Rituale. Damit kann die Stimmung und Absicht des Partners erkannt werden und die eigene kundgetan werden. Die Lautsprache ist die dritte Phase, die als Signalsystem besonders außerhalb von Sichtkontakt, genutzt wird. Der Mensch hat sie zur ausdifferenzierten Sprache weiterentwickelt, die die Verständigung zwischen Individuen erleichtert. Sie ist Mittel zur Diffusion von Informationen und führt somit zur Kohärenz im gesamten System.108 Die Phasen der Kommunikation werden vom Menschen nach wie vor in gemilderter Form zur Verständigung angewandt.
2.3.2.1.2„theory of mind“
Nach dem Archäologen Randall White fand die kulturelle Explosion der Menschen vor ungefähr 40000 Jahren, während der Eiszeit statt. Die erschwerten Lebensbedingungen und die Nahrungsknappheit führten zu einem Zusammenrücken der Stämme und zur Bildung von Zweck-Allianzen. Das Leben in sozialen Verbänden erfordert bestimmte geistige Fähigkeiten zur Reduktion von Komplexität im sozialen Gefüge. Hier ist die „theory of mind“ herauszuheben, die Fähigkeit des Menschen, Vermutungenüber das Denken und Fühlen Anderer anstellen zu können. Damit verbunden sind auch Kompetenzen der Selbstreflexion, die Interpretationsmöglichkeit der Wirkung der eigenen Handlung auf andere. Die Selbstreflexion ermöglicht dem Menschen auch ZukunftsSzenarien zu entwerfen und bezüglich der eigenen Person zu bewerten.109
2.3.2.1.3 Die emotionale Intelligenz
Der Mensch hat im Laufe seiner sozialen Evolution Emotionen als Signalsysteme entwickelt. Emo- tionen unterrichten den Menschen über sein Verhalten in sozialen Beziehungen und lassen an- hand der Reaktion auch die Wirkung der eigenen Handlung erkennen. Emotionen wirken damit ex ante sowie ex post. Ex ante führen sie instinktiv zu bestimmten Handlungsmöglichkeiten, dieses entlastet den Menschen in der Auflösung der sozialen Komplexität. Ex post sind sie ein Hilfsmittel der Bewertung der eigenen Handlung und somit eine Hilfe für zukünftige Aktivitäten.110
2.3.2.2 Erweiterte Evolutionsmechanismen des Menschen
Diese speziellen Fähigkeiten des Menschen beeinflussen seine Evolution. Es gelten erweiterte Evolutionsmechanismen, d.h. es treten zusätzliche Funktionen beim Variations-, Selektions- und Bewahrungsmechanismus auf.111
Variationsmechanismus
Das Lernen des Menschen macht es ihm möglich, auch absichtsvoll und zielgerichtet Varianten des Phänotyps zu erzeugen, was zu einer Vielzahl von Varianten in Populationen führt. Dies bedeutet die Ausbildung von Charakteren. Diese können wiederum zielgerichtet durch das Versuchsund Irrtumsprinzip Varianten ihres Verhalten bilden, damit ist in der menschlichen Spezies ein hoher Grad an Neuerungsmöglichkeiten gegeben.
Selektionsmechanismus
Der Mensch hat aufgrund seiner Fähigkeit des Entwurfes von Zukunfts-Szenarien, die Möglichkeit der internen Selektion. Er kann sich die Folgen seiner Handlungen bewußt reflektieren und Hand- lungsalternativen von Anfang an ausschließen. Dieses führt zu einer Entschärfung des Überle- benskampfes.
Bewahrungsmechanismus
Die Bewahrung von selektierten Varianten über Vererbung kann bei der menschlichen Spezies durch soziokulturelle Diffusion erweitert werden. Mittel sind die Sprache, Schrift sowie moderne Kommunikationsmittel. Schnelle Informationsverteilung über erfolgreiche Varianten ist möglich, deren Verhalten dann durch adaptives Lernen imitiert werden. Somit ist durch Prägung auch eine Weitergabe erworbener Eigenschaften außerhalb von Vererbung im Lamark´schen Sinne möglich, damit verkürzt sich die Zeitdimension der evolutorischen Entwicklung. Das gesammelte Erfah- rungsgut des Menschen wird von Generation zu Generation weitergegeben, es drückt sich in Form von gesellschaftlichen Verhaltensregeln aus (Tradition). Dieses sind Konventionen, die als Richtli- nien für das Verhalten in der Umwelt und das Miteinander dienen und ist als Kultur definiert.112
2.3.3 Theorie der Kooperation
Die Grundlagen der biologischen und soziokulturellen Evolution sollen in diesem Teil die Erweite- rung um theoretische Konstrukte zur Erklärung von Kooperation erfahren. Das Ergebnis dieses Kapitels ist eine aus verschiedenen Theorieansätzen zusammengefügte These der Kooperation.
2.3.3.1 Theoretische Grundlagen
2.3.3.1.1 Verwandtschaftstheorie
Hamilton (1964) erklärt das Phänomen des Altruismus als Kooperationsform durch Sippenselektion („kin selection“). Bei der Sippenselektion wird der Fokus der natürlichen Selektion vom Individuum auf die Genverwandten gelegt. Da die individuellen Gene eines Organismus nicht einzigartig sind (sie finden sich in den Genen ihrer Verwandten wieder), handeln Organismen altruistisch, wenn dadurch die Überlebenschance naher Verwandter gesteigert werden kann (Maximierung derGesamtfitneß 113 ). Altruismus bedeutet demnach ein Verzicht auf individuellen Nutzen zugunsten Anderer, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten und zu erhalten. Je näher die Verwandtschaft ist, je stärker kann dieser individuelle Verzicht sein.
Kooperation tritt jedoch auch außerhalb von genetischer Verwandtschaft auf, z.B. bei Symbiosebeziehungen, einem meist lebenswichtiges Zusammenleben zwischen Arten. Dieses Phänomen kann mit der Verwandtschaftstheorie nicht erklärt werden.114
2.3.3.1.2 Reziprozitätstheorie
Trivers (1972) geht konträr zu Hamilton vom reziproken Altruismus als Kooperationsform aus. Reziproker Altruismus bedeutet für ein Individuum kurzfristige Kosten für eine Hilfestellung an andere in Kauf zu nehmen, in der Erwartung, daß diese Hilfeleistung in anderer Form zu einer anderen Zeit zurückgegeben wird. Diese Verhaltensweise breitet sich dann in einer Gesellschaft aus, wenn die Nettoerlöse die Kosten der Kooperation übersteigen. In der menschlichen Spezies hat sich der reziproke Altruismus in Systemen wie Freundschaft und Moral gefestigt.115
Reziproker Altruismus wird in evolutionären Ansätzen häufig der Reziprozität, d.h. der Gegenseitigkeit gleichgesetzt. Mit ihr kann Kooperation erklärt werden. So verfährt auch die Spieltheorie, die nachfolgend dargestellt wird.
2.3.3.1.3Spieltheorie
Die evolutorische Spieltheorie ist relativ jung, sie begann 1973 mit einer Veröffentlichung von Smith und Price. Ausgangspunkt waren Tierkampfmodelle um die Frage der verringerten Konkur- renz zwischen Tieren. Dann wurde das Instrumentarium der Spieltheorie benutzt um die wechsel-seitige Abhängigkeit der Individuen voneinander und daraus entstehende Kooperationserfolge aufzuzeigen. Sie ist somit mehr ein Erklärungsansatz als eine Theorie.116
Anhand zweier Computerwettbewerbe stellte Axelrod (1981) fest, daß kooperative Strategien sich bei wiederholtem Spiel selbst in einer feindseligen und egoistischen Umgebung als erfolgreichste Strategien durchsetzten. Die Wettbewerbsbedingungen waren die des klassischen Gefangendi- lemmas - bei Kooperation sind die Auszahlungen für beide Spieler am höchsten. Die Strategie „TIT-FOR-TAT“ („Wie du mir, so ich dir“) gewann beide Turniere, sie ist die Verkörperung von Reziprozität. Den evolutionären Erfolg verschiedener Entscheidungsregeln hat Axelrod durch eine Überprüfung ihrer Robustheit im Zeitablauf vorgenommen. Anhand einer ökologischen Analyse konnte die erfolgreichste, also die fitteste Strategie ermittelt werden; es gewann die Reziprozität. Auch alle anderen Gewinner auf lange Sicht waren kooperative Strategien, dieses führt uns zu der Frage, wie Kooperation entstehen kann.
2.3.3.2 Eine evolutionäre Kooperationsthese
Wie läßt sich nun anhand der Evolutionstheorie Kooperation oder Kooperationsverweigerung erklären? Was hat die Genstruktur eines Menschen mit dem Erfolg von Tausch- und Verleihbörsen zu tun? Wie hängt die Reziprozität mit einer scheinbar altruistisch kooperierenden Organisation wie „Brot für die Welt“ zusammen? Hilfe für diese Fragestellungen bietet die evolutionäre Sichtwei- se, indem sie hinterfragt, wie Kooperation überhaupt entstehen kann. Sie bietet eine dynamische Lösung in drei Zeitabschnitten an: die Kooperationsentwicklung in einer gänzlich unkooperativen Welt, die Anpassung des Phänomens in optimaler Ausprägung an die Umwelt und die Wider- standsfähigkeit von kooperierenden Individuen im Gesamtsystem im Zeitablauf. Nachfolgend wird hauptsächlich der erste Zeitabschnitt behandelt, die Frage, warum Kooperation entsteht.
2.3.3.2.1 Entstehung von Kooperation
Theoretische Ausgangslage ist eine Welt der individuellen Nutzenmaximierer, die sich in einem unkooperativen Gleichgewicht befinden, obwohl durch Kooperation höhere individuelle Auszahlungen erreichbar wären. Kooperation ist jedoch aufgrund der zugrundeliegenden Dilemma Situation nicht möglich (s. 2.1.3.3.3). Auch die Veränderung eines Individuums durch Mutation wird keine Kooperation entstehen lassen können, da seine Freundlichkeit durch die Egoisten ausgenutzt werden würde. Fände sich jedoch ein Kooperationspartner, hätten beide Partner höhere Auszahlungen, als die individuellen Nutzenmaximierer.117
Einen Ausweg aus dem unkoooperativen Gleichgewicht, bietet die Erklärung der Verwandtschafts- theorie. Im Tierreich finden sich zahlreiche Beispiele118, z.B. von sogenannten Helfern, die den in Verwandtschaft stehenden Eltern bei der Aufzucht ihrer Kinder Unterstützung leisten. Die daraus resultierenden Gesamtfitneßgewinne helfen den Eltern, sich verstärkt in der Population verbreiten zu können, dadurch erhöht sich auch das genetisch kooperative Material in der Population. Diese Theorie bietet jedoch nur die Erklärung für ein Zustandekommen von Kooperation in einer Art und innerhalb einer kleinen Gruppe verwandter Individuen. Besonders für die Kooperation zwischen Menschen, greift diese Erklärung zu eng.
Ein zweiter Erklärungsansatz erweitert die Verwandschaftstheorie um das Phänomen der Grup- pe.119 Der Mensch befindet sich in mehreren sozialen Gruppen, der Familie, einer Sippe, einer ethischen Gruppe oder einem Staat. Diese Gruppen beeinflussen seine Vorstellungen und Ziele und haben Einfluß auf seine individuelle Nutzenfunktion. Es kommt zu kooperativem Verhalten, wenn der Verzicht auf individuellen Nutzen zugunsten des Gruppennutzen vorgezogen wird („group selection“)120. Die Kooperationspartner erhalten höhere Auszahlungen als die individuellen Nutzenmaximierer. Durch Imitation der erfolgreichen Strategie, werden auch andere Individuen in der Gruppe kooperieren und es kommt zur Ausbreitung der kooperativen Strategie.
Die erweiterten Evolutionsmechanismen des Menschen machen es im jedoch auch möglich, daß durch Kommunikationsfähigkeit und Voraussicht Kooperation entsteht. Der Menschen kann aufgrund von Reziprozität kooperieren. Dieser Weg ist in einer gänzlich unkooperativen Welt schwierig und aufgrund hoher Transaktionskosten teuer, jedoch möglich. Der Kauf im Bäckergeschäft als Beispiel, hat weder etwas mit Verwandtschaft noch etwas mit Gruppenbildung zu tun. Der Bäcker verzichtet kurzfristig auf seinen eigenen Nutzen, indem er die Brötchen verkauft, anstatt sie selbst zu verzehren. Er hat die berechtigte Annahme, daß er dafür in Kürze entlohnt wird. Diese Entlohnung liegt über der individuellen Nutzenmaximierung.
Neben der Verdeutlichung der Möglichkeit der Impulsgabe auf kooperatives Handeln, zeigt dieses Beispiel auch, daß es in einer Gesellschaft zu etablierten Kooperationsformen ohne Dilemmasituation kommen kann. Dieses geschieht durch die Festigung von kooperativen Rahmenbedingungen. Wie eine Gesellschaft dieses Erreichen kann, wird im nachfolgenden erklärt.
2.3.3.2.2 Kooperation und Kultur
Die Impulsgeber Verwandtschaft, Gruppenzusammengehörigkeit und Reziprozität, sind wie Kooperationspioniere in einem unkooperativen Land. Ihre Möglichkeit der Erlangung von höherer Fitneß wird durch Diffusionsagenten in die Population getragen. Andere Individuen imitieren das kooperative Verhalten, so daß Kooperation nach und nach zu einem dominanten sozialen Modell wird. Diese festigt sich in der Umwandlung des Kulturguts, das aus den optimalen, d.h. bisher am besten, in dieser Population und in dieser Umwelt, bewährten Verhaltensregeln besteht. Dabei behalten die Individuen ihr rationales Denken bei, jedoch wird die Wertgröße individuelle Nutzenmaximierung durch Gruppendenken erweitert.
Bei entsprechenden Rahmenbedingungen kann der Mensch durch Voraussicht und Vertragsfähig- keit auch mit ihm unbekannten Menschen sowie bei einmaligen Transaktionen, aufgrund von Reziprozität, kooperieren.121 Dies ist ein einzigartiges Phänomen innerhalb der biologischen Arten.
2.3.3.2.3 Stabilität und Widerstandsfähigkeit
Eine Verhaltensweise hat sich in der Population etabliert, d.h. sie ist stabil, wenn sie nicht durch etwaige Mutationen unterwandert werden kann.122 Kooperative Verhaltensweisen sind stabil, da kooperative Individuen höhere Fitneß erhalten, als egoistisch handelnde Individuen. Diese Stabili- tät wird durch die Kultur unterstützt. So wird Verhalten und besonders unkooperatives Verhalten, als Signalwirkung für die generelle Charakteraussage über eine Person genutzt. Das Sprichwort „sein Ruf ist ihm vorausgeeilt“, bezeichnet genau diese Situation. So haben Menschen, die eine kooperative Reputation besitzen, wie z.B. der zahlt immer pünktlich, der ist zuverlässig, erheblich weniger Transaktionskosten bei einer Kooperation als andere.123 Elementar für die Widerstandsfä- higkeit von kooperativem Verhalten ist die Fähigkeit, unkooperatives Verhalten zu bestrafen. Eine Gefährdung durch Ausbeutung von kooperativen Akteuren ist sonst gegeben.124 Diese Bestrafung kann bei Verletzung von geltendem Recht auch durch den Staat ausgeführt werden.
Die Evolution ist eine Höherentwicklung in Richtung Optimalität. Die hier vorgestellte Überlegenheit der kooperativen Strategie ist nur solange gegeben, wie die Annahme der höheren Auszahlungen bei Kooperation gilt. Die Anwendung der Theorie der Kooperation muß demnach für jede biologische Spezies und für verschiedenen Anwendungsbereiche modifiziert werden. Im folgenden wird der Anwendungsbereich umweltbewußtes, kooperatives Handeln betrachtet.
2.3.3.3 Kooperation im Umweltbereich
Mit den fortschreitenden Fähigkeiten der Menschen, ist auch seine Entwicklung zunehmend rasanter gewor- den. Schon vor ca. drei Millionen Jahren lebten die Menschen in kleinen Gruppen zusammen125 begannen aber erst vor ungefähr 40000 Jahren mit fremden Gruppierungen zu kooperieren. Seßhafte Ackerbauer und Viehzüchter wurden sie vor ungefähr 10000 bis 6000 Jahren. Seitdem überschlägt sich die Entwicklung nach dem evolutionstheoretischen Sinne, denn 1000 Jahre bedeuten gerade 30 Generationen. Eine genetische Anpassung des Menschen an die heutige Entwicklungsgeschwindigkeit ist gar nicht mehr möglich. Der Mensch befindet sich genetisch immer noch in der Steinzeit126 und ist nach der reinen Evolutionsbiologie suboptimal an die heutigen Umfeldbedingungen angepaßt. Ein Beispiel ist die hohe Zunahme von Allergien. Sie belegen, daß der Körper des Menschen die Beeinträchtigungen in seinem natürlichen Umfeld nicht durch natürliche Selektion ausgleichen konnte.
Die Anpassung an die sich ändernden Umfeldbedingungen findet daher beim Menschen vornehmlich über den Phänotyp, d.h. über das Verhalten und die Kultur statt. So ist die Diskussion in der Gesellschaft zur Notwendigkeit des Umweltschutzes mit der zunehmenden Bedrohung für den Menschen gewachsen. Die Umwelt ist nach und nach als schützenswertes Gut deklariert worden. Gruppen sind entstanden, wie B.U.N.D. und Greenpeace, die sich die Rettung der Umwelt auf ihre Fahnen geschrieben haben. Sind diese Entwicklungen jedoch genug? Muß nicht jedes Individuum viel mehr leisten und andere Wertmuster annehmen, damit der Umweltschutz wirklich die Umwelt schützt?
In welcher Form kann auf diese Fragen die Evolutionstheorie Antworten geben? Ihre Möglichkeiten bestehen in normativen Erklärungen und Voraussagen, nicht in der Entwicklung von allgemeingültigen Gesetzen. Sie kann die Prinzipien, d.h. die Ursachen und Grundmechanismen aufdecken, die hinter einem Phänomen stehen. Außerdem bietet sie aufgrund dieser Prinzipien Muster-Voraussagen in der Form an, wie Menschen sich in einer bestimmten Situation phänotypisch ausprägen werden. Ihr kommt demnach die Aufgabe zu, die Bedingungen zu bestimmen, unter denen Kooperation im Umweltbereich möglich ist.127
Die Realität zeigt, daß eine gewisse Bereitschaft zur Kooperation bereits auf allen Ebenen der Gesellschaft zu finden ist. Staaten signalisieren ihre Kommunikationsbereitschaft (z.B. Umweltgipfel), Betriebe produzie- ren umweltfreundlich (z.B. Bioland, Blauer Engel), und Individuen beschränken marginal ihre eigene Nut- zenmaximierung. Das dieses jedoch nicht ausreicht, zeigen ständige Meldungen über die fortschreitende Schädigung an der Natur. Deswegen werden praktische Implikationen für kooperatives Handeln im Umwelt- schutz auf Ebene der Staaten, Betriebe und allgemein Gruppen im Kapitel drei aufgezeigt. Wie müssen sich jedoch die Menschen entwickeln, damit ein Überleben der Erde möglich ist? Es folgt ein Idealmodell.
2.3.3.3.1 Der ideale, umweltbewußte Kooperator
- Umweltschutz als Wertgröße im Zielsystem der Individuen und ihrer Kultur Aufgrund der Bedrohung der Fitneß des Menschen durch Umweltschädigung, hat der Umweltschutz im Zielsystem der Menschen eine hohe Wertstellung. Da die Umwelt ein öffentliches Gut darstellt, muß sich jedes Individuum an der Kooperation zu ihrem Schutz beteiligen. Die Gesamtfitneß der Spezies Mensch ist somit der Fokus der Entscheidung. Der Umweltschutz wird folglich als die generellen Verbesserungen der Möglichkeiten des Überlebens für die Spezies Mensch im Zeitablauf definiert. Bei einer Entschei- dungssituation wird somit die langfristige Perspektive via der kurzfristigen Nutzenmaximierung miteinbe- zogen.128 Da die Individuen ihre Normen und damit ihre Kultur prägen, besitzt der Umweltschutz auch in der Kultur eine hohe Wertstellung. Der Zweck besteht darin, ein Lebensumfeld für alle zu schaffen, daß das Überleben sichert (also besser ist, als das jetzige).129 Da für dieses Ziel die Kooperation eines jeden nötig ist, existiert eine soziale Wertgröße, die umweltbewußte Kooperation. Daraus entsteht eine externe und eine interne Gewissensinstanz.
- Externe Gewissensinstanz - Unterstützung durch das Gesetz und die Politik. Die Politik fördert durch ihre Institutionen die umweltbewußte Kooperation. Normen werden von Kindheit an initialisiert, daher beginnt die umweltbewußte Erziehung schon in der Schulzeit. Außerdem werden durch Gesetze und Sollvorschriften egoistische Handlungsweisen durch das Entstehen von Kosten bestraft. Umweltbewußte Kooperation wird dagegen gefördert.
- Interne Gewissensinstanz -„psychische Kosten“ 130 Die Verweigerung von Kooperation verursacht dem Individuum „psychische Kosten“ wie Schuldgefühl und Scham. Verhalten im Sinne der umweltbewußten Kooperation bringt ihm dagegen Zufriedenheit und ein positives soziales Ansehen. Das senkt die Transaktionskosten für weitere Interaktionen und Interak- tionen in anderen Bereichen sowie mit Fremden. Aus dieser Emotionalität entsteht auch die Bereitschaft auf die Einhaltung von Normen zu achten und notfalls andere bei Kooperationsverweigerung zu strafen.
Die Anreizsituation des Individuums in einer umweltbezogenen Entscheidung hat sich somit verändert. Die kurzfristige Fitneßmaximierung ist gegen die langfristige Perspektive ausgetauscht und damit die individuelle Fitneß gegen die Gesamtfitneß der Spezies Mensch. Die eigene Handlung soll die Umwelt weitestgehend nicht negativ beeinflussen, besonders weil dabei moralische Kosten entstehen, die den Gewinn des Übertritts in der Regel übertreffen.
Sind diese Bedingungen in unserer Gesellschaft zu erreichen? Wie ist dieses praktisch vorstellbar?
2.3.3.3.2 Beurteilung des Idealmodells
Ausgangsbasis ist die Bundesrepublik Deutschland und ein Individuum, dem der „administrative man“ zugrunde liegt, d.h. unsere heutige Situation. Erste Impulse sind durch Umweltverbände und Veröffentli- chungen in der Presse getätigt. Es gibt auch schon einige Menschen, die versuchen, umweltbewußt zu leben. Deren Erfolg wird durch Diffusionsagenten durch die Bevölkerung getragen. Jedoch reicht die Anreiz- situation oftmals wegen hoher materieller und geringer moralischer Kosten nicht aus, sich ebenso zu verhal- ten. Doch Umweltschutz verlangt die Kooperation von jedem und Verzicht auf individuellen Nutzen in hohem Maße. Der einzige Weg hin zur globalen Kooperation ist der Weg über die Gefährdung der Fitneß des Men- schen. Warnende Entwicklungen wie die 30 prozentige Impotenzrate der deutschen Bevölkerung, die Miß- bildung von Organen, neue Krankheiten wie Krebs und Aids etc., reichen bisher für einen generellen Werte- wandel nicht aus. Es fehlt das Umdenken in eine langfristige Zeitperspektive. Diese wird jedoch genau durch die enorme Schädigung der Umwelt den Individuen genommen. Katastrophenmeldungen wie die Abholzung des Regenwaldes, das Schmelzen der Pole durch die Klimaerwärmung, die enormen Umweltschädigungen bei der Industrialisierung der dritten Welt... - ein Faß ohne Boden. Die Zukunftsperspektive, der Lebenswille, der in unseren Genen steckt, wird durch die negativen Auswirkungen der menschlichen Entwicklung überla- gert. Auch andere Impulsgeber für Kooperation sind gefährdet. So geht durch die sinkende Familiengrün- dung der wichtige Impuls der „kin selection“ verloren. Die Massengesellschaften mit ihrer Ellenbogenmentali- tät lassen für „group selection“ keinen Platz. Dadurch entstehen bei einer Kooperationsverweigerung nur geringe moralische Kosten. Selten nur werden Umweltsünder ertappt und noch seltener bestraft. Besonders die Kritik an einem Fehlverhalten fehlt zunehmend, da durch die Individualisierung der Gesellschaft der Gruppenbezug oftmals verloren geht. Die materiellen sowie kulturellen (z.B. das Auto, das große Haus etc. als Statussymbol) Kosten für ein umweltbewußtes Verhalten sind dabei ungleich hoch.
Ein düsteres Bild zeichnet sich hier ab. Es stellt sich in diesem Kontext die Frage nach der Beurteilung der Evolutionstheorie.
2.3.4 Diskussion der Evolutionstheorie
Probleme und Kritik an der Evolutionstheorie werden hier in Ansätzen dargestellt. Dabei darf ihr Ursprung nicht vergessen werden. Die Evolutionsbiologie als Grundlage dieser Arbeit, findet bei den Kritikern ihre eigene Bewertung.131 Es ist jedoch legitim, sie für interdisziplinäre Arbeiten zu verwenden, weil sie empirisch belegt und dadurch glaubwürdig ist. Vorhandene Schwierigkeiten und Fehler der Grundlagenwissenschaft müssen jedoch in den darauf aufbauenden Arbeiten übernommen werden.132 So sind sich die Evolutionsbiologen nicht einig, ob die Sippenselektion die einzige Quelle für Kooperation bedeutet oder ob auch weitere Faktoren Kooperation auslösen können. Zusätzlich ist durch die einer Theorie innewohnender begrifflichen Vagheit, die Mißverständnisse hervorrufen kann, eine weitere Fehlerquelle gegeben. Sieht man von diesen Übertragungsfehlern ab, ergeben sich weitere Probleme.
Die Evolutionsbiologie versagt bei der konkreten Problemstellung dieser Arbeit. Erstens wegen dem bereits angesprochenen Grundlagenstreit und zweitens, weil die Entwicklungsgeschwindigkeiten die natürliche Selektion überrollen. Die genetische Ausstattung des Menschen paßt schon lange nicht mehr zu seiner Lebensumwelt. Er lebt in einer Massengesellschaft, mit Städtebildung und Anonymität, mit mehr technischen als persönlichen Kontakten, mit Individualisierungstrends contra der Familie, also mit einer inhaltlichen Verarmung der sozialen Umwelt. Seine Gene dagegen sind für starke soziale Kontakte, besonders familiäre, für Gruppen bis zu 150 Personen ausgerichtet. Sind damit auch die Grundprinzipien der Evolutionsbiologie nicht relevant? Nein, denn ihre Relevanz zeigt sich in der Realität. Der Mensch ist bedingt rational, d.h. er hat begrenzte Informationsaufnahme und -verarbeitungskapazitäten. Dieses unterstützt das „Versuch-Irrtum- Prinzip“, da nicht das ganze System, sondern nur der zu verändernde Teilausschnitt, betrachtet werden muß. Der Mensch handelt durch eine rationale, d.h. fitneßorientierte Anreizstruktur, die sich durch den Existenzkampf gebildet hat.
Diese Prinzipien werden in der Theorie der soziokulturelle Evolution um die Faktoren Emotionalität und Gruppendruck in einer Handlungsentscheidung erweitert. Auch dieses wird durch die Emperie bestätigt. Emotionale Entscheidungen unter Gruppendruck führen sowohl zu positiven sowie auch zu negativen Aus- wirkungen. Positiv ist die sich zwischen den Individuen entwickelnde soziale Interdependenz. Normen und Gruppendruck beeinflussen neben der Fitneßorientierung die Anreizstruktur der Entscheidung von Individu- en und sind somit ein möglicher Motor für Kooperation. Negativ dagegen ist die Ausbildung von Gruppen- denken. So wird häufig die eigene Gruppe und deren Normsystem als das einzig Richtige und Beste gese- hen. Die Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Gruppen geht damit verloren. Es kann zu Minimierung von gruppenexterner Kooperation, zur Eliminierung von gruppenexterner Bestrafung von Fehlverhalten, zu Fremdenfeindlichkeit und weiteren negativen Emotionen kommen.133 Dieses kann man an Schulklassen, Sekten aber auch ethischen Gruppen beobachten.
Die Gefahr des Gruppendenkens wird jedoch meist geringer, je größer die Gruppe ist. Obwohl die Mitglieder das gemeinsame Ziel der Gruppe vertreten, z.B. die Religion, weisen sie viele unterschiedliche Charaktere und persönliche Ziele auf. Es kann nicht von Kohärenz gesprochen werden und es kommt zu häufiger Migra- tion durch Kirchenaus und -eintritten. Die Normen der Religionen sind vielgestaltig und Kooperationsverwei- gerungen sind an der Tagesordnung. Sie können aufgrund der Größe und Anonymität der Gruppe auch nicht bestraft werden.134 Da ist das moralische Gewissen des Individuums gefragt, bei einem Fehlverhalten müssen moralische Kosten entstehen. Dieses wird bei der katholischen Kirche durch die Beichte repräsen- tiert. Die optimale Gruppengröße läßt sich jedoch nicht genau bestimmen, es entscheidet die Stärke des gemeinsamen Ziels (siehe z.B. den Zusammenhalt in der jüdischen Glaubensgemeinde).
Ein ganz anderes Problem stellt die Zeitdimension der Evolutionstheorie dar. Der Betrachtungszeitraum für genetische Veränderungen in Organismen ist langfristig. Das einzelne Individuum jedoch entscheidet auf- grund des Prinzips „survival of the fittest“ sehr situativ und damit kurzfristig. Eine Erweiterung seiner Zeitdi- mension erfährt das Individuum durch die Berücksichtigung der Sippenselektion in Form der Ermöglichung des Überleben der Gene in kommenden Generationen. Auch das Überleben der Gruppe beinhaltet die Berücksichtigung einer langfristigen Zeitdimension. Der Mensch ist außerdem durch Voraussicht in der Lage, sich langfristig zu orientieren. So sucht er häufig die soziale Bindung über die unmittelbaren Ziele hinaus.135 In der Realität haben jedoch die Familienbande abnehmende Bedeutung. Durch die geringe Geburtenrate entwickeln sich in vielen industrialisierten Ländern nur noch lineare Familienbeziehungen. Die durch Voraussicht entstandenen sozialen Bindungen, häufig Gruppenbindungen, sind nicht stabil.136 Sie brechen durch Migration (Schulklassen), Zielveränderungen (Berufsgruppen) oder -wegfall (Bürgerbewe- gungen) und wegen veränderter Umweltbedingungen (Kartelle) auseinander. Damit ist die nötige Langfris- tigkeit für die Kooperation im Umweltbereich nur durch Vernunft zu erreichen.
Am bundesweiten Aktionstag „Mobil ohne Auto“ am 15.06.1997 haben sich 400 000 Menschen beteiligt.137 Ist das Vernunft? Ist das Sippenselektion? Oder nur ein Tag, um die anderen 364 restlichen Tage mit dem Auto auszugleichen? Die Evolutionstheorie kann Gründe für die Beteiligung angeben, aber keine generellen Gesetzmäßigkeiten entwickeln. Auch sie bietet nicht die Patentlösung an. Jedoch soll mit einer positiven Vision, ausgehend vom erarbeiteten Idealmodell, die Teilarbeit geschlossen werden, mit der Hoffnung auf die Vernunft jedes Einzelnen!
„Es gibt Zeiten, da individuelle Wünsche und kooperative Bemühungen im Widerstreit liegen, und ohne Zweifelübt die Existenz sozialer Systeme einen gewissen Druck auf die in ihnen lebenden Individuen aus. Der Gewinnüberwiegt aber im allgemeinen bei weitem den Verlust, besonders dann, wenn wir das System als Ganzes betrachten und nicht nur einige Individuen darin, die vielleicht Schwierigkeiten bei der Anpassung haben.„138
3 Bedeutung von Staat, Betrieb und Gruppe im Kooperati- onskontext
Im folgenden Kapitel wird eine Synthese der drei vorgestellten Theorierichtungen versucht. Es wird die Rolle des Staates, des Unternehmens und des sozialen Umfelds bei der Entstehung von Kooperation untersucht. Auf diesen drei Ebenen der Kooperation werden schließlich konkrete Maßnahmen vorgeschlagen und die Grenzen der Kooperationsmöglichkeiten aufgezeigt.
Der Staat gibt die allgemeingültige Rahmenordnung vor. Sie ist die Ausformulierung von durch soziale Prozesse gewachsenen Normen, sowie Regeln zur Erleichterung der Durchführung von Interaktionen. Der Betrieb ist als zweckorientierte Institution ein wichtiges Element in den Entwick- lungsprozessen der Volkswirtschaft. Er ist die Ebene, auf der die Durchführung von umweltorien- tierter Kooperation erfolgen muß, da die Wirtschaft insgesamt Hauptschadstoffverursacher ist. Gruppen können auf alle Ebenen, auf den Staat, auf den Betrieb und auf das Individuum einwir- ken. Sind somit entscheidend für die Entwicklung und Ausprägung der Kultur, die die Handlungen aller beeinflußt.
3.1 Der Staat
"Als Staat werden die Institutionen bezeichnet, deren Zusammenwirken das dauerhafte und ge- ordnete Zusammenleben eines Staatsvolkes auf einen abgegrenztem Staatsgebiet gewährleisten soll und dies durch die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel hoheitlicher Gewalt auch bewirken können"139.
3.1.1 Rolle des Staates in den drei Theorierichtungen
Die Rolle des Staates beim Zustandekommen von Kooperationen wird in den drei Theorierichtungen sehr unterschiedlich gesehen.
Im Rahmen der ökonomischen Theorie kommen dem Staat drei Aufgaben zu. Erstens kann er Dilemmatasituationen, in die sich die Individuen durch rationale Nutzenmaximierung hineinmanövriert haben, durch Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenordnung aufbrechen. Durch Besteuerung kann er direkt in die Nutzenkalküle der Akteure eingreifen und so Situationen schaffen, in denen sich Kooperation individuell lohnt.
Zweitens kann er direkt die Produktion öffentlicher Güter übernehmen und somit den Individuen die Kooperation abnehmen. Dies geschieht in der Praxis in vielen Situationen in denen sonst mit "Schwarzfahrverhalten" zu rechnen wäre. Beispiele dafür sind das öffentliche Straßennetz oder die nachträgliche Beseitigung von Umweltschäden, für die sich kein Verursacher feststellen läßt. Drittens garantiert der Staat die rechtliche Rahmenordnung. Dies ermöglicht, wichtig zum Beispiel beim Coase-Theorem, Verhandlungen zwischen den Akteuren. Aus Sicht der Spieltheorie werden durch die Rahmenordnung bindende Verträge möglich. Nicht kooperative Spiele wandeln sich zu kooperativen Spielen, bei denen sich leichter eine pareto-optimale Lösung finden läßt.
In den ethischen Konzepten spielt der Staat soweit eine Rolle, daß er die Rahmenordnung für das Handeln der Akteure stellt. In diese Rahmenordnung fließen die Normen und die entsprechenden Moralvorstellungen ein. Im Konzept von Homann delegieren die Individuen und Institutionen ihre ethische und moralische Verantwortung an die Rahmenordnung und können dann - in den Grenzen dieser Ordnung - rational agieren. Nur wenn die Rahmenordnung nicht perfekt ist, trifft die Akteure eigene moralische Verantwortung.
Bei den kognitivistischen Konzepten von Steinmann und Ulrich herrscht die Diskursethik vor. Normen etablieren sich durch Konsens im freien Diskurs. Grundgedanke dabei ist, daß ein Individuum, welches an der Bildung der Normen selbst beteiligt ist, freiwillig bereit sein wird, diese Normen zu befolgen. Damit besteht prinzipiell keine Notwendigkeit der Übertragung der ethischen Verantwortung an eine Rahmenordnung. Diese Konzepte benötigen keinen Staat.
Eine latente Nähe zum Konstrukt "Staat" laßt sich bei Steinmann und Koautoren allerdings in der Einführung der kommunikativen Rationalität sehen. Beim Konzept der kommunikativen Rationalität diskutieren nicht alle von der Entscheidung betroffenen, sondern ein Expertengremium übernimmt die Konfliktregelung und muß sich im Nachhinein für die Entscheidungen ethisch rechtfertigen. Was Steinmann hier anführt, läßt sich meiner Meinung nach problemlos auf unsere Gewaltenteilung, "Mehrheitswahl" und Parteiensystem ausweiten.
In der Evolutionstheorie kommen dem Staat zwei Aufgaben zu. Er stellt auch hier die Rahmenordnung für individuelles Agieren. Zweitens soll er auch direkten Einfluß auf die Akteure nehmen, indem er versucht, zum Beispiel im Bildungsbereich, sie über den Wert von Gegenseitigkeit und Kooperation zu belehren. Denkbar wären auch Maßnahmen, die versuchen, den Jetzt-Bezug der Menschen zu überwinden, und sie hin zu einem längeren Planungshorizont zu erziehen. Ein Instrument in diese Richtung ist zum Beispiel die staatliche Förderung von vermögenswirksamem Sparen. Ein weiterer Ansatzpunkt sind staatliche Maßnahmen, die es den Akteuren erleichtern, Individuen, die sich früher kooperativ verhalten haben, zu identifizieren. Dies geschieht beispielsweise durch die SCHUFA oder polizeiliche Führungszeugnisse.
Nachdem jetzt eher theoretisch die Rolle des Staates in den verschiedenen Konzepten erklärt wurde, wird jetzt versucht aufzuzeigen, welche konkreten wirtschaftspolitischen Maßnahmen dem Staat zur Förderung von Kooperation zur Verfügung stehen:
3.1.2 Praktische Implikationen
Bei allen Überlegungen, staatliche Eingriffe zu fordern oder zu realisieren, muß das spezifische Entscheidungsumfeld beachtet werden. Folgende Dimensionen spielen hierbei eine Rolle:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten40 41 42 43
Dem Staat stehen, unter Beachtung oben genannter Aspekte, folgende wirtschaftspolitische Maß- nahmen zur Verfügung. Es wird versucht die Potentiale und Grenzen der einzelnen Maßnahmen zu beleuchten und zu zeigen, inwieweit sie sich auf die individuelle Kooperationsbereitschaft aus- wirken.
Schaffung von Niedrigpreis-Situationen
Unter der Schaffung von Niedrigpreis-Situationen versteht man Maßnahmen, die die individuellen Kooperationskosten der Individuen beziehungsweise der Beiträge, die sie zur Produktion eines öffentlichen Gutes leisten müssen, senken. Es handelt sich um Situationen, in denen ein Abwei- chen vom Eigennutz nicht viel kostet, aber ein moralisches Hochgefühl vermitteln, wie z. B. bei der Benutzung öffentlicher Flaschencontainer144. Beim Beispiel der Flaschencontainer könnte der Staat durch flächendeckende Bereitstellung der Container für eine Niedrigpreis-Situation sorgen. Seine Grenzen findet die Schaffung von Niedrigpreis-Situationen in der Finanzierung, da viele Maßnahmen einer Subventionierung von individuellem Verhalten gleichkommen.
Steuern und Subventionen
Durch die Einführung von Öko-Steuern kann es zu einer Internalisierung externer Effekte kommen. Die Steuer geht in die Kalkulation rational denkender Produzenten und Haushalte mit ein. Um Kosten zu senken, werden Individuen Kooperationen eingehen, solange die Kosten unter der zu erwartenden Steuerlast liegen.
Der Staat steht vor zwei Aufgaben. Er sollte die heute schon gezahlten Subventionen und Steuererleichterungen, wie z. B. in der Landwirtschaft oder beim Kohlebergbau, nach ökologischen Gesichtspunkten reorganisieren. Zweitens wäre eine Emmissionsbesteuerung oder Strafsteuern auf ökologisch schädliches Verhalten denkbar.
Die Festsetzung von Emmisionssteuern kann mit hohen Kontrollkosten verbunden sein. Auch ist darauf zu achten, die Steuer so zu gestalten, daß sie möglichst große Änderungen der Produkti- onsverfahren bewirkt und nicht einfach über die Preise an die Konsumenten weitergegeben wird145.
Verbote und Vorschriften
Verbote sind das im Umweltbereich am schnellsten wirksame Instrument. Ihre Durchsetzung ist jedoch mit hohem administrativen Aufwand für Kontrolle und Bestrafung verbunden. Verbote können insoweit Kooperationen, beispielsweise auf Unternehmensebene, fördern, daß sich Unternehmen zusammentun, um den Verboten zu entsprechen. Auch denkbar ist der Fall, daß Unternehmen, wie beim Grünen Punkt, kooperieren, um strengere Vorschriften abzuwehren. Kooperationen, die aufgrund von Verboten entstehen, stoßen an die Grenzen des Kooperationsbegriffs. Fälle, in denen sich eine Gruppe von Individuen direktem staatlichen Zwang beugt, sind wegen mangelnder Freiwilligkeit nicht mehr als Kooperation zu werten.
Nachträgliche Beseitigung der Schäden durch den Staat
Die nachträgliche Beseitigung von Umweltschäden durch den Staat, beispielsweise durch kommunale Kläranlagen oder ökologische Sanierungsprojekte in Ostdeutschland, ist privaten Kooperationen eher abträglich, da kein Anreiz zur Vermeidung der Schäden besteht146. Da die Allgemeinheit die Kosten trägt, verstoßen diese Maßnahmen auch gegen das Verursacherprinzip.
Bildungspolitische Maßnahmen
Eher langfristig angelegt sind Maßnahmen im Bildungsbereich. Es könnte versucht werden, das Ausbildungssystem so zu gestalten, daß der Wert von Gegenseitigkeit und Kooperation stärker vermittelt wird. Eine Ausbildung hin zu sozialer Kompetenz wäre wünschenswert.
3.2 Gruppen
Eine Gruppe wird durch die Interaktion von Individuen gebildet, die ein gemeinsames Ziel haben, aber mit unterschiedlichen Meinungen und Vorstellungen in die Gruppe eintreten. Gruppen sind somit Interessengemeinschaften mit unterschiedlichsten Ausprägungen, Zielrichtungen und Größen. Der Staat, die Partei, die Medienwelt, die Nachbarschaft, die Schulklasse, der Automobilclub, all dieses sind Beispiele für Gruppen.
In der klassischen Ökonomie wird aufgrund des Prinzips der individuellen Nutzenmaximierung ein Gruppeneinfluß als nicht existent betrachtet. Auf keinen Fall beeinflußt er das Individuum in seiner Entscheidungsfindung. Das Menschenbild des „homo oeconomicus“ sollte jedoch, wie in 2.1.3.3.4 argumentiert, durch das des „administrative mans“ abgelöst werden. Dieses Menschenbild wird dieser Betrachtung zugrunde gelegt, die sich mit folgender Frage beschäftigt: Wie wird der Einfluß der Gruppe auf die Kooperationsfähigkeit von Individuen innerhalb der drei Theorierichtungen gesehen. Der Fokus wird hier im besonderen auf ihren Einfluß auf kooperatives Handeln im Um- weltbereich gelegt.
3.2.1 Interner und externer Einfluß der Gruppe auf das Individuum
Das soziale Umfeld des Menschen wird durch Gruppen bestimmt. So liegen einem Menschen bei einer Entscheidung zu kooperativem Verhalten oder Kooperationsverweigerung externe und inter- ne Faktoren zugrunde. Interne Faktoren sind Verhaltensregeln und -ausprägungen, die sich durch die bisherigen Erfahrungen und Einflüsse des Individuum gebildet haben. Externe Faktoren sind durch die derzeitigen Umfeldsituation bestimmt. Ihr Einfluß auf eine Entscheidung bestimmt sich aus der Nutzenfunktion des Individuums. Beide Faktoren werden im nachfolgenden erklärt.
3.2.1.1 Interne Faktoren
Die Prägung des Verhaltens eines Individuum geschieht während seiner Entwicklung. Verschiede- ne Stadien mit wechselnden Einflußgruppen, wie Eltern, Kindergarten, Schule, Freizeitgruppe, Firmenkultur etc., werden durchlebt. In der Gesamtheit der Einflüsse spiegelt sich die Kultur der Gesellschaft wieder. Diese variiert die genetischen Reaktionsmuster des Individuums und formen so seinen Charakter sowie sein Wertsystem aus. So kennen wir z.B. Schamgefühl als Reaktion auf eine Lüge, Zorn aufgrund einer Beleidigung oder auch Dankbarkeit nach Erhalt einer Hilfestellung. Die Normen und die ihnen zugrundeliegenden Emotionen helfen dem Menschen durch Reakti- onsmuster ohne Voraussicht, ähnlich dem Reflexmechanismus, in einer Entscheidungssituation zu reagieren. Eine kooperative Kultur findet sich somit in variierter Form im Individuum wieder.
Es wirkt jedoch nicht nur die Gruppe auf das Individuum, sondern es besteht eine Wechselwirkung. So bilden die Mitglieder der Gruppe durch soziale Austauschprozesse eine Gruppennorm. Grup-pennormen werden nach außen vertreten und beeinflussen dadurch die Kultur. Es befindet sich somit auch die Kultur in einem ständigen Umwandelungsprozeß.
Die Gruppe beeinflußt zusätzlich die individuellen Nutzenfunktionen ihrer Mitglieder.147 Durch die Prägung der Wertvorstellungen ergeben sich bei den Individuen für das gleiche Gut unterschiedliche Auszahlungen. So wird ein Mitglied des Manta-Fahrer-Clubs andere Wertvorstellungen von der Umwelt als schützenswertes Gut als ein Mitglied vom B.U.N.D.
3.2.1.2 Externe Faktoren
Verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Zielen bedingen das Umfeld des Individuums. Daher muß der Mensch bei einer Entscheidung seine eigenen Präferenzen, sowie die Ziele der betroffenen Gruppen gegeneinander abwägen. Die Entscheidung, für ein Picknick Coladosen zu verwenden, wird sicher von einer umweltorientierten Gruppe stark gerügt werden, wobei der Verband der Aluminiumhersteller darüber sehr erfreut sein wird. Der Entscheider bewegt sich somit ständig in einem ständigen Abwägungsprozeß.
Nach der ökonomischen Theorie wird der Entscheider eine Kosten- Nutzen- Analyse innerhalb seiner bedingten Fähigkeiten zur rationalen Entscheidung durchführen und aufgrund dieser Basis kooperieren. Er wird sich normkonform entscheiden, wenn dadurch zwar ein marginaler individueller Nutzenverzicht geleistet werden muß, dieser jedoch durch das befriedigende Gefühl sich normkonform verhalten zu haben, ausgeglichen wird. Die Spanne des marginalen Nutzenverzichts wird dabei um so größer, je kohärenter die Gruppe in ihren Zielen und Wertvorstellungen ist. Diese Situation ist vornehmlich bei kleineren Gruppen zu beobachten. Dort können auch effiziente Verhandlungen bezüglich einer Entscheidung getroffen werden.
Durch den Diskurs ist der Entscheider in der Diskursethik in seinem Kooperationsgrad festgelegt. Seine Entscheidung fällt ihm daher nicht schwer, besonders weil er durch den Prozeß des Diskurs von dieser Lösung überzeugt ist.
Der Grad dieses individuellen Nutzenverzichts findet sich nach der Evolutionstheorie durch das Zugehörigkeitsgefühl des Individuums zu der Gruppe (group selection). Die Stärke dieses Gefühls sowie der relative Erfolg der Gruppe im Bestehen in seiner Umwelt gegenüber dem eigenen Erfolg, bestimmt die individuelle Kooperationsbereitschaft. Bürgerbewegungen wären hier ein Beispiel. Als einzelner Bürger kann man nur wenige Erfolge erzielen, schließt man sich jedoch kooperativ zu einer Bewegung zusammen, ist der Erfolg im allgemeinen größer.
3.2.2 Ergebnis
Die Entscheidung des Individuum ist somit bedingt rational, emotional und kulturell geprägt und auf die Situation bezogen.
Die Fähigkeit zur Voraussicht wird das Individuum dazu bewegen, so zu handeln, daß es sich in der Gesellschaft und vor sich selbst noch rechtfertigen kann. So führt die offene Bekenntnis, sein Altöl bewußt in die öffentliche Kanalisation entsorgt zu haben, zu gesellschaftlichem Protest. Diesem wird sich das Individuum nicht freiwillig aussetzen.
3.2.3 Praktische Implikationen
- Für die Organisation von Gruppen ist es insgesamt wichtig, daß sie:
- ein starkes, gemeinsames Ziel finden. Dadurch besitzen sie ein kohärentes Meinungsbild, haben somit eine höhere Kooperationsfähigkeit und weniger Ausbeutung innerhalb der Gruppe.148 Dieses vereinfacht auch eine Entscheidung durch Diskurs und Verhandlung.
- Dieses läßt sich häufig in kleineren Gruppen besser realisieren als in großen. Dort kann auch durch Wiedererkennung der Individuen ein Fehlverhalten sanktioniert werden.
- Gruppen müssen bereit sein zu bestrafen. Dies kann durch Reputationsschädigung, durch materielle Kostenentstehung (zahlen in die Vereinskasse z.B.) oder sogar indirekt über die Androhung von Ausschluß aus der Gruppe geschehen.
- Dieses führt auf die Notwendigkeit der Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten durch Gruppen zurück. Die Bestrafungen müssen mit einer Minderung des sozialen Ansehens einhergehen. (Z.B. der Ausschluß aus einem Golfclub wäre für manche neben dem Verlust des gesellschaftlichen Status auch ein Verlust von Geschäftspartnern.)
- Kommunikation ist jedoch auch positiv als Diffusionsagent der Kooperation einzusetzen. Es existieren verschiedene Formen:
- Mündlicher Kommunikation, auch Klatsch und Tratsch. Dieses beinhaltet die Weiterga- be von Strategien der anderen, um dem Existenzkampf zu genügen. In einer Großstadt wird diese Funktion durch Talk-Shows, Radiosendungen etc. gewährleistet.
- Viele Organisationen besitzen eine Zeitung (Mensch & Tier, Greenpeace-Magazin, lo- kales Kirchenblatt etc.) zur Vermittlung von Informationen an die Bevölkerung. Zum ei- nen über ihren Erfolg, zum anderen praktische Tips zur Imitation und Kooperation. · Kommunikation zeigt den kulturellen Stand einer Gesellschaft an. Die gesellschaftlich rele- vanten Themen sind mit einer hohen Anzahl von Beiträgen in den Kommunikationsmitteln vertreten. Die Relevanz kann am deutlichsten an den Einschaltquoten zu bestimmten Sen- dungen im Fernsehen abgelesen werden.
- Heutzutage ist in Deutschland mit dem Umweltschutz eine positive Wertschätzung verbunden. Dieses wird für Werbesendungen (unberührte Natur, Naturbelassenheit etc.) sowie zur Pro- duktvariation (Essigreiniger, Naturbleiche etc.) verwendet. Dieses war vor 30 Jahren noch nicht existent. Dieses zeigt die wichtige Aufgabe von Gruppen:
- Sie müssen die Anreizsituation des Individuums in eine umweltbewußte Entscheidungssi- tuation führen. Dieses geschieht:
1. kulturell:
- durch Internalisierung des umweltbewußten Gedankenguts bei den einzelnen Individu- en, so daß die Reaktionsmuster umweltbewußt sind (z.B. durch Aufklärung an den Schulen, Produktsiegel etc.).
- durch Entstehung von moralischen Kosten. Dazu muß die Öffentlichkeit weiter sensibi- lisiert werden, damit sie den Druck an Kooperationsverweigerer weitergibt. Sie muß so interessiert an der Umweltschutzproblematik sein, daß sie Bestrafungskosten für Fehlverhalten anderer in Kauf nimmt und handelt (z.B. Ansprechen von Fremden bei umweltschädigendem Verhalten). Nehmen die Bestrafungskosten zu, verschiebt sich die Entscheidungssituation erheblich.
2. Durch Beeinflussung des Staates, damit dieser seine Einflußpotentiale nutzt. (s. 4.1.2) n Den verschiedenen Impulsgebern, z.B. Greenpeace international und vor allem seinen Orts- gruppen, B.U.N.D., Ortsverbände zum Schutz der lokalen Umwelt, kommt damit die entschei- dende Rolle zur Verbreitung von Kooperation im Umweltbereich zu.
- Sie müssen ihre Gruppe als die langfristig einzig überlebensfähige gestalten, damit Imitati- on durch andere stattfindet.
- Sie müssen auch in andere Gruppen ihre Vertreter aussenden. Diese müssen den in dieser Gruppe herrschenden Normen, die Norm des sich „umweltbewußt verhalten“ hinzufügen.
- Sie müssen ihre Informationen und Normen vertreiben, damit eine öffentliche Diskussion stattfindet (s. Brent Spar) und sich auch einzelne Individuen dem Umweltgedanken anschließen.
- Sie müssen in die Regulierungsebene eintreten oder diese beeinflussen, damit durch die Verschärfung der staatliche Bestrafung vor umweltschädigendem Verhalten abgeschreckt wird (nicht fachgerechte Entsorgung von Schrott, extreme Luftverschmutzung etc.).
- Sie müssen für die Politik sowie auf der Betriebsebene Umweltkonzepte bereithalten, d.h. eine aktive, fordernde Beraterrolle einnehmen, die auch eigene Ideen beginnt (Smart Auto von Greenpeace, ökologische, olympische Spiele in Sydney etc.).
3.3 Der Betrieb
Die Schaffung bestimmter Anreize in der Rahmenordnung oder die Androhung von Sanktionen sind Möglichkeiten, Unternehmen zur Kooperation zu bewegen. Aber letztendlich kann der Staat oder das soziale Umfeld nicht alle Kooperationspotentiale zur Gänze ausschöpfen. Die eigentliche Schlüsselstelle, in der das wesentliche Problem des Zustandekommens von Kooperationsnormen liegt, ist das Individuum sowie die Institution selbst, und nicht die Judikative, Exekutive oder Legis- lative. In dem Menschen bzw. dem Unternehmen wird der Konflikt zwischen Egoismus und Koope- ration bzw. rationalen und normativen Denken ausgetragen. Die Individuen und die Unternehmen müssen selbst bestimmte Mechanismen und Motivatoren ausfindig machen, um ihre Potentiale zu nutzen. Im folgenden soll anhand von drei, nennen wir sie Schlagwörter der Kooperation, gezeigt werden, wie Unternehmen ihren Egoismus in Grenzen halten und verläßlich kooperieren können.
Selbstverpflichtung - Verzicht auf Rückwärtsinduktion - Branchenabkommen
An dieser Stelle soll nicht das große Buch der Tugenden aufgeschlagen werden, um die Unter- nehmen daran zu erinnern, daß sie gewisse moralische Verpflichtungen gegenüber ihrer sozialen sowie ökologischen Umwelt haben. Unternehmen versuchen nun einmal, Gewinne zu erzielen. Dies ist ihre innewohnende Eigenschaft. Unternehmen gründen sich nicht, um die Gesellschaft mit bestimmten Leistungen zu erfreuen, sondern aus rein ökonomischen und rationalen Beweggrün- den.149 Obwohl Individuen und Unternehmen wissen, daß sie mit Gewinn- und Nutzenmaximierung erheblich zur Instabilität der ökologischen Umwelt beitragen, und sich damit selbst ihre Lebens- grundlage berauben, verstärkt der Selektionsdruck des Wettbewerbes immer mehr den Wider- spruch zwischen individueller und kollektiver Rationalität. Es muß daher die Frage beantwortet werden, wie Individuen und Institutionen zusammen, d.h. in Kooperation miteinander, die beste- henden Konflikte beseitigen können. Daß ein einzelner die Probleme nicht lösen kann, ist aus den schon beschriebenen Gefangenendilemma-Strukturen hervorgegangen. Die Rückwärtsinduktion bei Gefangenendilemma-Strukturen, d.h. die dominante Wie-du-mir-so-ich-dir-Startegie, kann auch bei potentiell kooperativen Unternehmen, zweifelsohne defektive Verhaltensweisen erzwingen. Die Frage ist immer wieder, wer mit Kooperation beginnt und wieviel Vertrauen die anderen Akteure ihm zollen, bzw. mit welcher Verläßlichkeit er in den nächsten Spielen ebenfalls kooperieren wird.
Eine ethische Selbstverpflichtung eines einzelnen Unternehmens, ökologische Vorleistungen zu erbringen, kann unter bestimmten Umständen Nachahmer finden. Die Wahrscheinlichkeit diese Selbstverpflichtung konsequent einzuhalten, wird umso höher sein, je geringer die Kosten dafür sind, und umso niedriger, je stärker der ökonomische Druck auf jenes Unternehmen wirkt. Die Kosten einer Selbstverpflichtung können innerhalb von Branchen durch Abkommen auf alle Unter- nehmen verteilt werden. Ein Unternehmen, welches sich beispielsweise dazu selbst verpflichtet hat, bestimmte umweltschädigende Substanzen im Produktionsprozeß nicht mehr einzusetzen und deswegen eventuell höhere Kosten trägt, kann im Konkurrenzkampf sich letztendlich dazu ent- scheiden, auf die Selbstbeschränkung zu verzichten. Verpflichten sich aber alle Unternehmen mittels Branchenabkommen dazu, ökologisch vertretbare Substanzen einzusetzen, dann agieren alle unter gleichen Bedingungen. Der potentielle Anreiz eines Betriebes, bestehende Kooperati- onsnormen zu defektieren und dadurch Wettbewerbsvorteile zu erzielen, kann durch Branchenab- kommen eingeschränkt werden, indem gewährleistet wird, daß eine Defektion höhere Kosten als Kooperation verursacht. Damit wird sichergestellt, daß Unternehmen, die den ersten Schritt wagen, nicht durch ihre ethische Selbstverpflichtung bestraft werden. Gleichzeitig kann dem Mechanismus der Rückwärtsinduktion Sand ins Getriebe gestreut werden.
Die Bildung von Branchenabkommen ist von mehreren Faktoren abhängig. So lastet der öffentli- che Druck auf einigen Branchen stärker als auf anderen. Beispielsweise sind die Handlungen der Chemie- oder erdölfördernden Unternehmen stärker an der Umwelt auszumachen, als es bei- spielsweise in der Branche von Heilpraktikern der Fall wäre. Entsprechende ökologische Bran- chenabkommen müßten demnach besonders bei stark umweltschädigenden Branchen etabliert sein. Daß dies nicht immer der Fall ist, hat mehrere Gründe: Zum einen brauch ein öffentlicher Tadel nicht zu schwerwiegenden Sanktionen führen. Dies ist sicherlich der Fall, wenn zur Befriedi- gung bestimmter Bedürfnisse dem Konsumenten keine Produktsubstitute zur Verfügung stehen. Ein übergreifender Boykott würde nur höhere Kosten auf Seiten der Verbraucher zur Konsequenz haben. Ein hoher politischer Einfluß einer Branche kann ebenfalls zu derartigen „Sanktionstrans- fers“ führen.
Angenommen, die Sanktionen landen dort, wo sie auch gewollt werden. Ein Unternehmen, das umweltschädigend produziert oder handelt, setzt das Vertrauen seiner Kunden auf das Spiel, die Fehlverhalten durch den Kauf von Konkurrenzprodukten bestrafen können. Dies zeigt, daß eine alleinige Orientierung an kurzfristigen Gewinnen nicht ausreicht, langfristig erfolgreich zu sein. Unternehmen können durch den Druck der Öffentlichkeit oder der Verbraucher gezwungen werden ihr Verhältnis zur Umwelt zu überdenken. Das gelingt meistens nur, wenn es für den Verbraucher geringe Kosten verursacht, Konkurrenzprodukte oder Substitute zu konsumieren.
Der Wille Kooperationen im Umweltbereich einzugehen, kann z.B. durch die Vergabe von speziel- len Umweltzeichen gefördert werden. So wird der „Blaue Umweltengel“ an jene Unternehmen vergeben, die bei der Produktion, Verwendung und Entsorgung ihrer Produkte deutlich geringere Umweltbelastungen hervorrufen als Konkurrenzprodukte.150 Mit dem Abdruck des Blauen Engels auf die Produktverpackung können die Unternehmen imagefördernd werben, und dadurch eventu- elle Wettbewerbsvorteile gewinnen. Damit werden bei den Unternehmen Anreize geschaffen, Vorleistungen im Umweltbereich zu erbringen. Zwar ist der Blaue Engel ein Signet, das der Staat vergibt, aber entsprechende Signets können auch von den Dachverbänden einer Branche verge- ben werden. So können sich z.B. die Hersteller von Pflanzenschutzmittel darauf einigen, nur biolo- gisch abbaubare Substanzen zu verwenden und Kooperationen mit einem Abzeichen belohnen.
Natürlich ist nicht nur eine Selbstverpflichtung über Branchenabkommen möglich. Einzelne Unter- nehmen sind immer mehr bereit die erste Hürde zur Vorleistung zu nehmen. Dies zeigt sich am Beispiel des größten Lebensmittelunternehmens der Welt - der Nestlé AG. Die Firma Nestlé hat sich im Jahr 1982 verpflichtet, die Vermarktung von Muttermilch-Ersatzprodukten bei der Babyer- nährung in der dritten Welt in ethisch-vertretbarer Weise zu regulieren. In der selbstbindenden Unternehmensethik - auf der Basis der Vorstellungen der Weltgesundheitsorganisation - regulieren elf Kodizes den Konflikt zwischen dem Prinzip der Gewinnmaximierung und ethischen Forderun- gen.151 Doch inwieweit die Selbstbeschränkung bzw. die Vorleistung von Nestlé aus eigenem Antrieb zustande kam, kann letztendlich nicht genau ausgemacht werden. Sicher ist aber auch, daß die Firma Nestlé vorher in langen Auseinandersetzungen mit verschiedenen Protestgruppen aus ihrem Umfeld involviert war.152 Wichtig ist vor allem, daß sich die Unternehmen an ihre Selbstverpflichtung halten. Eine strikte Einhaltung ist nicht nur wichtig für die Sache selbst, son- dern gewinnt dadurch auch an Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist Voraussetzung für Akzeptanz und Unterstützung durch die Öffentlichkeit. Glaubwüdigkeit bedeutet nicht nur die Vorteile erfolg- reicher Umweltpolitik zu unterstreichen, sondern auch die Nachteile, wie z.B. Arbeitslosigkeit, kleinere Autos etc. zu beschreiben. Dies auf die ordnungspolitsche, unternehmensübergreifende Ebende zu transformieren, sollte nicht nur betriebswirtschaftliches Ziel, sondern auch gesellschaftliches sein.
Sicherlich ist die Selbstverpflichtung der Unternehmen (Vor-)Leistungen im Umweltbereich vorzu- nehmen, eine sehr tugendhafte Handlung. Falls aber Unternehmen ihre Selbstverpflichtung gewollt oder ungewollt nicht einhalten, ist jede ökologische Verpflichtung nur soviel wert, wie das Papier, auf das es steht. Es müssen Mechanismen greifen, die jene Unternehmen fördern, deren finanziel- le Situation eine Umorientierung nicht zulassen, aber auch diejenigen Unternehmen bestrafen bzw. ihnen Fördermittel vorenthalten, die gewollt ihre Selbstverpflichtung defektieren. Dies wird zur Zeit in den Niederlanden beispielhaft demonstriert. Die Unternehmen unterliegen einer staatlichen Zielkontrolle. Wer es z.B. schafft seine Industrieabgase um einen x-Faktor zu senken, wird mit staatlichen Fördermitteln belohnt; andere mit höheren Steuern bestraft, die bewußt die Abgasredu- zierung meiden. Hier wird zwar wieder die Verantwortung auf den Staat geschoben, der bestimmte „Zucherbrot-und Peitsche-Mechanismen“ schaffen muß. Eine zuverlässige Kontrolle ist aber eben nur durch eine übergeordnete Instanz möglich.
Die Frage ist nur, wie sich solche Instanzen verantwortungsvoll und nicht-persuasiv bilden können. Ein praktisches Beispiel aus der deutschen Politik zeigt auf anschaubare Weise, wie wahltaktische Kalküle, umweltpolitische beeinflussen können. Es ist bekannt, daß der Steuerzahler einen Ener- gieträger subventioniert, der zum globalen Treibhauseffekt beiträgt.153 Bei der Debatte um die Streichung der Kohlesubventionen in Rhein und Ruhr, hat sich gezeigt, daß z.Zt. nicht umweltrele- vante Themen den Wählern interessieren, sondern das tagtägliche finanzielle Überleben jedes einzelnen Betroffenen. Diese Botschaften werden häufig parteipolitisch instrumentalisiert, wenn man davon ausgehen kann, daß Regierungen selbst einem Selektionsdruck unterliegen. Die Schaffung unabhängiger Instanzen unterliegt somit selbst einer politischen Restriktion. Umweltpoli- tik sollte daher wirklich zu einer (inter-)nationalen Angelegenheit werden, und nicht nur dann, „wenn Autofahrer gegen die Versenkung einer Ölplattform protestieren“.154
Viele Unternehmen und Politiker argumentieren u.a., daß die Entscheidung bestimmte Produkte zu konsumieren auf der Verbraucherseite gefällt werden, und daß schließlich jede Nachfrage sein Angebot schafft. Diese Aussagen verlagern ökologische Überlegungen der Unternehmensethik auf die Ebene einer entsprechenden Konsumentenethik. Dagegen aber sprechen schon angeführte Argumente der Boykottmöglichkeiten. Außerdem müßten die vielen Einzelaktionen in den Klein- kostensituationen der Verbraucher koordiniert werden.155 Dies zeigt, daß die Individuen auf die Unterstützung von Institutionen angewiesen sind. Wenn die Konsumenten nicht einen Preis für eine verbesserte Umwelt zahlen möchten, dann ist zumindestens eine gewisse Umweltzerstörung über den technischen Duktus des Marktmechanismus legitimiert. Eine Unternehmensethik ist aus diesem Grund schon unumgänglich. Daß der Konsument allerdings Macht besitzen kann, wird in dem folgenden Beispiel des nächsten Kapitels deutlich.
4 Brent Spar - ein situatives Beispiel
Der Shell Konzern hat im Jahr 1995 europaweit mit dem Versuch die Erdölstation „Brent Spar“ zu versenken, für Aufruhr gesorgt. In Deutschland und Holland boykottierten Verbraucher Shell- Tankstellen. Die Umsätze schrumpften, der Aktienkurs bröckelte und das Image wurde ruiniert. Was war passiert ?
1976 wurde die Off-shore-Anlage „Brent Spar“ zwischen den britischen Shetland Inseln und der Westküste Norwegens in Betrieb genommen. Aber schon zwei Jahre später warf ein Eigenbetrieb nicht mehr die nötigen Gewinne ab und wurde zunehmend unrentabel. Sie wurde dann an das Pipeline-Netz angeschlossen. 1995 endete die Lizenz der britischen Regierung für Shell UK - die Brent Spar mußte nun irgendwie entsorgt werden. Dazu gab es mehrere Optionen: U.a. kam eine Demontage der über 14500 Tonnen schweren und 137 Meter hohen Anlage an Land in Frage. Diese Möglich- keit der Entsorgung ist zwar eine der umweltfreundlicheren, aber auch eine der teuersten. Rund 46 Millionen Pfund würde dies dem Konzern kosten; eine Entsorgung auf See dagegen nur 12 Millionen. Man entschied sich für eine Tie- fenwasserentsorgung, was bedeutet das die Brent Spar ca. 850 Kilometer durch die Nordsee gezogen und bei North Feni (nordwestlich der äußeren Hebriden) an einer ca. 2300 Meter tiefen Stelle gesprengt werden sollte. Dies ist bei weitem keine ungewöhnliche Maßnahme. Amerikanische Erdölkonzerne versenken ihre Plattformen ebenfalls, nachdem sie den Dreck herausgepumpt und den giftigen Lack abgekratzt haben. Im Golf von Mexico werden auf diese Weise eine Vielzahl künstlicher Riffs geschaffen.
Die Shell UK brachten nun den Genehmigungsprozeß in Gang. Sie haben die Scottish Fishermen`s Federation konsul- tiert, die Scottish Natural Heritage, das Joint Nature Conservation Commitee und die für die Ausnahmegenehmigung zuständige britische Regierung gefragt.156 Die Ausnahmegenehmigung einer Versenkung ist in der Oslo-Paris- Konvention der Nordsee-Anrainer-Staaten aufgeführt, aber nicht vollends geregelt. Nur die größte Umweltschutzorgani- sation Greenpeace wurde nicht angehört, da sie im gesetzlichen Genehmigungsprozeß keine Entscheidungsträger waren. Shell hatte sich soweit rechtlich legal verhalten. Darüberhinaus könnte aus ökologischer Sicht, eine Tiefenwas- serentsorgung vertreten werden. Im Fall einer Versenkung der Brent Spar wären zwar externe Effekte in Form einer schleichenden Umweltverschmutzung zu erwarten gewesen, die für sich genommen nur einen geringen negativen Effek auf die Nordeeanrainer gehabt, aber eine nicht zu übersehbare Signalwirkung für den sorglosen Umgang mit der Mee- resverschmutzung erzeugt hätten.157
Greenpeace bestreitet selbst nicht, daß die Sprengung der Ölplattform kaum Einfluß auf die Flora und Fauna des Mee- res hat. Denn allein 30 000 Tonnen Öl entweichen jährlich aus den Off-shore-Stationen. Ferner gelangen 20 000 Ton- nen Öl allein in die Nordsee, weil Fahrzeuge und Kraftwerke ihren Treibstoff nicht vollständig verbrennen; der unerledigte Rest entweicht in die Luft und geht zum Teil über das Meer nieder. „Dagegen sind die Giftmengen geradezu homöopa-thische Mengen.“158 Greenpeace fürchtete aber den Präzedenzfall, daß diese Handlungen zum Normalfall werden können und setzten einen gigantischen Medienrummel in Gang, der die Macht der Verbraucher in einem bis dahin ungewohnten Ausmaß zeigte. Die Shell-Pächter in deutschen Großstädten meldeten Umsatzrückgänge von teilweise 50 Prozent. Selbst Pächter des Shell Konkurrenten Agip, dessen Stationen überwiegend im shelltypischen Gelb gestrichen sind, registrierten plötzlich Kundenschwund. Am Ende hieß es: Sektkorken für Greenpeace - Katerstimmung bei Shell.
Betrachtung einer Legitimationsgrundlage
Im Fall der „Brent Spar“ bilden die Oslo-Paris-Konventionen und der Genehmigungsprozeß die Rahmenordnung bei einer Versenkung der Ölplattform. Damit ist der Shell Konzern bei einer Ge- nehmigung der Britischen Regierung legitimiert gewesen die Ölplattform in der Nordsee zu versen- ken. Shell UK hat sich, in der für sie geltenden Rahmenordnung bewegt. Im Konzept von Karl Homann wäre das Verhalten von Shell UK nichts unrealistisches. Es hat sich aber gezeigt, daß Shell mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Die Rahmenordnung schien also defizitär gewesen zu sein. Denn es bestand zwischen den Vertragsstaaten Uneinigkeit darüber, ob diese Ausnahmeregelung in Kraft treten dürfe. Wer will letztendlich entscheiden, wem der Ozean gehört und wie mit ihm umgegangen werden darf? Die Meere als öffentliche Güter laden alle zum Tritt- brettfahren (z.B. kostenlose Müllentsorgung) ein. Zudem müssen sich die negativen externen Effekte nicht an der eigenen Küste bemerkbar machen, da bestimmte Meeresströmungen schon für eine „gerechtere Verteilung der Kosten“ sorgen würden.
Das moralische Engagement von Shell lag danach in der Wahrung der Gesetze (politische Ver- antwortung) und nicht in der einseitigen oder freiwilligen moralischen Vorleistung im Wettbewerb. Als Lösung käme hier eine einheitliche Interpretation der Ausnahmeregelung in der Oslo-Paris- Konvention in Frage, die gleiche Bedingungen für alle erdölfördernde Nordsee-Anrainer-Staaten schaffen könnte. Noch besser wäre allerdings die Einbeziehung aller außereuropäischen Konzerne in das Abkommen, da das Ölgeschäft über die eigenen Grenzen hinaus verzahnt ist.
Spieltheoretische Betrachtung
Aus spieltheoretischer Sicht hat sich Shell UK bei diesem einen „Spiel“ erwartungsgemäß verhal- ten. Für Shell UK ist die Versenkung der Brent Spar die wirtschaflich beste Lösung. Die Auszah- lung wäre im Fall der defektiven Strategie höher gewesen, als wenn man sich kooperativ verhalten hätte. Praktisch bedeutet dies, daß bei einer Versenkung rund 34 Millionen Pfund eingespart wer- den könnte. Eine Kooperation im Sinne einer ökologisch korrekten Entsorgung wäre weit aus teurer. Shell ist in der Nordsee nicht der einzige erdölfördernde Konzern. Wenn andere Ölkonzerne ebenfalls die kostengünstige Versenkung wählen würden, dann käme es zu Wettbewerbsverzerrungen, die sich nachteilig auf Shell auswirken könnten. In einer solchen Konfliktlage hätte die Shell UK gemäß dem Konzept von Homann versuchen müssen, eine wettbewerbsneutrale Lösung für alle Ölfirmen, auf der Ebene der Rahmenordnung, zu finden.159 Die Lösung des Problems gestaltet sich dann entsprechend den Ausführungen des vorherigen Abschnitts.
Shell UK wird sich darüberhinaus, bei einer ähnlichen zukünftigen Situation - und diese stehen unmittelbar bevor - wohl oder übel darüber Gedanken machen müssen, ob sich die defektive Strategie bei „wiederholenden Spielen“ immer noch lohnt, oder ob die kooperative Strategie langfristig nicht doch die ökonomisch günstigere ist. Shell hatte es nämlich versäumt die hohen Folgekosten eventueller Umsatzrückgänge in ihren Entscheidungen mitzuberücksichtigen.
Betrachtung der Unternehmensethik
Unternehmensethik, im Sinne einer Reparaturinstanz oder als eigenständiges betriebswirtschaftli- ches Instrumentarium kam nicht zum Zuge. Shell hatte selbstredend im Vorfeld durch eine breit angelegte Imagekampagne mit dem Motto: „Wir wollen etwas ändern.“, darauf hingewiesen, daß jeder einzelne etwas bewirken kann, und so zu moralischen Vorleistungen ermuntert.160 Aber dies allein schon als Unternehmensethik zu bezeichnen, wäre etwas zu weit gegriffen. Wie recht sie mit ihrem Motto allerdings hatten, konnten sie wenige Monate später am eigenen Laib erfahren. Ein Image ist schnell auf Papier gedruckt; jedoch macht nicht das Papier ein Image aus, auf das es geschrieben steht, sondern die Glaubwürdigkeit des Unternehmens, welches damit gerne in Ver- bindung gebracht werden will.
In den diskursethischen Konzepten von Steinmann/Löhr oder Ulrich hätte, bei Einhaltung der sich selbst auferlegten moralischen Selbstverpflichtung, es zu einem Diskurs mit Betroffenen kommen müssen. Falls sich Shell an ihrem Prinzip der Konsensbildung gehalten hätte, wäre es sicherlich zu Gesprächen mit Greenpeace und anderen Umweltschützern gekommen.161 Es hatte sich viel- mehr gezeigt, daß Shell erst durch den Boykott der Konsumenten und aus Furcht vor dem endgül- tigen Verlust ihrer Glaubwürdigkeit zum Abbrechen der Versenkungsaktion gezwungen wurde. Ob dadurch die Ziele der eigenen Unternehmensphilosophie oder der Diskursethik erfüllt wurden, ist äußerst fraglich.
Auch die von Steinmann/Löhr empfohlene nachträgliche Rechtfertigung der Entscheidungen, war bei Shell ebenfalls nicht zu beobachten. Shell UK hätte die Mittel (kostensparende Versekung einer Ölplattform) zur Erreichung des Formal- und des Sachziels „Förderung von Öl“ nochmal ethisch begründen müssen. Das ein Diskurs über mögliche Schäden oder andere Alternativen nicht zustande kam, liegt u.a. auch an der rabiaten Personalstruktur des Ölmultis. Jeder Manager weiß unter sich zwei weitere Personen, die sofort die Nachfolge einnehmen können. Extratouren auf Kosten des Konzerns werden so auf ein kleines Niveau gehalten.
In den ethischen Konzepte müßte spätestens dann die Unternehmensethik zum Zuge kommen, wenn die Rahmenordnung defizitär ist. Die „Ausnahmeregelung“ der Oslo-Paris-Konvention reichte einfach nicht aus, um eine konkrete Verfahrensweise aufzuzeigen oder Sanktionen erteilen zu können. Der Fall „Brent Spar“ hat gezeigt, daß besonders die normativen Beweggründe der Verbraucher und Greenpeace dazu geführt haben, daß Shell klein beigeben mußte. Nicht die Rahmenordnung hat Shell UK sanktioniert, sondern das normative Verhalten der Verbraucher, die sich zu fragen begannen, warum Shell etwas darf, was sie selbst nicht dürfen. Eine Versenkung käme dem Verhalten gleich, wenn jemand sein Autowrack in den nächsten Baggersee fährt, und das vor den Augen einer ganzen Nation.162
Betrachtung einer (fehlenden) Kommunikation von Shell
Entweder müßte Shell UK darauf drängen, daß alle Vetragsstaaten der Oslo-Paris-Konvention sich auf eine einheitliche Interpretation der Ausnahmeregelung einigen oder aber andere Lösungen mit den Bezugsgruppen erarbeiten. Weder erstes noch letzteres wurde in Erwägung gezogen. Die Konzernleitung verhielt sich zunehmend stur. Zudem würde sich eine Kommunikation mit Bezugs- gruppen, auch bei demokratischeren Organisationstrukturen, bei Shell schwierig gestalten, da selbst die konzernübergreifende Kommunikationsstruktur weit langsamer war, als die der Medien. Auch der Deutschland Chef des Shell-Konzerns Peter Duncan, hatte von den Versenkungsprob- lemen erst in der Presse erfahren. Die für das Plattformgeschäft zuständige britische Geschäftlei- tung verfuhr nach einem alten Insel-Witz: „Fog in London - continent cut off.“163
Die Möglichkeit eines öffentlichen Diskurses und umfangreiche Information hätte die Probleme von Shell erheblich vermindern können. Abgesehen davon, daß eine ökologisch vertretbare Versen- kung nicht zu den von den, Verbrauchern angenommenen, apokalyptischen Folgeerscheinungen führen muß, haben die Versenkungserfahrungen der amerikanischen Kollegen positive externe Effekte gezeigt. Denn jedes künstich geschaffene Riff schafft Lebensraum für die unterseeische Tier- und Pflanzenwelt. Im Umkreis der künstlichen Riffs im Golf von Mexico haben Wissenschaft- ler bis zu 50mal mehr Fische gezählt als in den angrenzenden Gewässern.164 Zudem wurde über die Risiken einer Demontage an Land nicht ausreichend informiert, schließlich müssen die Off- shore-Stationen unter hohem Risiko ans Festland verfrachtet werden. Shell hätte mit diesen Ar- gumentationsgrundlagen die Folgewirkungen einer Plattformversenkung nit Sicherheit nicht „weichspülen“ können. aber auf diese Weise für mehr Informationen gesorgt. Es gilt hier nicht einseitige Mehrheiten einer positiven Berichterstattung zu erzielen, sondern um die Schaffung einer breit angelegten öffentlichen Diskussion mit all ihren Vor- und Nachteilen, die von Shell letztlich ungenutzt geblieben ist.
Kooperation der Verbraucher
Die Müllentsorgung ist anscheindend ein Verstoß gegen die guten Sitten. Noch nie hat ein Weltkonzern so viele Menschen in so kurzer Zeit gegen sich aufgebracht. Die Kooperationsbereitschaft der Verbraucher untereinander war enorm. An dieser Stelle muß aber auch darauf hingewiesen werden, daß es für die Verbraucher leicht war, Shell-Benzin zu boykottieren. Besonders in den Großstädten, wo die verschiedenen Benzin-Anbieter ihre Standorte meist in der Nähe der Konkurrenz aufsuchen. Dem Autofahrer hat es so gut wie keine Kosten verursacht, bei einer benachtbarten BP- oder Araltankstelle den Wagen aufzutanken. Der Autofahrer, der etwas auf sich hielt, fuhr bei der Konkurrenz tanken, und fühlte sich als guter Mensch, ohne etwas zu bezahlen. Dadurch wurde insgesamt eine große Wirkung erzielt. Zudem ist Benzin ein sehr homogenes Gut. Hier greift die Theorie des Niedrigkostenansatzes, wonach Individuen eher bereit sind auf etwas zu verzichten, wenn ihnen dabei geringe oder keine Kosten entstehen.
Was würde der Verbraucher tun, wenn er auf Benzin ganz verzichten müßte? Es ist davon auszugehen, daß Shell kein Einzelfall hinsichtlich Versenkungsabsichten ist. Angenommen die erdölfördernde Industrie würde in einem Branchenabkommen vereinbaren, daß jeder seine unproduktiven Off-shore-Stationen versenken darf. Die wirtschaftliche und politische Macht der Ölbranche, entsprechende Absichten sich per Gesetz legitimieren zu lassen, darf dabei nicht unterschätzt werden. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob die Verbraucher dennoch bereit gewesen wären, auf Benzin und damit auf ihr liebstes Kind, dem Auto, zu verzichten.
Defektion von Shell
Shell hat sich in keiner Phase kooperativ verhalten. Selbst Chris Fay, Chef der Shell UK, gab am Ende noch vor laufenden Kameras zu bedenken: „Wir haben unsere Meinung nicht geändert, aber wir blasen die Aktion ab.“165 Von freiwilliger Kooperation ist in diesem Fall sicherlich nicht mehr zu sprechen. Shell wurde sanktioniert und zur Aufgabe gezwungen. Nicht von der Rahmenordnung, sondern durch den gesellschaftlichen Druck. Auch die danach angelegte Anzeigenaktion mit der Überschrift „Wir werden uns ändern“, konnte die Glaubwürdigkeit nicht wieder völlig herstellen.
Die Shell-Gesellschaften handelten stets nach den Grundsätzen und Grundströmungen des Lan- des, in dem sie ihre Produkte verkaufen wollten. Während sie zur Zeit der Apartheid in Europa, von Gegnern der konservativen südafrikanischen Regierung, boykottiert wurden, suchten sie in Johan- nesburg und Kapstadt die Nähe zu den progressiven Kräfte des Landes. Vielleicht ist gerade dies der Grund, warum Shell es versäumt hatte, die ökologischen und gesellschaftlichen Strömungen über die Grenzen Großbritanniens hinaus zu erkennen. Denn was in Schottland, Irland oder Eng- land Recht ist, muß in Deutschland oder in den Nierderlanden nicht rechtens sein.
Niemand, selbst Shell, konnte sich vorstellen, daß die Verbraucher und Umweltschutzorganisatio- nen das drittgrößte Wirtschaftsunternehmen der Welt (lt. Forbes) in die Knie zwingen kann. Schuldzuweisungen sind im nachhinein schnell ausgesprochen. So sahen die britischen Shell- Arbeitnehmer den Schuldigen in der Britischen Regierung, weil sie Shell gesetzlich nicht dazu zwingen konnte, ihre Sache ordentlich zu machen. Die Britische Regierung unter John Major, sahen dagegen die Schuldigen bei den deutschen und holländischen Verbrauchern, die sich viel zu „hasenfüßig“ verhielten.166 Die Deutschen und Holländer sahen den Schuldigen bei Shell selbst und im sturen Verhalten der Briten, die immer wieder die kulturelle und politische Wasserscheide des Ärmelkanals herausstellen wollten.
Evolutionstheoretische Betrachtung
Am Ende ist es immer interessant zu fragen, warum es zu all diesen Geschehnissen kam. Dazu soll die Evolutionstheorie verwendet werden. Shell UK hat die möglichen Handlungsalternativen zur Entsorgung der Brent Spar überdacht und mit Hilfe der internen Selektion bewertet. Es gewann die Tiefenwasserentsorgung, da die materiellen Kosten der Demontage an Land wesentlich größer waren, wobei sich die moralischen Kosten der beiden Alternativen nicht wesentlich unterschieden. Die Umwelt, die hauptsächlich aus Green- peace gebildet wurde, sah dies jedoch anders und wollte einen Präzedenzfall schaffen. Greenpeace infor- mierte die Öffentlichkeit und argumentierte mit der Gefährdung der Gesamtfitneß der Bevölkerung und rief zum Boykott von Shell auf. Aufgrund der geringen Bestrafungskosten, d.h. Kosten zu lasten der eigenen Fitneß, wurde diesem Boykottaufruf in hohem Maße Folge geleistet. Dieses zwang Shell UK seine Hand- lungsvariante zurückzuziehen.
Die zweite Variante, die Demontage an Land wurde der Öffentlichkeit präsentiert und von dieser akzeptiert. Durch die Interaktion der Individuen beim Boykott haben sich die Rahmenbedingungen des Handelns für Unternehmen dieser Branche geändert. Die moralischen Kosten sind jetzt bedeutend höher geworden, die interne Selektion wird nun zu einem anderen Ergebnis führen. Es bleibt zu hoffen, daß durch die Diffusion dieses Ergebnisses, auch andere Branchen ihre Entscheidungen umweltbewußter gestalten und die Verbraucher ihre Macht häufiger einsetzen.
Noch heute diskutiert Shell mit Greenpeace und anderen Betroffenen über konsensfähige Alternativen der Entsorgung, während die Brent Spar in der Nordsee vor sich hin rostet.
5 Fazit und Anregungen
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß in der Realität das ökonomische Prinzip weiterhin dominiert. Da sich die Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen hauptsächlich an betriebswirtschaftli- chen Kennzahlen orientiert, werden weniger Betriebe bereit sein, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch beispielsweise ökologische Vorreiterrollen zum Ausdruck zu bringen. Die Beurteilung wirtschaftli- chen Erfolges anhand quantitativer bzw. monetärer Kritierien, kann gegenwärtige und zukünftige Zielkonflikte von Ökonomie und Ökologie nur schwerlich lösen. Der Erfolgsbegriff müßte durch qualitative Komponenten erweitert werden, so daß eine Konvergenz von ökonomischen und öko- logischen Zielen erreicht werden kann. Noch werden Kooperationen nur eingegangen, wenn sie für alle Beteiligten einen höheren Output bringen oder wenn Druck auf die Akteure ausgeübt wird. Dieser Druck kann vom Staat ausgehen, dem über die Festlegung der Rahmenordnung eine wich- tige Rolle zukommt. Da der Staat multivariate Ziele, nicht nur im Umweltbereich, sondern auch im sozialen und wirtschaftlichen Bereich verfolgt, kann es zu Zielkonflikten kommen.
Zusätzlich entsteht Druck auf die Unternehmen, wenn die Kunden zunehmend moralische und ökologische Aspekte in ihre Kaufentscheidung einfließen lassen. Da die Märkte übersättigt und die Produkte austauschbar werden, sind die Unternehmen gezwungen, auf diese Tendenzen mit ihrer Produktpolitik zu reagieren. Die vollständige Integration von ethischen Prinzipien in die Kultur ist jedoch noch utopisch. Denn es läßt sich beobachten, daß das Engagement von Individuen und Institutionen schnell schwindet, wenn sie in wirtschaftliche Not geraten. Dies läßt sich u.a. anhand der Maslowschen Bedürfnispyramide erklären. Es müssen erst die Defizitbedürfnisse der Men- schen befriedigt werden, bevor Wachstumsbedürfnisse, zu denen der Umweltschutz gehört, von den Menschen wahrgenommen und realisiert werden können. Sicherlich ist ökologisches Bemü- hen in Deutschland spürbar, aber wie sieht es in anderen Ländern, der zweiten oder dritten Welt aus? In diesen Ländern werden kaum die Defizitbedürfnisse befriedigt. Es wäre ein regelrechter „Quantensprung“, wenn ein unterentwickeltes Land sich den moralischen Zielen des Umweltschut- zes eröffnen würde. Durch die extreme Verschlechterung der ökologischen Bedingungen, wird der Schutz der Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen, jedoch bald als Defizitbedürfnis zu reali- sieren sein.
Angesichts dieser drängenden ökologischen Probleme ist eine Trendwende weg von der individuellen Nutzenmaximierung, hin zu einer kollektiven Nutzenfunktion, die auch kommende Generationen berücksichtigt, notwendig!
6 Literaturverzeichnis
Alexander Alland Jr.: Evolution und menschliches Verhalten, Stuttgart, 1970
Robert Axelrod: Die Evolution der Kooperation, München, 1988
Albrecht Becker: Komplexe Probleme und Entscheidungen, Vorlesungsunterlagen Helmut Bester: Lecture Notes "Game Theorie", FU Berlin, 1996 Thilo Bode: Joghurtbecher bringen`s nicht, in: Die Zeit, Nr. 25, 1997
Robert Boyd / Peter J. Richerson: Cultural Transmission and the Evolution of Cooperative Behav- ior, in: Human Ecology, Vol. 10, Nr. 3, 1982, S. 325-351
Dierke Wörterbuch Ökologie und Umwelt, Band 2, 1993, S. 179
John Donne: The social environment and its evolution, in: Hrsg. John Hurell Crook: The Evolution of Human Consciousness, S. 37-59, 1989, Oxford
Heiko Ernst: Wie wir wurden, was wir sind, Psychologie heute, Dezember 1996, S. 21-29
Bruno S. Frey: Umweltökonomie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1972
Bruno Fritsch: Evolutionsökonomische Aspekte des Energie- und Umweltproblems, in: Hrsg. Ulrich Witt: Studien zur Evolutorischen Ökonomik, Band 195/II, Berlin, 1992, S. 117-142 Gablers Wirtschafts-Lexikon Mit 6 Bänden, Wiesbaden, 1988
William D. Hamilton: Die Evolution der Kooperation in biologischen Systemen, in: Robert Axelrod: Die Evolution der Kooperation, München, 1988, S. 80-96
Karl Homann: Gewinnmaximierung und Kooperation - Eine ordnungspolitische Reflexion, Kieler Arbeitspapiere Nr. 691, Kiel, 1995
Karl Homann / Franz Blome -Drees: Unternehmensethik - Managementethik, in: Die Betriebswirt- schaft, Jg. 55, Nr. 1, 1995
Hartmut Kliemt: Ökonomik und Ethik, in: WiSt, Heft 3, 1987
Rolf Lepper / Karl-Heinz Seyfried: Manager im Zwiespalt, in: Capital, Nr. 12, 1996
Walter Lorenz: Studien zur Evolutorischen Ökonomik III, Bd. 195/III, 1995, Berlin, S. 5-57
Fredmund Malik: Die Managementlehre im Lichte der modernen Evolutionstheorie, in: Die Unter- nehmung, 33. Jg., Heft 4, 1979, S. 303-315
Ulrich Müller: Einleitung, in: Hrsg. Ulrich Müller: Evolution und Spieltheorie, München, 1990
R.A. Musgrave / P.B. Musgrave / L. Kullmer: Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Tübingen 1987, Band 1
Margit Osterloh: Unternehmensethik und Ökonomische Theorie, in: Walter Müller-Jentsch (Hg.): Profitable Ethik - effiziente Kultur, München u.a., 1993
Margit Osterloh / Albert Löhr: Ökonomik oder Ethik als Grundlage der sozialen Ordnung ?, in: WiSt, Heft 8, 1994
Margit Osterloh / Regine Thiemann: Brent Spar - Konzepte der Wirtschafts- und Unternehmensethik, in: Die Unternehmung, Ausgabe 5, Bern, 1995
H. Ronald Pulliam: A Social Learning Model of Conflict and Cooperation in Human Societies, in: Human Ecology, Vol. 10, No. 3, 1982, S. 353-363
Hans-Gerd Ridder: Unternehmensethik als Instrument der Transformation von Ökologie in Öko- nomie, in: Walther Müller-Jentsch: Profitable Ethik - effiziente Kultur, München u.a., 1993 Rupert Riedl: Wahrheit und Wahrscheinlichkeit - Biologische Grundlagen des Für-Wahr- Nehmens, Berlin, 1992
Todd Sandler: Collective Action, Theory and Applications, University of Michigan, 1992
Hermann Schnabl: Biologische Evolution vs. Evolution von Firmen und Märkten, in: Hrsg. Ulrich Witt: Studien zur Evolutorischen Ökonomik, Band 195/I, Berlin, 1190, S. 221-241 Markus Semmel: Die Unternehmung aus evolutionstheoretischer Sicht - Eine kritische Be-
standsaufnahme aktueller evolutionärer Ansätze der Organisations- und Managementtheorie, Bern, 1984
„Oasen in der Wüste“, in: Spiegel, Nr. 25, 1995a „Versenkt die Shell“, in: Spiegel, Nr. 25, 1995b „Herkströter oder Mayor“, in: Spiegel, Nr. 26, 1995c
Horst Steinmann / Birgit Gerhard: Effizienz und Ethik in der Unternehmensführung, Nürnberg, 1991
Hort Steinmann / Albert Löhr: Unternehmensethik - Ein republikanisches Programm in der Krise, in: Forum für Philosophie Bad Homburg, Markt und Moral - Die Diskussion um die Unter- nehmensethik, Bern u.a., 1994
Horst Steinmann / Albert Löhr: Unternehmensethik, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, 1991
Horst Steinmann / Georg Schreyögg: Management - Grundlagen der Unternehmensführung. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden, 1993
Alfred Stobbe: Mikroökonomie, 2. Auflage, Berlin New York, 1991 "Mobil ohne Auto", Tagesspiegel, 16. Juni 1997, S. 24
Charles E. Taylor / Michael T. McGuire: Reciprocal Altruism: 15 Years Later, in: Ethology and Sociobiology 9, 1988, S. 67-72
Peter Ulrich: Unternehmensethik - Führungsinstrument oder Grundlagenreflexion, in: Horst Stein- mann / Albert Löhr: Unternehmensethik, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, 1991
Peter Ulrich: Wirtschaftsethik als Beitrag zur Bildung mündiger Wirtschaftsbürger. Zur Frage nach dem Ort der Moral in der Marktwirtschaft, in: Ethica, Jg, 1, Nr. 3, 1993
Hartmut Vossenkuhl: Kopfgeburt und Lebenshilfe, in: Tagesspiegel, Berlin, Nr. 15994, 1997
Hartwig Walletschek / Jochen Graw: Öko-Lexikon - Stichworte und Zusammenhänge, München, 1995
Joachim Weimann: Umweltökonomik, 2. Auflage, Heidelberg New York Tokio, 1991
Michael Weingarten: Organismuslehre und Evolutionstheorie, Hamburg, 1992
Peter Weise: Elemente einer evolutiven Theorie der Moral, in: Hrsg. Adolf Wagner und
Hans-Walter Lorenz: Studien zur Evolutorischen Ökonomik, Band 195/III, 1995, Berlin
[...]
1 Vgl. hierzu z.B. Lexikon der Psychologie, Bd. 2, Freiburg, 1971; The Dictionary of Ethology and Animal Lerning, Oxford, 1986; Gablers Wirtschaftslexikon, Bd. 4, 13. Aufl., Wiesbaden, 1993
2 Dierke Wörterbuch Ökologie und Umwelt, 1993, S. 179
3 Albrecht Becker, Komplexe Probleme und Entscheidungen, Vorlesungsunterleagen, Folie 25
4 ebenda.
5 Joachim Weimann, Umweltökonomik, 2. Auflage, Heidelberg New York Tokio, 1991, Seite 19
6 ebenda, S. 19
7 ebenda, S. 21
8 R.A. Musgrave et al., 1987, S. 55
9 ebenda, S. 7
10 Joachim Weimann, 1991, Seite 110
11 Bruno S. Frey, 1972, S. 119
12 Joachim Weimann, 1991, S. 26
13 ebenda, S. 29
14 Helmut Bester, 1996, S. 4
15 Joachim Weimann, 1991, S. 204
16 Gablers Wirtschafts-Lexikon,1988, S. 1603
17 Joachim Weimann, 1991, S. 50
18 Helmut Bester, 1996, S. 1
19 Joachim Weimann, 1991, S. 50
20 Helmut Bester, 1996, S.1
21 Joachim Weimann, 1991, S. 75
22 ebenda, S. 76
23 ebenda, S. 52
24 Todd Sandler, 1992, S. 25
25 Joachim Weimann, 1991, S. 55
26 ebenda, S. 54
27 ebenda, S. 61
28 Joachim Weimann, 1991, S. 73
29 Albrecht Becker, Folie 25
30 Todd Sandler, 1992, S. 35
31 Joachim Weimann, 1991, S. 55
32 Todd Sandler, 1992, S. 63
33 Joachim Weimann, 1991, S. 56
34 ebenda, S. 85
35 Joachim Weimann, 1991, S. 92
36 Alfred Stobbe, 1991, S. 525
37 Joachim Weimann, 1991, S. 95
38 Karl Homann, 1995, S. 2
39 Wilhelm Vossenkuhl, 1997, S. 27
40 Hartmut Kliemt, 1987, S. 113
41 Zum Sprachgebrauch: Unter „Wirtschaft“ bzw. „Ökonomie“ wird die reale Wirtschaft verstanden, wohingegen „Ökonomik“ die Theorie der Wirtschaft ist. „Ethik“ ist die Theorie über die Moral. Unter „Moral“ wird der Komplex von Normen verstanden, der das Handeln der Akteure leitet. „Normen“ sind also Handlungsaufforderungen, haben also präskriptiven Charakter; „Werte“ sind hingegen Deskriptionen faktischer Bewertungen.
42 Margit Osterloh / Albert Löhr, 1994, S. 401
43 Vgl. Margit Osterloh, 1993, S. 84
44 Hartmut Kliemt, 1987, S. 114
45 im Sinne einer Mittel-Zweck-Beziehung
46 Margit Osterloh, 1993, S. 86
47 Margit Osterloh / Albert Löhr, 1987, S. 402
48 Margit Osterloh, 1993, S. 88
49 ebenda, S. 87
50 ebenda
51 Margit Osterloh / Regine Tiemann, 1995, S. 322
52 Karl Homann / Franz Blome-Drees, 1995, S. 97
53 ebenda
54 Karl Homann, 1995, S. 11
55 ebenda, S. 32
56 siehe hierzu Kapitel 3.3.
57 In Gefangenendilemma-Strukturen ist die individuell beste - auch dominante - Strategie, die defektive Strategie; d.h. beide Individuen oder Institutionen verhalten sich unkooperativ. Dies führt zu kollektiven Selbstschädigungen. Ver- hielten sich die Individuen kooperativ, dann würden ihre Auszahlungen (z.B. mehr Jahre in Freiheit) höher sein, als bei der defektiven Strategie.
58 Margit Osterloh / Regine Tiemann, 1995, S. 324
59 Karl Homann, 1995, S. 18
60 vgl. Kapitel 5
61 Karl Homann, 1995, S. 11
62 Karl Homann / Franz Blome-Drees, 1995, S. 104
63 siehe Kapitel 3.3
64 Karl Homann, 1995, S. 20
65 ebenda, S. 21
66 siehe im Kapitel 3.3.
67 Karl Homann, 1995, S. 34
68 An dieser Stelle können weitere Koautoren genannt werden: Georg Schreyögg, Elmar Gerum, Birgit Gerhard etc.
69 Horst Steinmann / Georg Schreyögg, 1993, S. 95
70 ebenda, S. 105 f
71 Horst Steinmann / Albert Löhr, 1991, S. 10
72 Horst Steinmann / Georg Schreyögg, 1993, S. 103
73 E s ist nicht zu klären, was unter einer hinreichenden Rentabilität zu verstehen ist.
74 siehe hier Kapitel 3
75 Horst Steinmann / Regine Gerhard, 1991, S. 29
76 Steinmann bezeichnet in seinen Ausführungen die Diskursethik als Dialogethik, meint aber dasselbe.
77 Horst Steinmann / Albert Löhr, 1994, S. 150
78 Vgl. dazu genauer Horst Steinmann / Georg Schreyögg, 1993, drittes Kapitel
79 Steinmann räumt aber auch ein, daß die moralische Verantwortung nicht allein bei der Unternehmensführung liegen darf, sondern daß sich die gesamte Organisation den ethischen Bemühungen verpflichtet fühlen muß.
80 Die Umsetzung kann z.B. durch die Institutionalisierung von Ethikkommissionen erreicht werden.
81 Horst Steinmann / Georg Schreyögg, 1993, S. 109
82 ebenda S. 109
83 Negative externe Effekte entstehen, wenn unbeteiligte Dritte durch Unternehmenshandlungen geschädigt werden, ohne daß dies einerseits bei Unternehmen zu Kosten führt und andererseits die Schädigung Dritte über das Preissystem abgegolten wird.
84 Hans-Gerd Ridder, 1993, S. 109
85 Margit Osterloh / Regine Tiemann, 1995, S. 325
86 Peter Ulrich, 1993, S.242-243
87 Margit Osterloh / Regine Tiemann, 1995, S. 325
88 Hans-Gerd Ridder, 1993, S. 110
89 Peter Ulrich, 1991, S. 207
90 Horst Steinmann / Georg Schreyögg, 1993, S. 109
91 Hans-Gerd Ridder, 1993, S. 110
92 Margit Osterloh / Regine Tiemann, 1995, S. 330
93 Margit Osterloh / Regine Tiemann, 1995, S. 329
94 ebenda
95 Bruno Fritsch, 1992, S. 117
96 Vgl. Markus Semmel, 1984, S. 73ff
97 Vgl. Michael Weingarten, 1992, S. 201ff. Dort erfolgt auch eine präzise Darstellung der darwinistischen Theorie sowie ihrer Kritik.
98 Hermann Schnabl, 1990, S. 222
99 Vgl. William D. Hamilton, 1987, S. 80. Der Beweis des Vorteils von Populationen bei der Selektion ist noch nicht erbracht. Eher wird angenommen, daß die Konkurrenz innerhalb einer Art zur Evolution führt. 100 Vgl. Hermann Schnabl, 1990, S. 222f
101 Vgl. Michael Weingarten, 1992, S. 70f
102 Vgl. Ulrich Müller, 1990, S. 4
103 Vgl. Hermann Schnabl, 1990, S. 223ff. Dort werden auch weitere Evolutionsmechanismen erklärt.
104 Vgl. Fredmund Malik, 1979, S. 311ff
105 Vgl. Markus Semmel, 1984, S. 109. Er diskutiert dort auch die Bedeutung der soziokulturellen Evolutionstheorie in anschaulicher Weise.
106 Bruno Fritsch, 1992, S. 117
107 taktil= tastend oder den Tastsinn betreffend
108 Vgl. Rupert Riedl, 1992, S. 51ff
109 Vgl. Heiko Ernst, 1996, S. 22ff
110 ebenda S. 27f
111 Aufteilung und folgendes siehe Vgl. Markus Semmel, 1984, S. 116ff
112 Vgl. Bruno Fritsch, 1992, S. 118
113 Fitneß ist die Nachkommenzahl in der nächsten Generation. Gesamtfitneß ist die Summe der eigenen Fitneß plus der Fitneß, die durch das altruistische Verhalten der Verwandten entsteht. Vgl. John Donne, 1980, S. 43
114 Vgl. William D. Hamilton, 1987, S. 80ff
115 Vgl. John Donne, 1980, S. 43
116 Vgl. hier und im folgenden Robert Axelrod, 1987, S. 3ff
117 ebenda S. 56, belegt durch ein Zahlenbeispiel im Rahmen des Gefangenendilemmas.
118 Vgl. John Donne, 1980, S. 55ff
119 Vgl. Robert Boyd und Peter J. Richerson, 1982, S. 338, wo die Kontroverse dargestellt wird, ob kin selection die einzig relevante Kraft ist oder sich mit der group selection auf einem Kontinuum befindet. Hier wird die Meinung der zweiten Gruppe vertreten.
120 Group selection nennen sich alle Prozesse, die die Fitneß der Gruppe beeinträchtigen. Ebenda S. 338.
121 Vgl. Peter Weise, 1995, Berlin, , S. 38
122 Vgl. kollektive Stabilität bei Robert Axelrod, 1987, S. 50f
123 Vgl. Peter Weise, 1995, Berlin, , S. 43
124 Vgl. Robert Axelrod, 1987, S. 119f
125 Vgl. Peter Weise, 1995, Berlin, S. 37
126 Vgl. Heiko Ernst, 1996, S. 28
127 Vgl. Markus Semmel, 1984, S. 100ff
128 Vgl. Peter Weise, 1995, Berlin, S. 36
129 ebenda S. 36
130 ebenda S. 39
131 Vgl. z.B. Michael Weingarten, 1992, S. 79ff
132 Vgl. Markus Semmel, 1984, S. 391ff
133 Nach LeVine und Campell in: Robert Boyd und Peter J. Richerson, 1982, S. 347
134 Vgl. H. Ronald Pulliam, 1982, S. 362
135 Vgl. Heiko Ernst, 1996, S. 25
136 Vgl. Ulrich Müller, 1990, S. 64
137 Tagesspiegel, 16.06.97, S. 24
138 Alexander Alland Jr., 1970, S. 152
139 nach: Meyers großes Taschenlexikon, 1983, S. 39
140 Hartwig Wallwtschek und Jochen Graw, 1994, S. 56
141 Bruno S. Frey, 1972, S. 108
142 Bruno S. Frey, 1972, S. 108
143 ebenda, S. 106
144 Margit Osterloh, Albrecht Löhr, 1994, S. 404
145 Bruno S. Frey, 1972, S. 118
146 Bruno S. Frey, 1972, S. 112
147 Vgl. Robert Axelrod, 1987, S. 121ff
148 Vgl. Robert Boyd und Peter J. Richerson, 1982, S. 348
149 Anmerkung: Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen.
150 Hartwig Walletschek / Jochen Graw, 1995, S. 239
151 Horst Steinmann / Georg Schreyögg, 1993, S. 105
152 ebenda, S. 105
153 Thilo Bode, 13.06.97, S. 12
154 ebenda
155 Margit Osterloh / Regine Thiemann, 1995, S. 333
156 Spiegel, 1995b, S. 31
157 Margit Osterloh / Regine Thiemann, 1995, S. 325
158 Spiegel, 1995b, S. 29
159 Margit Osterloh / Regine Thiemann, 1995, S. 332
160 Spiegel, 1995b, S. 22
161 Spiegel, 1995c, S. 84
162 Spiegel, 1995a, S. 23
163 ebenda, S. 30
164 Spiegel, 1995a, S. 28
165 Spiegel, 1995c, S. 87
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine Hausarbeit, die sich mit der Frage auseinandersetzt, inwieweit Kooperation im Umweltbereich möglich ist und unter welchen Rahmenbedingungen Individuen kooperieren. Es wird untersucht, welche praktischen Maßnahmen zur Förderung von Kooperation unternommen werden könnten. Dabei werden drei Theorieansätze aus den Disziplinen Ethik, Evolutionstheorie und Ökonomik als Diskussionsgrundlage benutzt.
Welche Theorien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt drei Basistheorien: die ökonomische Theorie, ethische Konzepte und den evolutionstheoretischen Ansatz. Jede Theorie wird im Hinblick auf ihre Bedeutung für Kooperation, insbesondere im Umweltbereich, untersucht.
Was sind die Hauptpunkte der ökonomischen Theorie in Bezug auf Kooperation?
Die ökonomische Theorie untersucht, inwieweit Kooperation mit dem Menschenbild des Homo oeconomicus vereinbar ist. Es werden Konzepte wie externe Effekte, öffentliche Güter, Pigou-Steuer, Coase-Theorem und Spieltheorie (insbesondere soziale Dilemmata) diskutiert. Die Theorie zeichnet ein eher düsteres Bild für freiwillige Kooperation im Umweltbereich, da rational handelnde Individuen tendenziell zur "Schwarzfahrer"-Option neigen.
Welche ethischen Konzepte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit non-kognitivistischen und kognitivistischen Ethikansätzen. Es werden verschiedene Konzepte zur Normendurchsetzung in der Marktwirtschaft vorgestellt, darunter die Institutionenökonomik nach Karl Homann und die integrativen Institutionenethiken nach Steinmann/Löhr und Peter Ulrich. Die Diskussion dreht sich um die Frage, welchen Stellenwert Moral in der Wirtschaft hat und wie Kooperationsnormen durchgesetzt werden können.
Was ist der evolutionstheoretische Ansatz und wie erklärt er Kooperation?
Der evolutionstheoretische Ansatz betrachtet Kooperation im Kontext der biologischen und soziokulturellen Evolution. Es werden Grundlagen der Evolutionsbiologie (z.B. "Survival of the Fittest", Mutation und Selektion) erläutert. Die Theorie erklärt Kooperation durch Verwandtschaftstheorie, Reziprozitätstheorie und Spieltheorie. Es wird eine evolutionäre Kooperationsthese entwickelt, die die Entstehung, Stabilität und Widerstandsfähigkeit von Kooperation erklärt.
Welche Rolle spielen Staat, Betrieb und Gruppe im Kooperationskontext?
Der Staat gibt die Rahmenordnung vor, der Betrieb ist die Ebene, auf der Umweltorientierte Kooperation stattfinden muss, und Gruppen üben Einfluß auf Staat, Betrieb und Individuum aus. Der Staat kann durch Anreize und Sanktionen Kooperation fördern, Gruppen beeinflussen durch Normen und Wertvorstellungen das Verhalten von Individuen, und Betriebe können durch Selbstverpflichtungen und Branchenabkommen Kooperation unterstützen.
Was ist das Beispiel "Brent Spar" und welche Erkenntnisse liefert es?
Der Fall "Brent Spar" wird als ein situatives Beispiel analysiert, um die verschiedenen Theorieansätze zu verdeutlichen. Es wird untersucht, wie der Shell-Konzern in dieser Situation gehandelt hat und welche Rolle Faktoren wie Boykottaufrufe und öffentliche Meinung spielten. Das Beispiel zeigt die Bedeutung von Kommunikation, Selbstverpflichtung und der Macht der Verbraucher.
Welche Anregungen gibt die Arbeit zur Förderung von Kooperation im Umweltbereich?
Die Arbeit schlägt verschiedene Maßnahmen zur Förderung von Kooperation im Umweltbereich vor, darunter die Schaffung von Niedrigpreis-Situationen, die Einführung von Öko-Steuern, die Vergabe von Umweltzeichen und die Stärkung der sozialen Kompetenz durch bildungspolitische Maßnahmen. Es wird betont, daß eine Trendwende hin zu einer kollektiven Nutzenfunktion, die auch kommende Generationen berücksichtigt, notwendig ist.
- Citar trabajo
- Chris Bizer (Autor), 1997, Veränderung hin zu umweltorientierten Handeln aus kooperationstheoretischer Sicht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95403