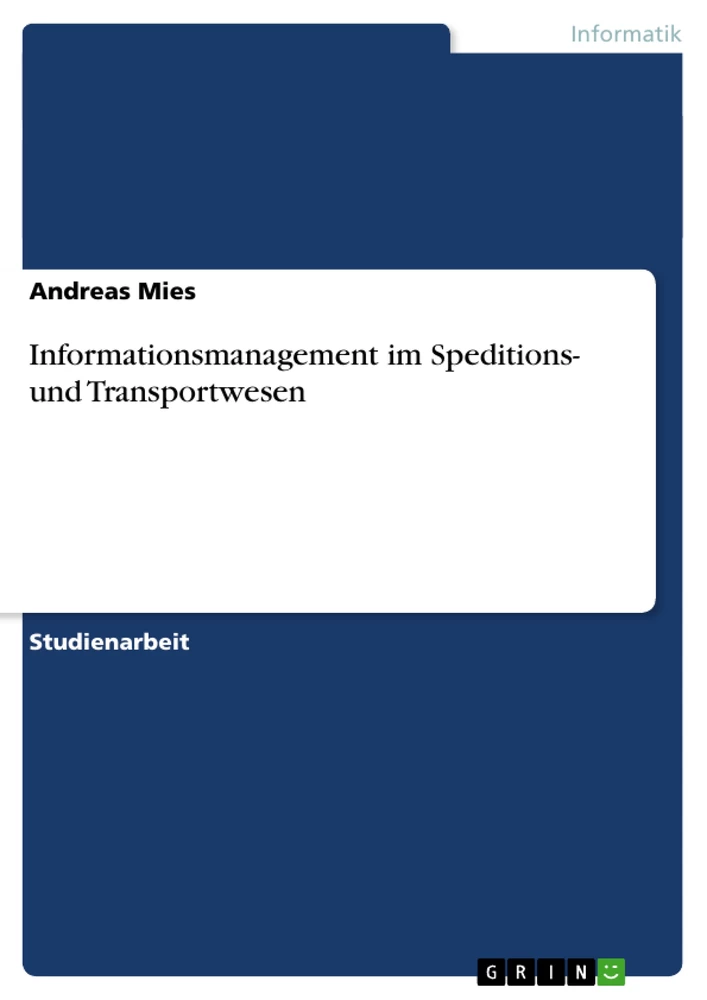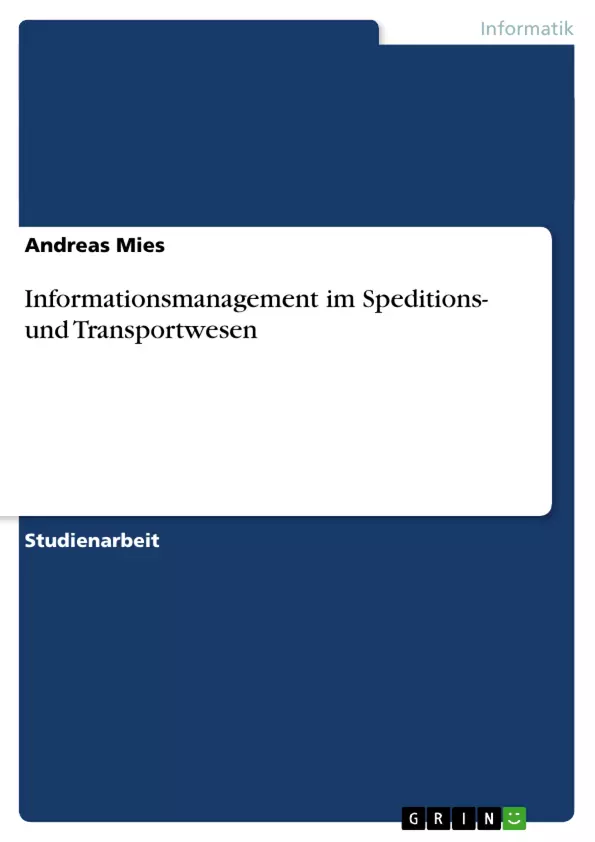INHALTSVERZEICHNIS
1 DIE LOGISTISCHE LEISTUNGSERSTELLUNG - ANSPRÜCHE AN DEN GÜTERVERKEHR
2 INFORMATIONSBEDARF UND LOGISTISCHE LEISTUNGSERSTELLUNG
3 KOMMUNIKATION ZWISCHEN VERSCHIEDENEN UNTERNEHMEN
3.1 MÖGLICHKEITEN DER KOMMUNIKATION
3.2 ZUSAMMENARBEIT AM BEISPIEL STRATEGISCHER UNTERNEHMENSNETZWERKE
3.2.1 Begriffsbestimmung und Effizienz
3.2.2 Informationsbedarf
3.2.3 Ziele des Informationsmanagement
3.2.4 Informations- und Kommunikationssysteme
3.2.5 Resümee
4 VERTIKALER INFORMATIONSFLUß - KOMMUNIKATION MIT DEM FAHRER
4.1 NOTWENDIGKEIT DER MOBILEN KOMMUNIKATION
4.2 FAHRERINFORMATIONSYSTEME
4.3 TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEME UND DEREN EINSATZMÖGLICHKEITEN
4.3.1 Funkruf
4.3.2 Betriebsfunk
4.3.3 Bündelfunk
4.3.4 Mobilfunk im (B-),C-, D1-, D2- und E1-Netz
4.3.5 Datenfunk
4.3.6 Satellitenkommunikation
4.3.7 Ortungssysteme
5 VISION: DER GÜTERVERKEHR DER ZUKUNFT
6 LITERATURVERZEICHNIS
ABBILDUNGEN & TABELLEN
ABBILDUNG 2-1: ALTERNATIVE LOGISTIKKETTEN
ABBILDUNG 3-1: CHARAKTERISTIKA VON STRATEGISCHEN UNTERNEHMENSNETZWERKEN
ABBILDUNG 3-2: ZIELE DES INFORMATIONSMANAGEMENTS IN STRATEGISCHEN UNTERNEHMENSNETZWERKEN DER SPEDITIONS- UND TRANSPORTBRANCHE
TABELLE 2-1: DIE INFORMATIONSSTRÖME INNERHALB EINER VIERSTUFIGEN LOGISTIKKETTE
1 Die logistische Leistungserstellung - Ansprüche an den Güterverkehr
In den letzten Jahren sind die Ansprüche an den Güterverkehr und damit zusammenhängend an die logistische Leistungserstellung im Speditions- und Transportwesen in großen Maße gestiegen.
Einerseits fordert die ständig steigende Verkehrsbelastung auf unseren Straßen, die bei Fort- schreiten der Entwicklung früher oder später zum Verkehrskollaps führen muß, ein Umdenken im Hinblick auf Verkehrsvermeidung. Wachsende Umweltauflagen im Zusammenhang mit ständig steigenden Kosten für Transportmittel verstärken diese Problematik weiter.
Dem Gegenüber steht die moderne Gesellschaft mit dem Anspruch, alle Waren an jedem Ort und in gleichbleibender Qualität verfügbar zu haben, und die Industrie mit immer neuen Konzepten wie Just-in-Time (JIT) oder ein „Outsourcen" der kompletten Logistikkette. „Die Entwicklung geht dahin, von den Speditionen in immer stärkerem Maße die Übernahme logistischer Dienstleistungen zu fordern, wie Lagerung und Verpackung, [...] Informationsbereitstellung (z.B. Statusverfolgung), [...]."
„Dadurch kommt es bei den Speditionen zur Konzentration auf das Kerngeschäft - die dispositive Betreuung des Transportvorgangs - und damit zu einer stärkeren Differenzierung der Speditions- und Frachtführerfunktion." D.h. es muß heutzutage getrennt werden zwischen Speditionen, die u.U. gar keine oder kaum eigene Transportmittel besitzen und Transportunternehmen (Fracht-führer), die ihre Fahrzeuge mit Fahrern den Speditionen zur Disposition anbieten.
Um den Trends auch langfristig noch gerecht werden zu können, müssen vor allem Speditions-unternehmen verstärkt über Transportstrategien zur Effizienzsteigerung (z.B. höhere Auslastung der LKWs, Kombiverkehr, etc.) und Verkehrsvermeidung nachdenken. Dieses beinhaltet sowohl die Kooperation, ohne die heute keines dieser Unternehmen mehr überlebensfähig ist, als auch die Effizienzsteigerung bei der Disposition der Transportmittel. Das Hauptproblem der Auslastung der Transportmittel liegt allerdings meist weniger in der geschickten Disposition der Fahrzeuge, auf deren größtmögliche Auslastung die Speditionen schon aus eigenem Interesse achten, denn Leerfahreten bzw. nicht voll ausgelastete Fahrzeuge verursachen Kosten. Vielmehr läßt sich aufgrund von kurzfistigen Dispositionen und Gegeben-heiten der Infrastruktur bisher nur eine Auslastung der Fahrzeuge von ca. 60% erreichen.
An dieser Stelle sind auch die Transportunternehmen gefragt, die Informationskette innerhalb der logistischen Leistungserstellung durch mobile Komponenten (z.B. Bordcomputer) zu erweitern und damit die Möglichkeiten für Informationsbereitstellung, Sendungsverfolgung und dynamische Planung (d.h. Disposition während der Fahrt) der Speditionen zu schaffen. Dabei wird im folgenden (speziell Abschnitt 4) davon ausgegeangen, daß die Speditionen direkt mit dem Fahrer kommunizieren sollen, egal ob der Fahrer einem unterstellten Transportunternehmen oder der Spedition selbst angehört.
Die rasante Entwicklung auf dem Computermarkt, sowie auch die Aussicht der Privatisierung der Deutschen Bundespost Telekom, die seit dem 1.1.95 vollzogen ist, haben gerade im Bereich der Telekommunikation viele Neuerungen gebracht, die in diesem Zusammenhang zum Einsatz in der Speditions- und Transportbranche zunehmend angenommen werden.
2 Informationsbedarf und logistische Leistungserstellung
Der Weg vom Produzenten zum Kunden, oder vereinfacht vom Sender zum Empfänger, läßt sich als eine Logistikkette mit unterschiedlich vielen Stufen beschreiben (vgl Abb1).
In Anlehnung an: Becker, J. und M.Rosemann (1993), S.112
Abbildung 2-1: Alternative Logistikketten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Man spricht hierbei von einer einstufigen, zweistufigen, dreistufigen oder vierstufigen Logistik-kette, wobei nur bei der einstufigen Logistikkette direkt vom Sender zum Empfänger geliefert wird (eigene Transportmittel). Bei den mehrstufigen Ketten werden rechtlich eigenständige Speditionen (Versand- und/oder Empfangsspedition), sowie bei Bedarf Frachtführer zwischen-geschaltet.
Tabelle 1 gibt nun einen Überblick über sämtliche möglichen, zwischen den Gliedern der Logistik-kette fließenden Informationsströme.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
nach: Becker, J. und M.Rosemann (1993), S.115
Tabelle 2-1: Die Informationsströme innerhalb einer vierstufigen Logistikkette
Man sieht deutlich, daß bei der logistischen Leistungserstellung die verschiedensten Informationen zwischen mehreren Institutionen ausgetauscht werden müssen. Dieser Austausch kann dabei sowohl vor, begleitend, nach oder entgegengesetzt dem Güterstrom erfolgen, die Daten werden entweder unverändert weitergegeben (statische Informationen) oder während des Informations-flusses modifiziert (dynamische Informationen). Ein weiteres Problem besteht darin, daß viele Informationen zeitkritisch an den Transport der Ware gekoppelt sind. So können Informationen, die gleichzeitig mit der Ware beim Empfänger ankommen, schon zu spät eintreffen. Ein Beispiel dafür wäre die genaue Lieferzeit, aufgrund der ein Empfangsspediteur die Ware im Voraus weiter disponieren kann und dabei sowohl Zeit als auch Kosten spart.
Daher sollte der Informationsstrom soweit wie möglich von Güterstrom entkoppelt werden, um Redundanzen und Doppelterfassung zu vermeiden und damit unproduktive Phasen in der Wert-schöpfungskette zu eliminieren.
Durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationssysteme zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Stufen der Logistikkette wird dabei versucht, die innerbetrieblichen Reaktions- und Dispositionszeiten zu verkürzen, um eine Verbesserung des Lieferservice und damit Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
3 Kommunikation zwischen verschiedenen Unternehmen
3.1 Möglichkeiten der Kommunikation
Aufgrund der engeren Zusammenarbeit in der Speditions- und Transportbranche muß auch die Kommmunikation zwischen den kooperierenden Unternehmen reibungslos verlaufen.
Ebenso wichtig ist auch die Kommunikation zum Kunden oder vom Kunden zum eigenen Unternehmen. Augenblicklich findet diese vertikale sowie auch horizontale Kommunikation zwischen den verschiedenen Unternehmen auf zwei Arten statt:
1. Kommunikation durch Telefon und Telefax/Telex
2. Kommunikation durch EDI
ad 1.
Bei den kleinen bis mittelgroßen Unternehmen der Speditions- und Transportbranche erfolgt die Kommunikation - wie beispielsweise die Übermittlung von Auftragsdaten - zum überwiegenden Teil noch per Telefonanruf oder durch das Versenden eines Telefax/Telex. Gerade das Telefax hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, da es gegenüber dem Telex große Kostenvorteile bietet und gegenüber dem Telefon die Nachrichten in schriftlicher Form vorliegen. Die Tatsach, daß solche „alten" Technologien eingesetzt werden kann man auf mehrere Gründe zurückführen:
Bei der Befragung entsprechender Mitarbeiter einiger Speditionen kam zum Ausdruck, daß die Speditionen sich ausschließlich den Anforderungen ihrer Kunden anzupassen scheinen. So liegen z.B. bei Dauerkunden bestimmte Rahmenbedingungen vor (Abhol- und Anlieferort, Preise), der Transport an sich erfolgt auf Anruf. Das bedeutet, eine Reaktion auf veränderte Marktverhältnisse - in bezug auf die Kommunikation - erfolgt erst, sobald die jeweiligen Kunden bestimmte Arten der Kommunikation vorschreiben, wie bei dem JIT-Prinzip in der Automobilzuliefererindustrie.
Ein weiteres Problem vieler Speditions- und Transportunternehmen ist das Kosten-/Leistungs- verhältnis einer Investition in fortschrittliche Kommunikationstechnologien. Investitionen dieser Art scheinen sich auf den ersten Blick für die beteiligten Unternehmen nicht zu rentieren.
Bei den Befragungen kam aber auch der Eindruck auf, daß bei den Beteiligten ein Informationsdefizit über die Anwendung entsprechender moderner Kommunikationstechnologien bestand.
ad 2.
Wie in Abschnitt 2 schon erwähnt, verbergen sich in der direkten Kommunikation (mit EDI) erhebliche Rationalisierungspotentiale durch den Wegfall unnötigen Verwaltungsaufwands. Auch können durch eine Verkürzung der innerbetrieblichen Reaktions- und Dispositionszeit, die zu einer Verbesserung der Lieferqualität führen, Wettbewerbsvorteile erzielt werden. Bei dieser Art der Kommunikation erfolgt der Austausch von Daten mit Hilfe von international genormten Datensäzen. Unter dem Stichwort „EDIFACT" soll eine einheitliche Schnittstelle für den Datenaustausch im externen Geschäftsverkehr eingeführt werden. Aufgrund der Einbeziehung aller wichtigen internationalen Normungs- und Standardisierungsgremien bei der Entwicklung wird es auf langfristige Sicht für jegliche Handelbeziehung in Zukunft wohl unverzichtbar für Unternehmen sein über entsprechende Möglichkeiten der Kommuniktion zu verfügen.
Beispielhaft wäre die Übermittlung von Auftragsdaten oder von elektronischen Transportbelegen. Die manuelle Überprüfung und die darauffolgende manuelle elektronische Wiedererfassung der Daten durch Eingabe in die eigenen Computer, hinter der sich eine zusätzliche Fehlerquelle bei der Eingabe verbergen kann, würde entfallen. Somit findet eine meist fehlerfreiere, kostensparendere und beschleunigte Erfassung und Verarbeitung von entsprechenden Daten statt, die direkt in die eigene EDV übernommen werden können. Probleme des EDI ergeben sich durch fehlende geschlossene Gesetzgebung im nationalen wie im internationalen elektronischen Datenaustausch. Im Transportwesen muß der Frachtführer ständig in der Lage sein „die Rechtmäßigkeit eines Warentransportes durch unterschriebene Dokumente nachzuweisen" . Da dieser rechtliche Aspekt fehlt wurde EDI hauptsächlich im externen Geschäftsverkehr nur von Unternehmen genutzt, die langjährige Geschäftsbeziehungen besitzen, oder aber im internen Geschäftsverkehr von national oder international tätigen Unternehmen. Beispielhaft wäre eine große internationanl tätige Spedition, deren interner Informationsfluß zwischen den einzelnen Niederlassungen nur noch durch EDI erfolgt.
Zur rechtlichen Arbeitssicherung bei etwaigen Problemen schließen die EDI-Partner einen EDI-Vertrag ab, der über Geschätsprozesse, Volumen des Datenaustausches, Übertragungsmethodik, etc. Aufschluß gibt.
3.2 Zusammenarbeit am Beispiel strategischer Unterne hmensnetzwerke
3.2.1 Begriffsbestimmung und Effizienz
Durch die Öffnung des europäischen Binnenmarktes und die Öffnung der Grenzen nach Osteuropa nimmt die Nachfrage nach internationalen Transporten ständig zu. Logistikunternehmen „müssen in der Lage sein, der Kundennachfrage, unabhängig von Ort und Zeit, europaweit flächendeckende Logistikleistungen von gleichbleibend hoher Qualität anzubieten." Bisher wurde versucht, diese Art von Service durch lose Verbindungen von Speditionsunternehmen untereinander oder von Speditions- und Transportunternehmen anzubieten. Durch bilaterale Verträge wurden diese Verbindungen abgesichert. Problematisch bei dieser Art der Kooperation sind die Kosten für Anbahnung, Vereinbarung, Kontrolle und Anpassung der wechselseitigen Leistungbeziehungen. Zusammenfassend nennt man diese Kosten „Transaktionskosten".
Um die Transaktionskosten zu minimieren bietet sich für Logistikdienstleister die Möglichkeit einen Zusammenschlusses zu einem „strategischen Unternehmensnetzwerk", welches versucht durch eine bestimmte Organisationsform die Glieder der Logistikkette einer integrierten, zentral geplanten und gesteuerten Ablauforganisation zu unterwerfen wie auch die Transaktionsprobleme möglichst kostengünstig zu bewältigt.
Strategische Unternehmensnetzwerke zeichnen sich durch bestimmte Merkmale aus:
(1) Die eingebundenen Speditionen und Transportunternehmen bleiben rechtlich selbständig.
(2) Die Unternehmen erstellen gemeinsam ein logistisches Leistungsangebot, mit dem Ziel die logistische Wertschöpfungskette zu optimieren.
(3) Es besteht eine enge Beziehung zwischen den einzelnen Unternehmen.
(4) Ein weiteres Ziel ist die Erschließung von wettbewerbsrelevanter Potentiale auf den Märkten, in denen Unternehmen tätig sind oder tätig werden wollen.
Zusammenfassend könnte eine Definition des Begriffs „strategisches Unternehmensnetzwerk" folgendermaßen aussehen:
„Ein strategisches Unternehmensnetzwerk von Logistikdienstleistern stellt eine Organisationsform zur Erstellung von logistischen Leistunangeboten dar, bei der rechtlich unabhängige Speditions- und Transprotunternehmen ihre diesbezüglichen Aktivitäten auf kooperative Weise unternehmensübergreifend koordinieren, um wettbewerbsvorteile gegenüber den konkurrierenden Anbietern logistischer Dienstleistungen zu realisieren." Eine Kombination von Merkmalen von Markt und Hierarchie sind charakteristisch für strategische Unternehmensnetzwerke.
Von den Merkmalen des Marktes fließen die Funktionsspezialisierung und der marktliche Effizienzdruck ein. Unter einer Funktionsspezialisierung wird die Konzetration eines bestimmten Unternehmens im Netzwerk auf eine bestimmte Funktion oder ein Marktsegment verstanden. Beispielhaft wäre die Konzentration auf eine bestimmte Region oder auf Kunsttransporte. Zudem müssen jedoch alle Unternehmen ständig bemüht sein ihre angebotene Leistung so effizient wie möglich anzubieten, da das entsprechende Unternehmen ansonsten aus dem Unternehmensnetzwerk ausgeschlossen werden könnte und ein anderes an dessen Stelle tritt (Merkmal : marktlicher Effizienzdruck ).
Vertrauen und Rücksichtnahme auf die Partner wiederum ist ein Hierarchie-Merkmal, welches meist eine grundsätzliche Voraussetzung jeder Zusammenarbeit ist. Als ein weiteres ist die Infor-mationsintegration zu nennen. Als eigenständige Unternehmen würde jedes Unternehmen ein isoliertes Informations- und Kommunikationssystem betreiben. Diese Isolierung soll in einem Unternehmensnetzwerk aufgehoben werden und zu IuK-Systemen führen, welches jedem Partner jederzeit die Möglichkeit eröffnet, über die relevanten Daten zu verfügen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Stahl, D. (1994), S. 146
Abbildung 3-1: Charakteristika von strategischen Unternehmensnetzwerken
Die Kombination dieser Merkmale hat eine Kostensenkung und alle damit verbundenen positiven Folgen zum Ziel.Die Gesamtkosten in einem solchen Netzwerk setzen sich aus den Produktions-kosten und den Transaktionskosten zusammen.
Die Produktionskosten sind die Kosten der logistischen Leistungserstellung. Diese lassen sich durch ein gemeinsames Handeln in den Beschaffung von Betriebsmitteln, beim Marketing und Vertrieb und von Führung und Organisationsaufgaben erhelblich senken. Die Transaktionskosten werden in diesem Zusammenhang auch als IuK-Kosten bezeichnet. Einer Optimierung der Informationsversorgung und der Kommunikation der Unternehmen untereinan-der hat somit eine entscheidende Bedeutung für die Senkung dieser Kosten.
3.2.2 Informationsbedarf
In vielen Lehrbüchern wird von der Information als Produktionsfaktor oder einer unternehmerischen Ressource gesprochen. Informationen sind also ein wichtiger Bestandteil der logistischen Leistungserstellung in strategischen Unternehmensnetzwerken. Sie haben eine unterstützende Wirkung in vielerlei Hinsicht.
Informationen dienen bei der Planung oder Entscheidung über die Logistikkette als ein unter- stützendes Glied, durch welche eine effiziente Gestaltung erst ermöglicht wird. Bei der Steuerung von Prozessen, insbesondere von Handlungsanweisungen, sind Informationen unverzichtbar. Bevor beispielsweise ein bestimmtes Gut an einem Ort ankommt sollten die Informationen schon vorhanden sein wie mit dem entsprechenden Gut weiter zu verfahren ist, damit kein „Leerlauf" in der Logistikkette entsteht. Informationen haben eine unterstützende Wirkung bei Kontrollprozessen, denn nur wenn einem Entscheidungsträger die Soll- sowie die Ist-Daten vorliegen kann kann eine möglichst optimale Entscheidung getroffen werden. Man könnte sagen: „ Jede Entscheidung ist nur so gut wie die Informationen auf denen sie beruht."
Desweiteren hat die Information eine Dokumentationsaufgabe bei der Leistungserstellung, die es beispielsweise ermöglicht den physischen Warenweg bei etwaigen Beanstandungen zu rekon-struieren, um damit beispielsweise den Ort der Beschädigung ausfindig zu machen und diese Fehlerquelle in der Logistikkette zu beseitigen.
Damit ist nun die Wichtigkeit der Ressource „Information" hervorgehoben, die deshalb auch über ein eigenes Management verfügen sollte, wie die Ressourcen Kapital. oder Personal. Dieses Informationsmanagement ist weniger auf die technikoriernierte Ausgestaltung von IuK-Systemen bezogen, als vielmehr auf die systematische Planung, Steuerung, Kontrolle und Organisation aller unternehmensinternen wie auch unternehmensübergreifenden Informationsaktivitäten.
3.2.3 Ziele des Informationsmanagement
Durch den Einsatz eines erfolgreichen Informationsmanagement im strategischen Unternehmens-netzwerken wird versucht die im folgenden aufgezählten Ziele für alle beteiligten Speditions- und Transprotunternehmen zu verfolgen. Verringerung der Kosten der Leistungserstellung Durch einen verbesserten Informationsfluß können Folgehandlungen schon vor dem Eintreffen einer Ware geplant werden. Infolgedessen könne ständig Optimierungsprozesse in der Logistikkette durchgeführt werden.
Ebenfalls ist es durch vorher verfügbare Informationen möglich zu bestimmten Zeiten an entsprechenden Orten eine flexible Kapazitätsanpassung an veränderte Beschäftigungsgrade vorzunehmen.
Verringerung der Transaktionskosten
In einen Netzwerk lassen sich durch verbesserten Informationsaustauch die Transaktionskosten durch die Kenntnis möglicher Partner, der Sicherung des Kundenschutzes, den Aufbau von Vertrauen zu den Partnern und einer gemeinsamen Administration und Kontrolle erheblich senken.
Verbessergung der Leistungqualität
In diesem Punkt soll besonders die Kundenorientierung eines strategischen Unternehmens- netzwerks hervorgehoben werden. Durch den engeren Austausch von Informationen können dem Kunden verbesserte Informationsdiestleistungen angeboten werden. Gemeinsam mit dem Kunden ist es möglich Beschaffungsloigstikkonzepte zu erarbeiten ( JIT ) und letzten Endes kann dem Kunden eine Erhöhung der Leistungsicherheit durch rechtzeitige Kapazitätserweiterung und durch frühzeitige Korrektur von Systemfehlern garantiert werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehung an: Stahl, D. (1994), S.162
Abbildung 3-2: Ziele des Informationsmanagements in strategischen Unternehmensnetzwerken der Speditions- und Transportbranche
Alle diese Verbesserungen durch das strategische Unternehmensnetzwerk richten sich letztlich auf die Gesamtziele einer umfassenden Kostenhührerschaft und Qualitätsführerschaft am Markt.
3.2.4 Informations - und Kommunikationssysteme
Eine verbesserte Infromation und Kommmunikation läßt sich natürlich nur durch den Einsatz spezieller IuK-Systeme erzielen. Diese IuK-Systeme kann man in die Kategorien mengenorientierte operative Systeme, wertorientierte Abrechnungssysteme und Management- Informationsysteme einteilen. Im folgenden sollen diese Kategorien kurz beschrieben werden. Mengenorientierte Abrechnungssysteme Unter dieser Kategorie faßt man Administrations- und Dispositionssysteme zusammen.
Administrationssysteme sind Systeme, die die manuellen und halbmanuellen Verfahren zur Verkehrsabwicklung bei der logistischen Leistungserstellung ersetzen. (z.B. Sendungsverfolgungssysteme)
Dispositionssysteme dienen zur systemübergreifenden Kapazitätsoptimierung der beteiligten Unternehmen eines stratigischen Netzwerks (z.B. Frachtbörsen).
Wertorientierte Abrechungssysteme
Dies sind Systeme, die die Leistungsbeiträge der Partner im Netzwerk verdichten und diese dann computergestützt verrechnen.
Management-Informationssysteme
Unter dem Begriff Management-Informationssysteme sind Planugs- und Entscheidungssysteme, Analyse- und Berichtssysteme sowie Kontrollsysteme zusammengefaßt, die den Entscheidungs-trägern im Unterehmen eine gute Grundlage zum Treffen von Entscheidungen bereitstellen sollen.
Wichtig ist es vielleicht in diesem Fall noch zu bemerken, daß vor einem Einsatz von kostspieligen IuK-Systemen ersteinmal die Informationsdefizite herauszukristallisieren sind, da in einigen Bereichen die Anschaffung solcher Systeme nicht immer zum gewünschten Erfolg führt.
3.2.5 Resümee
Strategische Unternehmensnetzwerke stellen den beteiligten Unternehmungen eine große Anzahl an Möglichkeiten zur Rationalisierung bzw. zur Steigerung der Produktivität. Eine der wichtigsten Recourcen, durch die diese Ziele erreicht werden können, stellt die Information dar. Auch von den Verantwortlichen in den entsprechenden Unternehmen wurde in letzter Zeit die Bedeutung eines guten Informationsmanagements erkannt und durch den Einsatz moderner IuK-Systeme gewürdigt. Durch diesen Einsatz unternehmensübergreifender Systeme läßt sich eine bedeutende Senkung der Produktonskosten sowie eine Verbesserung der Qualität der logistischen Leistung erreichen. Dieses effiziente Informationsmanagement wird in Zukunft die Entscheidung über eine Partizipation am Markt oder das Ausscheiden von entscheidender Bedeutung sein.
4 Vertikaler Informationsfluß - Kommunikation mit dem Fahrer
4.1 Notwendigkeit der mobilen Kommunikation
„War es bisher in der Regel nur schwer möglich, Fahrzeug und Fahrer unterwegs zu erreichen, geschweige denn zu disponieren und zu überwachen, so wird dies künftig durch moderne, integrierte Informations- und Kommunikationssysteme Realität werden." Dabei unterscheidet man zunächst Fahrerinformationssysteme, im Allgemeinen als Bordcomputer bekannt und Telekommunikationssysteme, die eine direkte Verbindung vom Fahrer zur Spedition ermöglichen.
4.2 Fahrerinformationsysteme
Bei den Fahrerinformationssystemen geht es primär um die Erfassung von Tourdaten, wie Standzeiten, Geschwindigkeiten, Treibstoffverbrauch etc., aber auch um Verwaltungsdaten, wie Kundenadressen, Güterbeschreibungen etc.
Hierzu stellt Lublow fünf Typen von solchen mobilen elektronischen Informationssystemen vor. Dies sind Handterminals, Bordcomputer, Hand-Held-Computer, Laptops und Notebooks. Die Systeme unterscheiden sich im wesentlichen nur durch spezifische Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten, leisten jedoch im wesentlichen dieselben Funktionen. Deshalb will ich an dieser Stelle nicht auf die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Systeme eingehen, sondern mich vielmehr mit deren Eingliederung in die Informationskette beschäftigen.
Die Informationssysteme besitzen im wesentlichen die Aufgaben der Fahrerinformation (Adressen der Kunden, Ankunftstermine zeitkritischer Güter), Belegerstellung (Drucken des Lieferscheins oder der Quittung beim Kunden), Tour- und Fahrzeugdatenerfassung (Fahrtenschreiber, Wartungstermine). Dazu sind u.U. Zusatzgeräte wie festinstallierte Sensoren, Tastatur, Anzeigen (Display oder Bildschirm), Barcodeleser, Positionsbestimmungssysteme und Rückfahrkameras nötig. Der Datenaustausch kann mit Hilfe von physischen Datenträgern oder über mobile Datenkommunikation erfolgen. Mit solchen Systemen können sowohl Zeitersparnisse realisiert werden, als auch doppelte Erfassung, z.B. bei Nachlieferungen oder neuen Bestellungen vermieden werden.
4.3 Telekommunikationssysteme und deren Einsatzmöglichkeiten
Telekommunikationssysteme ermöglichen in diesem Zusammenhang die direkte Erreichbarkeit der Frachtführer während der Fahrt.
Die Vorteile dieser Erreichbarkeit sind u.a.(abhängig vom System):
- Fahrzeuge können z.B. bei bekannten Staus umgeleitet werden
- Verzögerungen von zeitkritischen Lieferungen sind der Zentrale sofort bekannt, es können sofort geeignete Maßnahmen ergriffen werden
- die Touren der Fahrer können bei Bedarf noch während der Fahrt umdisponiert werden
- Neue Daten über Fehlmengen, Reklamationen, neue Bestellungen etc. können direkt vom Fahrer eingegeben werden und stehen der Disposition ohne zeitliche Verzögerung zur Vefügung
Im folgenden soll ein Überblick über die wichtigsten zur Zeit in Deutschland verfügbaren mobilen Telekommunikationssysteme gegeben werden.
4.3.1 Funkruf
Die einfachste Form der mobilen Kommunikation sind die Funkrufdienste wie Eurosignal, Cityruf, Euromessage und ERMES.
Bei diesen Diensten erfolgt die Übertragung einseitig, d.h. der Fahrer besitzt einen Empfänger, der per Telefon oder Auftragsdienst angewählt werden kann. Die Spanne hierbei reicht vom Nur-Ton-Ruf (alle Systeme) über numerische bis zu alphanumerischen Anzeigemöglichkeiten in verschie-denen Ausmaßen (außer Eurosignal). Der Nachteil, vor allem am Cityruf, daß die Geräte nur in einem Radius von 70km erreichbar waren, wurde von der DeTeMobil abgeschafft. Die Menge der zu übertragenden Nachrichten bzw. Zeichen ist allerdings begrenzt (nicht ERMES) und eine bidirektionale Kommunikation ist nicht möglich (alle Systeme).
4.3.2 Betriebsfunk
Ein weitverbreitetes System ist der sogenannte Betriebsfunk, wobei jeder Betreiber seine eigene Feststation und entsprechende Mobilstationen besitzt. Der Betriebsfunk ist im wesentlichen mit den CB-Funk für Privatleute vergleichbar. Vorteil ist vor allem der Kostenfaktor, Nachteile sind fehlende Abhörsicherheit, fehlender Zugang zu Telefonnetzen und eine vergleichbar geringe Reichweite. Einsatz finden diese Systeme im regionalen Auslieferungsverkehr, z.B. bei Spedition Schenker (näheres siehe xxx).
4.3.3 Bündelfunk
Seit 1990 bietet die DeTeMobil (damals noch DBP) das Bündelfunknetz Chekker an, um die Nachteile des Betriebsfunk zu kompensieren. Bei diesem System wird ein Bündel von Funkkanälen zur Verfügung gestellt, aus denen bei Bedarf eine Frequenz ausgewählt wird. Dies garan-tiert jederzeit freie Leitungen und Abhörsicherheit. Chekker ist mittlerweile in allen größeren Wirtschaftsregionen verfügbar, die Kommunikation mit anderen Regionen und auch der Anschluß an das Telefonnetz sind möglich. Bei Chekker wird eine monatliche Gebühr pro Gerät und erreichbare Wirtschaftsregion bezahlt, die Benutzung des Telefondienstes wird nach den Tarifen des Mobilfunk abgerechnet. Dadurch können die Kosten für dieses System relativ genau kalkuliert werden. Zu den Einsatzbereichen von Chekker gehört neben dem Regionalverkehr die Ausliefe-rung in Wirtschaftsregionen.
4.3.4 Mobilfunk im (B-),C-, D1-, D2- und E1-Netz
Während das B-Netz nur der Vollständigkeit halber noch erwähnt wird, erfreuen sich die C-, D1- und D2-Netze zunehmender Beliebtheit. Die Vorteile sind die Erreichbarkeit (fast) überall in Deutschland und in den D-Netzen die digitale Übertragung, die eine bessere Übertragungsqualität gewährleistet und die Realisierung des europäischen GSM-Standards . Auch Faxbetrieb und Datentransfer sind in diesen Netzen möglich. Das E1-Netz wird wie auch das D2-Netz nicht von der DeTe-Mobil betrieben (E1 von E1-Plus, D2 von Mannesmann) und befindet sich zur Zeit in der Einführungsphase. Es soll auf Dauer als kostengünstige Konkurrenz zu den D-Netzen bestehen. Die Mobilfunknetze sind trotz Möglichkeit zum Datentransfer in erster Linie zur verbalen Kommunikation geeignet und lassen sich für überregionale Transporte einsetzen.
4.3.5 Datenfunk
Von der Telekom im Jahr 1993 eingeführt, soll der neue Dienst Modacom die volle mobile Daten-kommunikation ermöglichen. Er funktioniert mittlerweile auch in allen wichtigen Wirtschafts-regionen, im Endausbau soll das Netz fast flächendeckend in der BRD sein. Ein Modacom-System besteht aus mobilen Terminals, z.B. Laptops mit Funkmodem und einem Zentralrechner mit entsprechender Software, der am Datex-P-Netz der Telekom angeschlossen ist. Über das Modacom-Netz und das Datex-P-Netz wird die Verbindung zwischen Terminal und Zentral-rechner hergestellt. Die digitale Verbindung kann nun zur Datenkommunikation in beide Rich-tungen genutzt werden. Neu bei diesem System ist, daß nicht nach Dauer der Verbindung, sondern nach übertragener Datenmenge abgerechnet wird. So empfiehlt sich Modacom z.B. bei häufigen kurzen Anfragen, wobei sich die Terminals mit dem Zentralrechner in ständiger Verbin-dung befinden können. So können Kundendaten, Fehlmengen, Neubestellungen etc. direkt vom Fahrer erfaßt werden und sind automatisch sofort für die DV der Spedition verfügbar. Auch Verbindungen zu und von anderen Rechnern im Datex-P-Netz sind möglich.
4.3.6 Satellitenkommunikation
Die Satellitenkommunikation ist vor allem in Flächenstaaten wie der USA von Bedeutung. In Deutschland bzw. Europa dagegen wird diese Technologie nur zögerlich eingesetzt, da die herkömmlichen Mobilfunknetze recht gut ausgebaut sind und die Satellitenkommunikation sehr teuer ist. Hier sind in erster Linie die Satelliten Inmarsat A - C zu nennen, an denen sich bisher knapp 80 Staaten beteiligt haben. Über Inmarsat A und B sind Telefon-, Telefax- und Daten-verbindungen sowie Hörfunk- und Videoübertragungen möglich. Inmarsat-C ist dagegen nur für die Datenkommunikation zuständig.
Für 1997 ist ein weiterer Satellitendienst angekündigt, der unter dem Name Iridium mit 77 Satelliten in Betrieb gehen soll. Im Gegensatz zu den Inmarsat-Systemen wird hierfür statt einer Parabolschüssel nur ein Handtelefon mit Stabantenne benötigt werden. Die Handtelefone können dann über bestehende terrestrische Netze nach GSM-Standard kommunizieren, bei nicht-zustandekommender Verbindung wird auf das Iridium-Netz umgeschaltet.
Einsetzbar sind diese Systeme aufgrund des hohen Preises bisher vor allem für Speditionen, die weltweit mit Fluglinien und/oder Reedereien arbeiten.
4.3.7 Ortungssysteme
Zur lokalisierung des Standortes von Fahrzeugen eignet sich das ehemals nur militärisch eingesetzte GPS , bei dem von Fahrzeugen aus jeweils vier der insgesamt 24 Satelliten angepeilt werden können. Damit kann der Standort eines Fahrzeugs bis auf 50m genau ermittelt werden. Alle Fahrzeuge einer Fahrzeugflotte können so z.B. auf einer digitalen Landkarte des Disponenten dargestellt werden.
Für das Fuhparkmanagement ist auch das Satellitenkommunikationssystem Euteltracs interessant, das in Deutschland von Alcatel SEL vertrieben wird. Hierbei ermöglichen zwei geostationäre Satelliten, die Europa, den nahen Osten und weite Teile Nordafrikas abdecken, den Austausch schriftlicher Nachrichten und Makromeldungen und eine Fahrzeugortung auf 500m genau. Einsetzbar ist das System ähnlich wie Modacom (siehe oben), allerdings nicht ganz so variabel.
5 Vision: Der Güterverkehr der Zukunft
Wie zu Beginn schon erwähnt wird sich der Leerfahrtenanteil von LKWs der Speditions- und Transportbranche niemals auf Null reduzieren lassen, da es primär produzierende und primär konsumierende Regionen gibt. So können LKWs, die momentan Lieferungen in die neuen Bundesländer bringen, kaum damit rechnen, voll beladen wieder zurückfahren zu können, da im Osten zur Zeit noch erheblich mehr konsumiert als produziert wird. Eine der wenigen Branchen, wo eine Auslastung von nahezu 100% erreicht werden kann, ist die Getränkeindustrie, in der aufgrund der Pfandrückläufe die Fahrzeuge voll beladen (mit Leergut) zurückkehren.
Ein Novum für den Sammelgutverkehr für kleine Liefermengen bei relativ weitläufigen Liefergebiet ist das sogenannte HUB-System , das neuerdings bei Paketdiensten, aber auch Samelgutspeditionen große Beachtung findet. Notwendig hierfür ist ein recht enges Netz von Filialen im ganzes Auslieferungsraum. Aber auch ein strategisches Netzwerk mit Spezialisierungen im Regionalverkehr könnte solch ein System aufbauen. Alle Lieferungen werden von den Filialen nachts in ein zentral gelegenes Güterverteilungszentrum gebracht und dort neu auf die LKWs, die aus den einzelnen Lieferregionen kommen verteilt. So werden sowohl die LKWs, die zum Zentrum kommen, als auch die, die von dort wieder losfahren, nahezu optimal genutzt. Zur Erkennung der Waren dienen Barcodeleser, die sich entweder in den einzelnen LKWs oder an den Toren des Verteilungszentrums befinden. Die Papiere (Lieferschein etc.) werden entweder im Verteilungszentrum oder direkt beim Kunden gedruckt. Als Vorteile haben sich bei den Unternehmen, die dieses System praktizieren bereits herausgestellt:
- Die Auslastung der LKWs ist wesentlich höher
- Die Lieferqualität erhöht sich durch die Barcodeleser erheblich
- Jede Filiale kommt mit relativ wenig Fahrten pro Tag aus.
- Der Anteil der Nachtfahrten steigt erheblich, dadurch Entlastung der Straßen
- Eine 24-Stunden-Liefergarantie (Inlandsverkehr) wird ohne weiteres erfüllbar
Aufgrund fehlender rechtlicher Rahmenbedingungen auf nationaler wie internationaler Ebene wird es in naher Zukunft weiterhin schwierig bleiben, ganz ohne schriftliche Belege wie Lieferpapiere im Warenverkehr auszukommen, da weder das Telefax, noch der EDIFACTStandard rechtlich voll abgesichert sind. Dieses Problem muß zumindest auf europäischer Ebene gelöst werden, um zunächst einmal die vollen Möglichkeiten der bestehen Informations- und Kommunikations-systeme nutzen zu können und damit auf Dauer international konkurrenzfähig zu bleiben.
Für die mobile Komponente der Informationskette ist anzunehmen, daß der Einsatz der Satellitenkommunikation in Zukunft stärker auch in Europa an Bedeutung gewinnen wird. So könnte durch eine Kombination mit Modacom-ähnlichen Systemen und GPS eine weltweite oder auch nur europaweite Disposition der Fahrzeuge von einem zentralen Punkt aus stattfinden. Der Fahrer übernimmt dabei auch zunehmend verwaltungstechnische Aufgaben wie direkte Eingaben von neuen Bestellungen, Fehlmengen oder Reklamationen und die Erstellung von Belegen.
6 Literaturverzeichnis
Becker, J. und M. Rosemann (1993): Logistik und CIM. Springer, Berlin u.a.
Biedenkopf, K.H.(1994): Komplexität und Kompliziertheit. In: Informatik-Spektrum 17, S.82-86
DeTeMobil GmbH - Broschüren zu Mobilfunk (Stand: Oktober 1994), D1 (Juni 1994), Chekker (Oktober 1994) und Modacom (Februar 1993)
Gabler-Wirtschafts-Lexikon (1993), 13.Auflage, Taschenbuch-Ausgabe in 8 Bänden, Gabler, Wiesbaden
Gallasch, W. (1993): Wirtschaftliche Bedeutung und betriebliche Auswirkungen des elektronischen Datenaustauschs
In: Scheer, A.-W. (Hrsg): Handbuch Informationsmanagement, Gabler, Wiesbaden, S.567- 587
Hiltmair, J. (1993): Steuerung des Straßengüterverkehrs. In: Zeitschrift für Logistik, 4/93, S.53-57
Lublow, R. und H. Otten (1993): Bordcomputer - die einzige Alternative? In: Zeitschrift für Logistik, 2/93, S.63-66
Petry, K. (1994): Transportstrategien in Beschaffung und Distribution In: Zeitschrift für Logistik, 4/5/94, S.75-79
Schenker Eurocargo AG - aktuelle Broschüren zur Spedition und HUB-Systematik
Schenker Eurocargo AG - persönliches Interview mit Prokurist/ Verkaufsleiter
Stahl, Dirk (1994): Die Bedeutung des Informationsmanagements in strategischen
Unternehmensnetzwerken der Speditions- und Transportbranche
In: M.Höller, V.Haubold, D.Stahl und H.Rodi: Die Bedeutung von Informations- und
Kommunikationstechnologien für den Verkehr. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, S.131 - 189
Wandt Spedition, GmbH - persönliches Interview mit Speditionsleiter
Anregungen, Kritiken
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Was behandelt dieser Text hauptsächlich?
Dieser Text behandelt die logistische Leistungserstellung, Informationsbedarf und Kommunikationsmöglichkeiten im Güterverkehr, insbesondere im Speditions- und Transportwesen. Er untersucht die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, die Kommunikation mit Fahrern und gibt eine Vision für den Güterverkehr der Zukunft.
Welche Ansprüche werden an den Güterverkehr gestellt?
Die Ansprüche an den Güterverkehr sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Dazu gehören die Notwendigkeit zur Verkehrsvermeidung aufgrund steigender Verkehrsbelastung und Umweltauflagen, sowie die Erwartung einer ständigen Verfügbarkeit von Waren an jedem Ort bei gleichbleibender Qualität. Auch Industrie-Konzepte wie Just-in-Time (JIT) tragen zu diesen Ansprüchen bei.
Welche Rolle spielt die Information bei der logistischen Leistungserstellung?
Informationen sind ein wichtiger Bestandteil der logistischen Leistungserstellung. Sie dienen zur Planung und Entscheidung über die Logistikkette, zur Steuerung von Prozessen, zur Unterstützung bei Kontrollprozessen und zur Dokumentation der Leistungserstellung.
Welche Kommunikationsmöglichkeiten gibt es zwischen Unternehmen?
Die Kommunikation zwischen Unternehmen erfolgt hauptsächlich über Telefon, Telefax/Telex und EDI (Electronic Data Interchange). EDI bietet erhebliche Rationalisierungspotentiale durch den Wegfall unnötigen Verwaltungsaufwands.
Was ist ein strategisches Unternehmensnetzwerk?
Ein strategisches Unternehmensnetzwerk ist eine Organisationsform zur Erstellung von logistischen Leistunangeboten, bei der rechtlich unabhängige Speditions- und Transportunternehmen ihre diesbezüglichen Aktivitäten auf kooperative Weise unternehmensübergreifend koordinieren, um Wettbewerbsvorteile zu realisieren.
Welche Ziele verfolgt das Informationsmanagement in strategischen Unternehmensnetzwerken?
Das Informationsmanagement in strategischen Unternehmensnetzwerken verfolgt die Ziele der Verringerung der Kosten der Leistungserstellung, der Verringerung der Transaktionskosten und der Verbesserung der Leistungsqualität.
Welche Arten von Informations- und Kommunikationssystemen gibt es?
Die IuK-Systeme lassen sich in mengenorientierte operative Systeme (Administrations- und Dispositionssysteme), wertorientierte Abrechnungssysteme und Management-Informationssysteme einteilen.
Warum ist mobile Kommunikation mit dem Fahrer notwendig?
Mobile Kommunikation ermöglicht die direkte Erreichbarkeit der Fahrer während der Fahrt, wodurch Fahrzeuge bei Staus umgeleitet, Verzögerungen von zeitkritischen Lieferungen sofort erkannt und Touren bei Bedarf umdisponiert werden können.
Welche Telekommunikationssysteme können eingesetzt werden?
Es gibt verschiedene Telekommunikationssysteme, darunter Funkruf, Betriebsfunk, Bündelfunk, Mobilfunk (B-, C-, D1-, D2- und E1-Netz), Datenfunk und Satellitenkommunikation.
Was ist die Vision für den Güterverkehr der Zukunft?
Die Vision für den Güterverkehr der Zukunft beinhaltet den Einsatz von HUB-Systemen zur Optimierung der Auslastung der LKWs, die Nutzung von Barcodelesern zur Erkennung von Waren und die Gewährleistung einer 24-Stunden-Liefergarantie. Zudem wird der Einsatz der Satellitenkommunikation in Zukunft stärker an Bedeutung gewinnen.
Was sind Fahrerinformationssysteme?
Fahrerinformationssysteme dienen primär zur Erfassung von Tourdaten, wie Standzeiten, Geschwindigkeiten, Treibstoffverbrauch etc., aber auch um Verwaltungsdaten, wie Kundenadressen, Güterbeschreibungen etc.
Welche Vorteile haben die verschiedenen mobilen Telekommunikationssysteme?
Jedes System bietet spezifische Vorteile. Funkruf ist die einfachste Form der mobilen Kommunikation. Betriebsfunk ist kostengünstig. Bündelfunk bietet freie Leitungen und Abhörsicherheit. Mobilfunk bietet Erreichbarkeit fast überall und digitale Übertragung. Datenfunk ermöglicht volle mobile Datenkommunikation. Satellitenkommunikation ist in Flächenstaaten wie der USA von Bedeutung.
Was sind Ortungssysteme und wie funktionieren sie?
Ortungssysteme wie GPS (Global Positioning System) dienen zur Lokalisierung des Standortes von Fahrzeugen. Bei GPS können von Fahrzeugen aus jeweils vier der insgesamt 24 Satelliten angepeilt werden, um den Standort des Fahrzeugs bis auf 50m genau zu ermitteln.
- Quote paper
- Andreas Mies (Author), 1995, Informationsmanagement im Speditions- und Transportwesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95449