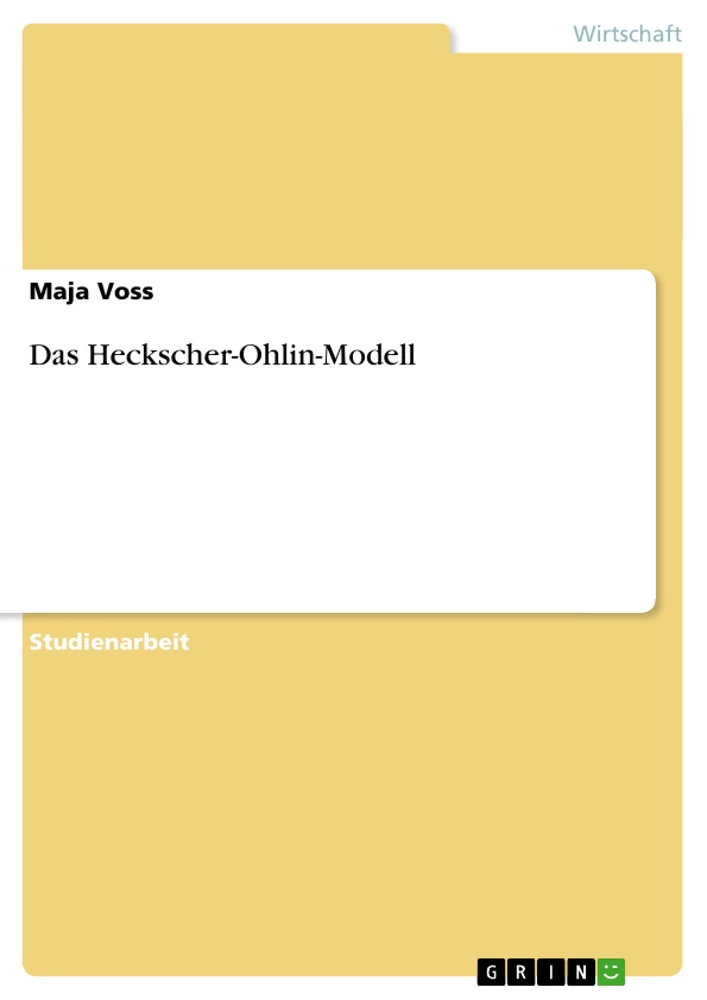Was treibt den Welthandel an und wie beeinflusst er die Verteilung von Wohlstand? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der internationalen Wirtschaftstheorie mit einer detaillierten Analyse des Heckscher-Ohlin-Modells. Dieses Buch seziert die grundlegenden Annahmen und Beziehungen, die diesem Modell zugrunde liegen, von der Faktorintensität bis zum Faktorreichtum, und enthüllt, wie unterschiedliche Ausstattungen mit Produktionsfaktoren die komparativen Kostenvorteile von Ländern bestimmen. Entdecken Sie die Kernstücke der Heckscher-Ohlin-Theorie: das Heckscher-Ohlin-Theorem selbst, das Faktorpreisausgleichstheorem, das Stolper-Samuelson-Theorem und das Rybczynski-Theorem, die zusammen ein umfassendes Bild der internationalen Handelsdynamik zeichnen. Doch die Reise endet hier nicht. Die Arbeit beleuchtet auch das berühmte Leontief-Paradoxon, das die empirische Gültigkeit des Modells in Frage stellt, und untersucht verschiedene Erweiterungen und Modifikationen, die entwickelt wurden, um seine Aussagekraft zu verbessern. Untersuchen Sie die Auswirkungen der Aufhebung von Annahmen wie konstanten Faktorintensitäten und identischen Nachfragestrukturen und analysieren Sie alternative Theorien, die den Einfluss technologischer Fortschritte und Produktlebenszyklen auf den Handel berücksichtigen. Abschließend würdigt das Buch die Pioniere der Wirtschaftswissenschaften – Eli Filip Heckscher, Bertil Gotthard Ohlin und Paul Anthony Samuelson – und bietet einen Einblick in ihre Beiträge zur Entwicklung dieser bahnbrechenden Theorie. Ob Sie Student, Akademiker oder einfach nur neugierig auf die Kräfte sind, die die Weltwirtschaft gestalten, dieses Buch bietet Ihnen das nötige Rüstzeug, um die komplexen Zusammenhänge des internationalen Handels zu verstehen. Erforschen Sie die Implikationen für Einkommensverteilung, Wirtschaftswachstum und die anhaltende Debatte über Freihandel versus Protektionismus. Das Buch vermittelt ein solides Verständnis der Grundlagen, erweitert den Blick auf empirische Befunde und alternative Ansätze und fördert eine kritische Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen des Heckscher-Ohlin-Modells. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die die treibenden Kräfte der Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Volkswirtschaften weltweit verstehen wollen.
I. Inhaltsverzeichnis
II. Abbildungsverzeichnis
III. Abkürzungsverzeichnis
IV. Einleitung
V. Grundlagen
1. Annahmen des Heckscher-Ohlin-Modells
2. Grundlegende Beziehungen
2.1. Faktorintensität
2.2. Faktorreichtum
2.3. Die relative Kostenkurve
VI. Die Heckscher-Ohlin-Theorie
1. Das Heckscher-Ohlin-Theorem
2. Das Faktorpreisausgleichstheorem
3. Das Stolper-Samuelson-Theorem
4. Das Rybczynski-Theorem
VII. Das Leontief-Paradoxon und andere empirischen Studien über den internationalen Güteraustausch
1. Das Leontief-Paradoxon
2. Erweiterung des Heckscher-Ohlin-Modells
2.1. Vernachlässigung einiger Annahmen und Auswirkungen
2.2. Andere Erweiterungen
VIII. Anhang
1. Die Ökonomen
1.1. Eli Filip Heckscher
1.2. Bertil Gotthard Ohlin
1.3. Paul Anthony Samuelson
2. Literaturangaben
II. Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Faktorintensität ohne Unkehrung
Abb. 2: Verhalten des K/L-Verhältnisses von zwei Faktoren und ohne Intensitätsumkehrung
Abb. 3: Faktorintensität mit Umkehrung
Abb. 4: Das (K/L)-Verhältnis bei zwei Faktoren und mit Faktorintensitätsumkehrung
Abb. 5: Relative Faktorpreise und relative Kosten
Abb. 6: Das Harrad-Johnson-Diagramm
Abb. 7: Die Produktionsmöglichkeitengrenze im Heckscher-Ohlin-Theorem
Abb. 8: Faktorpreisausgleich, das Verhältnis von Faktor- und Güterpreisen
Abb. 9: Die Produktionsmöglichkeitengrenze im Rybczynski-Theorem
Abb.10: Das Rybczynski-Theorem
Abb.11: Faktorintensitätsumkehrung
Abb.12: Nicht identische Nachfragestrukturen und Widerspruch zum Heckscher-Ohlin-Modell
III. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
IV. Einleitung
Einkommenswachstum und Außenhandelsliberalisierung waren in den letzten 30 Jahren mitverantwortlich für das starke Welthandelswachstum, verbunden mit dem Strukturwandel der Länder, der sich, gemessen am Weltexport, durch eine steigende Anzahl der Industrieländer und sinkende Anzahl der Entwicklungsländer auszeichnet. Bezogen auf diese Ausgangspunkte, Vorgänge und Effekte wurden Theorien entwickelt, um die Entstehung und den Strukturwandel der internationalen Handelsbeziehungen zu erklären, sowie den Effekt des Außenhandels auf die inländische Allokation der Produktivkräfte und die Einkommensverteilung aufzudecken[1].
David Ricardo und John Stuart Mill führten die komparativen Kostenunterschiede der klassischen Theorie des internationalen Handels auf die Produktivitätsunterschiede zurück. Dadurch lassen sich Preisvor- oder -nachteile für ein Gut bestimmen, insbesondere bei der Existenz eines einzigen Produktionsfaktors, wodurch das sogenannte Ricardo-Modell gekennzeichnet ist. Die Güter, die den Bedingungen dieses Modells genügen werden als Ricardo-Güter bezeichnet[2].
Eli Heckscher und Bertil Ohlin hingegen begründen die komparativen Kostenunterschiede in der neoklassischen Theorie des internationalen Handels durch die verschiedenen Ausstattungen mit Produktionsfaktoren. Diese Theorie wird das Heckscher-Ohlin-Modell genannt, welches im Laufe der Zeit von vielen Ökonomen verfeinert und ausgeweitet wurde. Die Güter, welche die Erfordernisse dieses Modells erfüllen, werden Heckscher-Ohlin-Güter genannt [2].
Volkswirtschaftliche Faktoren wie Boden, Arbeit, Kapital, natürliche Produktivkräfte und Fertigkeiten werden als die verfügbaren produktiven Ingredienzien definiert. Es ist offensichtlich, daß die Faktorverteilung der Länder nicht identisch ist. Der wohl deutlichste Unterschied offenbart sich im Vergleich zwischen Industrie- und Entwicklungs-ländern.
Unterschiedliche relative Güterpreise werden durch verschiedene Nachfrage-verhältnisse verursacht. Ist die Nachfrage nach einem Gut in einem Land geringer im Vergleich zu anderen, so wird der relative Preis dieses Gutes geringer als in den anderen Ländern sein. Eine geringe Güternachfrage impliziert also einen Preisvorteil.
Hat ein Land einen technischen Vorsprung gegenüber einem anderen Land mit gleichen Nachfrageverhältnissen und gleichen Ausstattungen der Faktoren, kann auch dieses Land einen Preisvorteil für ein Gut besitzen.
Zuletzt kann auch in einem Land, welches gleiche Produktivitäten und gleiche Nachfrage, jedoch unterschiedliche Faktorausstattungen gegenüber einem anderen Land aufweist, ein Preisvorteil zu erkennen sein.
Also bilden der Ansatz der unterschiedlichen Faktorausstattungen und somit der Zusammenhang des Außenhandels mit der nationalen Allokation der Produktivkräfte und der Einkommensverteilung die ausschlaggebenden Erklärungsgründe für das Heckscher-Ohlin-Modell. Inhaltlich werden komparative Kostenunterschiede[3] und die Ausmaße der internationalen Güterströme erklärt.
V. Grundlagen
Um die Allgemeingültigkeit des Faktorausstattungsansatzes zu erhalten, sind bestimmte Annahmen und Beziehungen für die Erläuterungen des Hecker-Ohlin-Modells notwendig, damit viele Produktionsfaktoren einbezogen werden können, denn je vielschichtiger und umfassender diese Untersuchung im folgenden wird, desto komplizierter und schwieriger werden die Schlußfolgerungen und der Bezug auf die Realität.
1. Annahmen des Heckscher-Ohlin-Modells
„Generell kann man sagen, daß in jeder Region reichliche Faktoren relativ billig und seltene Faktoren relativ teuer sind. Güter, die zu ihrer Produktion viel der ersteren benötigen und wenig von letzteren, werden im Austausch für Güter exportiert, die diese Faktoren in entgegengesetzter Proportion erfordern. Also werden reichlich angebotene Faktoren indirekt exportiert und knappe Faktoren importiert.“
B.Ohlin[4]
- Vereinfachung und Faktorausstattungen:
Das Modell wird auf zwei Länder, zwei Güter und zwei Produktionsfaktoren[5] (Arbeit und Kapital) beschränkt, um das Modell möglichst einfach und übersichtlich zu halten. Güter unterscheiden sich in ihrem unterschiedlichen Faktorbedarf, Länder in ihren verschiedenen Faktorausstattungen. Während also das eine Land einen Vorteil in seinem physischen Kapital, wie Maschinen und Fabriken hat, kann das andere Land besser mit Arbeitskräften ausgestattet sein. Diese zwei Faktoren seien in festen Mengen in jedem Land verfügbar und innerhalb eines Landes vollkommen mobil, jedoch international immobil [4] [5]. In Technologie und Nachfrage seien sich die Länder ähnlich. Diese Annahme begründet den Unterschied zwischen nationalem und internationalem Handel, sowie die Gewährleistung, daß die Schlußfolgerungen nur die Unterschiede der Faktorausstattungen widerspiegeln.
Weiterhin sei Vollbeschäftigung, sowie gleiche Güter- und Faktorqualität vorausgesetzt[6].
- Die Produktion:
Die gegebene Technologie ist verantwortlich für die Kombination von Arbeit und Kapital zur Produktion der beiden Güter, um einen bestimmten Output zu erzielen. (Das eine Gut sei arbeitsintensiver als das andere, kapitalintensivere Gut.) Die Technologie sei in beiden Ländern die gleiche, für beide Güter jedoch unterschiedlich. Hiermit wird gewährleistet, daß zwei verschiedene Güter produziert werden für die jeweils eine Produktionsfunktion existiert. Ihr Verlauf ist steigend und weist abnehmende Grenzerträge auf. Weiterhin seien für die Güterproduktion konstante Skalenerträge angenommen, das heißt bei einer Veränderung des Kapital- und Arbeitsinputs verändert sich der Output in gleichem Ausmaß.
- Die Nachfrage:
Identische Präferenzen seien für beide Länder vorausgesetzt, was als eine identische Nachfragestruktur verstanden werden kann, so daß bei jedem Einkommen und identischen Güterpreisen der Konsum in gleichen Proportionen erkennbar ist. Es sei weiterhin angenommen, daß unterschiedliche Einkommen keine Konsum-unterschiede hervorrufen. Das heißt der komparative Vorteil kann nicht durch die Nachfragestruktur beeinflußt werden. Zusätzlich seien nur die menschlichen Bedürfnisse berücksichtigt, das heißt die nationalen Bedürfnisse bleiben außen vor.
- weitere Annahmen:
Keines der Länder spezialisiert sich trotz des Anreizes des komparativen Vorteils bei internationalem Handel auf nur ein einziges Gut[7]. Die Produktionskosten seien gleich den langfristigen Preisen, welche für beide Länder identisch sind. Dies hat einen Ausgleich der Güterpreise zur Folge. Bei einem ausgewogenen Handel dürfen die Wirtschaftsausgaben die Einnahmen nicht übersteigen[8]. (Diese Restriktion wird sich jedoch durch die Definition des Faktorreichtums ändern).
Der Welthandel sei frei von Behinderungen wie Zölle und Austauschkontrollen[7], sowie frei von Transportkosten.
Güter- und Faktormärkte sind durch eine freie und vollständige Konkurrenz gekennzeichnet. Weiterhin sind die Wirtschaftssubjekte Preisnehmer und über sämtliche Geschehen am Markt informiert.
2. Grundlegende Beziehungen
Es wird zwischen Faktorreichtum und Faktorintensität unterschieden. Während ersteres die beiden Länder klassifiziert, betrifft letzteres die beiden Industrien.
2.1. Faktorintensität
Die beiden Industrien werden durch die Faktorintensität klassifiziert, sie läßt sich aber auf beide Länder anwenden, da sie dieselbe Technologie aufweisen. Bei gleichen Techniken ist die Faktorintensität relativ leicht bestimmbar, werden jedoch unterschiedliche Techniken für eine Kostenminimierung bei verschiedenen Faktorpreisverhältnissen angewendet, wird die Klassifizierung problematisch.
Eine zusätzliche Definition soll gewährleisten, daß die Einordnung für jedes Preisverhältnis gleich sein soll:
Gut B sei für alle Preisverhältnisse kapitalintensiver als Gut A, wenn das Kapital/Arbeits-Verhältnis, im folgenden K/L-Verhältnis genannt, größer für B als für A ist.
Wenn das K/L-Verhältnis für alle Preisverhältnisse für Gut B kleiner als für das Gut A ist, dann ist Gut B arbeitsintensiver als Gut A.[9] [10] Verändern sich die Faktoren nun aber, kann man die Industrien nicht mehr klassifizieren, weil für bestimmte Preisverhältnisse mal Gut A, mal Gut B das arbeits- bzw. kapitalintensivere Gut ist.
Die Restriktion, daß sich die Isoquanten der Produktionsfunktionen maximal einmal schneiden dürfen, schließt die Umkehrung der Faktorintensität aus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1:Faktorintensität ohne Umkehrung9
Die Funktionen zeigen eine gleiche Gestalt, denn laut der Annahme aus Kapitel 1 weist die Technologie konstante Skalenerträge auf. Dies bedeutet ein gleiches Input-verhältnis bei gegebenen Faktorpreisver-hältnissen. Diese Basis macht einen Vergleich der Funktionen nun möglich (vgl. Abb. 1).
Via Minimalkostenkombination[11] (MKK) wird der gegebene Ouput kostenminimal produziert, sie stellt also den optimalen Faktoreinsatz von Kapital und Arbeit dar.
Dies ist in Abb. 1 der Punkt E, ermittelt durch den Berührpunkt der Budgetgeraden mit der Kurve der Industrie A, sowie der Punkt E’, der für die Industrie B die MKK darstellt.
Das Inputverhältnis ist die gestrichelte Gerade vom Ursprung durch den optimalen Faktoreinsatzpunkt, wobei die Steigung für Industrie A größer als die von B ist. Das gleiche ist für ein anderes Optimum, in Abb. 1 durch F bzw. F’ dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2:Verhalten des K/L-Verhältnisses von zwei Faktoren und ohne Intensitätsumkehrung 12
Deshalb ist Industrie A für jedes Faktor-preisverhältnis die kapitalintensivere im Ver-gleich zu B.[12]
Folgende Abbildung zeigt eine mögliche Darstellung der Faktorintensität mit Umkehrung, in der sich die beiden Isoquanten mehrmals schneiden.
Abb.3: Faktorintensität mit Umkehrung12
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Inputverhältnis (K/L) ist für beide Industrien identisch, da die Steigung der Tangenten beider Isoquanten gleich ist. Dieses Inputverhältnis ist gegeben durch die Steigung von 0R. Der Strahl 0R geht vom Ursprung durch beide Minimal-kostenkombinationen / Optima der Industrien. Er zeigt den Umkehrpunkt, weil das (K/L)-Verhältnis von B oberhalb von 0R größer als bei A ist (Steigung der Tangenten an den Isoquanten von B ist größer) und unterhalb von 0R kleiner als bei A ist. Somit ist oberhalb des grünmarkierten 0R-Strahls das Gut B, unterhalb das Gut A kapitalintensiver.
Abb. 4: Das (K/L)-Verhältnis bei zwei Faktoren und mit Faktorintensitätsumkehrung12
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] In jedem Fall ist dieses Verhältnis eine monoton steigende Funktion des Faktor-preisverhältnisses[12]. Für den Bereich links von dem Schnittpunkt S, (also für kleinere PL/PK-Verhältnisse und bezüglich Abb. 3 der auf der rechten Seite von 0R befindliche Teil), ist B relativ zu A das kapitalintensivere Gut und rechts von S ist es umgekehrt. Also ist das Gut, dessen Verhältnis von Kapital- und Arbeitsausstattung oberhalb verläuft das kapitalintensivere. Für das Heckscher-Ohlin-Modell wird eine Umkehrung der Faktor-intensität im weiteren ausgeschlossen[13].
2.2. Faktorreichtum
Faktorreichtum klassifiziert die beiden Länder, indem er beschreibt, welches Land mit welchem Faktor reichlicher ausgestattet ist.
Dieser Faktorreichtum läßt sich mit der physikalischen und der ökonomischen Methode messen.
- Physikalisches Kriterium[14]:
Ein Land ist physikalisch reicher mit einem Faktor ausgestattet, wenn dieser physisch mengenmäßig öfter in diesem Land erhältlich ist. Es ist ein Überschuß, beispielsweise an Arbeit vorhanden, wenn das Verhältnis von Arbeitseinheiten zu Kapitaleinheiten in dem Land 1 größer als das von Land 2 ist. Dies bedeutet, daß es ein größeres Arbeits- als Kapitalpotential gibt und es gilt: K1/L1 > K2/L2 K= Ausstattung an Kapital
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Ökonomisches Kriterium:
Der ökonomische Reichtum an einem Faktor wird an dem Lohn-Zins-Verhältnis bei autarkischem Gleichgewicht gemessen. Im Land 1 besteht ein Überschuß an Arbeit, wenn im Autarkiegleichgewicht die Arbeit relativ billiger ist als das Kapital. Dies bedeutet, daß das Arbeitsentgelt in Land 1 geringer als in Land 2 ist und es gilt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das physikalische Kriterium stützt sich ausschließlich auf das Angebot und ist bei feststehender Faktorausstattung eindeutig. Das ökonomische Kriterium hingegen richtet sich nach Angebot und Nachfrage, da der Autarkiegleichgewichtszustand relevant ist und Gleichgewichtspreise auch durch die Nachfrage bestimmt werden.
Es kann auch zu einer entgegengesetzten Klassifizierung kommen, wenn die Nachfrage- die Angebotsrestriktion übersteigt.
2.3. Die relative Kostenkurve
Die Produktionskosten setzen sich aus Entgelt für Arbeit und Zinsen für Kapital zusammen. Steigen die Löhne bei Konstanz der Zinsen, erhöht der Lohnanstieg relativ zum Zins die Kosten des arbeitsintensiveren Gutes in Relation zu den Kosten des kapitalintensiveren Gutes. Da also die Kosten des arbeitsintensiveren Gutes proportional stärker steigen, wird die dazugehörige Industrie stärker beeinflußt, als die des anderen Gutes. Diese Beziehung wird durch die relative Kostenkurve verdeutlicht, welche durch drei Merkmale charakterisiert ist[15]:
1. Sie stellt eine technologische Beziehung dar, d.h. die Steigung hängt von den relativen Faktorintensitäten ab. Aufgrund der Annahme konstanter Skalenerträge wird die Abhängigkeit der Kosten vom Produktionsniveau vermieden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.5: Relative Faktorpreise und relative Kosten. Bei konstanten Skalenerträgen wird das Verhältnis der Löhne und Zinsen der Kosten des arbeitsintensiven Gutes und des kapitalintensiven Gutes bestimmen15.
2. Da beide Länder dieselbe Technologie einsetzen, läßt sich die Kurve auf beide Länder anwenden. Da die Faktoren international immobil sind und die Löhne beider Länder nicht konkurrieren, können sich Zinsen und Löhne über die Grenzen hinaus unterscheiden. Dies bedeutet, daß sich die Länder in unterschiedlichen Punkten befinden können, jedoch auf der selben Kurve liegen müssen.
3. Es gibt eine Beziehung zwischen den Kosten von Gut 1 und Gut 2 und den Preisen dieser Güter. Für ein langfristiges Gleichgewicht müssen die Preise gleich den Kosten sein. Übersteigen die Kosten die Preise, wird keine Produktion wegen fehlender Gewinnanreize stattfinden. Sind jedoch die Preise höher als die Kosten, werden die Gewinne einen Wettbewerb verursachen. Langfristig werden dann die Faktor- gleich den Güterpreisen sein, ebenso wie das Faktorpreisverhältnis zum Güterpreisverhältnis.
VI. Die Heckscher-Ohlin-Theorie
Die Heckscher-Ohlin-Theorie basiert auf vier fundamentalen Aussagen, die den komparativen Vorteil, die Faktorpreise, die Einkommensverteilung und das Wachstum erklären. Für diese Aussagen sei Land 1 das arbeitsreiche und Land 2 das kapitalreiche Land. Das als Gut A bezeichnete Gut sei das arbeitsintensiv, das als Gut B bezeichnete das kapitalintensiv produzierte Gut. Die beiden Faktoren seien weiterhin Arbeit und Kapital.
1. Das Heckscher-Ohlin-Theorem Dieses Theorem erklärt das Muster des komparativen Vorteils mit Hilfe der Faktorausstattungen:
Ein Land hat in dem Gut einen komparativen Vorteil, das für seine Produktion den im Land relativ reichlicher vorhandenen Faktor relativ intensiv verwendet.[15][16] [17]
Daß sich beide Länder im Autarkiezustand befinden sei vorausgesetzt. Internationaler Handel kann durch das unterschiedliche Preisverhältnis ohne Handel begründet sein. Dieses Preisverhältnis ist abhängig von der Produktionstechnik und der nationalen Nachfrage. Annahmegemäß sind Technik und Nachfragestruktur jedoch gleich, so daß komparative Vorteile nur durch unterschiedliche Faktorausstattungen entstehen.
Da beide Länder gleiche Präferenzen haben, wird der relative Arbeitsreichtum von Land 1 durch ein geringeres Autarkie-Lohn-Zins-Verhältnis (l/r) widergespiegelt, so daß gilt: (l/r)1 < (l/r)2 . Weiterhin gilt: kA < kB, d.h. Gut B wird relativ kapitalintensiver hergestellt als Gut A.
Abb. 6: Das Harrad-Johnson-Diagramm 18
Dargestellt wird diese Beziehung in Abb. 6. Da die Produktionsfunktionen gleich sind, werden auch die Funktionen der jeweiligen Sektoren gleich sein und zwar mit einem monoton steigenden Verlauf, weil bei steigendem Lohnzinsverhältnis der Faktor Arbeit durch Kapital substituiert wird. Dies bedeutet eine Kapitalintensitätssteigerung. Da Gut B kapitalintersiver hergestellt wird, liegt kB immer über kA. Der obere Quadrant stellt die Kapital-intensitätsanpassung der Sektoren an das Lohnzinsverhältnis dar. Der untere Quadrant zeigt die Faktor- und Güterpreisanpassung. Also wird bei steigendem Faktorpreisverhältnis auch das Güterpreisverhältnis steigen[18]. Die Strecke 0C stellt das Güterpreisverhältnis von Land 1 dar und ist kleiner als 0D, welche das Verhältnis von Land 2 widerspiegelt. Somit wird Land 1 die Produktion des Gutes A, Land 2 die des kapitalintensiven Gutes B bevorzugen. Die annahmegemäß gleichen Nachfrage- strukturen werden die Warenpreisverhältnisse international angleichen, wobei beide Güter in gleichen Proportionen in beiden Ländern konsumiert werden.
Also wird Land 1 das Gut A exportieren, während Gut B das Importgut ist. Das Gegenteil gilt für Land 2 bis das Güterverhältnis A/B gleich der Nachfrage in Land 1 und 2 ist.
Abb.7:Produktionsmöglichkeitengrenze 19
Zusätzliche Erläuterung
Die Produktionsmöglichkeitengrenze[19] eines Landes ist in Richtung des Gutes ausgeprägt, das relativ intensiv den relativ reichlichen Faktor des Landes einsetzt. Weil beide Länder identische Präferenzen haben, wird das Autarkiegleichgewicht in Land 2 (A) steiler sein als in Land 1 (B). Also werden ohne Handel die Güter B, in Einheiten des Gutes A ausgedrückt, in Land 2 relativ billiger sein als in Land 1.
Je größer die Unterschiede in den relativen Faktorausstattungen sind, desto größer werden die Unterschiede in ihren Produktionsmöglichkeitengrenzen sein. Wenn beide Länder identische Ausstattungen mit Kapital pro Arbeiter aufwiesen, würden ihre Grenzen eine identische Gestalt haben. Wenn andererseits die relative Kapitalausstattung von Land 2 die der von Land 1 hinreichend stark überstiege, würde jeder Punkt auf der Grenze des 2. Landes einen steileren Verlauf aufweisen als jeder Punkt auf der Kurve von Land 1. In diesem Fall wird man sich erinnern, daß der Freihandel erfordert, daß sich zumindest ein Land vollständig spezialisiert[20].
2. Das Faktorpreisausgleichstheorem
Faktorpreise sind Kosten für den Nutzen der Faktoren, wie Lohnkosten für einen Arbeiter pro Zeiteinheit und Zinsen für die Nutzung von Kapital[21].
Der freie internationale Handel zwischen den Ländern verursacht, daß sich die Faktorpreise zwischen den Ländern angleichen. Wenn beide Länder fortfahren beide Güter bei Freihandel zu produzieren, werden ihre Faktorpreise tatsächlich gleich sein.[20]
Da sich nun die relativen Faktorpreise gleichen, müssen die absoluten Faktorpreise ebenfalls die gleiche Höhe haben.
Sollte dies nicht der Fall sein, könnte ein Land gleichmäßig höhere Faktorpreise als das andere ansetzen. Dann würden die Kosten nicht mehr den Preisen entsprechen.
Sollte sich, entgegen der Annahme, ein Land spezialisieren, ist ein Faktorpreisausgleich nicht unbedingt zwingend, da die angefallenen Kosten nicht mit den internationalen Preisen übereinstimmen müssen. Der Handel wird die Faktorpreise nicht vollständig angleichen, sie werden allerdings näher beieinander liegen, als es in der Autarkiesituations der Fall ist.
Da die Güterpreise sich angleichen und den Faktorpreisen entsprechen, gleichen sich die reale Lohnrate und die Renditerate aus, obwohl eine Immobilität der Faktoren besteht. Externe Faktormobiltät wird somit durch den freien Handel ersetzt. Bezeichnet wird diese Wirkung als „Der Effekt des freien Güterhandels“. Somit wird durch das Heckscher-Ohlin-Modell ein indirekter Faktortausch angedeutet: Das arbeitsintensive Gut wird für das kapitalintensive exportiert. Somit exportiert das arbeitsreiche Land 1 indirekt einige Arbeitseinheiten um im Gegenzug einige Kapitaleinheiten zu erhalten. Dies hat eine Änderung der realen Lohnrate zur Folge. Sie steigt im arbeitsreichen und sinkt im kapitalreichen Land. Die reale Renditerate reagiert umgekehrt.
Abb. 8: Faktorpreisausgleich, das Verhältnis von Faktor- und Güterpreisen
Die Produktionsfunktion, welche annahme-gemäß für beide Länder gleich ist, bestimmt die Beziehung zwischen den relativen Güterpreisen und dem Lohn-Zins-Verhältnis. Wenn das Lohn-Zins-Verhältnis sinkt, d.h. wenn der Faktor Arbeit zum Faktor Kapital relativ billiger wird, dann wird das arbeitsintensive Gut A billiger relativ zum kapitalintensiven Gut B. Die Lohnrate schlägt die gleiche Richtung wie der relative Preis von Gut A ein. Es bleiben jetzt nur noch die verschiedenen Faktorausstattungen als Erklärung des Handels. Für die graphische Darstellung wird der untere Quadrant von Abb. 6 verwandt. Im Land 1 sind die Arbeit-Kapital-Verhältnisse höher als in Land 2.
Dadurch hat es komparative Vorteile im arbeitsintensiven Gut A und wird es im freien Handel gegen das kapitalintensive Gut B mit Land 2 austauschen. Der relative Preis von Gut A wird dann in Land 1 steigen, in dem anderen Land sinken, bis international der gleiche Preis erreicht ist. Annahmegemäß ist für jedes Güterpreisverhältnis das zugehörige Lohn-Zins-Verhältnis in den Ländern gleich, was allgemein ebenfalls ein Angleichen der realen Werte mit sich führt.
Die Produktivität eines jeden Faktors bestimmt die realen Faktorrenditen und somit das Arbeit-Kapital-Verhältnis für jede Industrie, wenn das Lohn-Zins-Verhältnis gegeben ist. Da die Produktionsfunktionen und Grenzproduktivität beider Faktoren identisch sind, findet ein Ausgleich der Lohn-Zins-Verhältnisse und der realen Faktorpreise statt.
Also werden sich bei freiem Handel die Faktorentgelte angleichen. Dann erfolgt eine Vorratsverteilung. Dies würde einen totalen Ausgleich der Faktorpreise bedeuten. In Wirklichkeit sind die Verdienste in den Ländern allerdings unterschiedlich.
Das Faktorpreisausgleichstheorem[22] zeigt, daß Handel auf Grund unterschiedlicher Faktorausstattungen stattfindet. Er ersetzt sozusagen die Mobilität der Faktoren, denn der Anreiz zur Faktorwanderung verliert seinen Reiz bei gleichen Faktorpreisen. Somit ist der Freihandel ein vollständiges Substitut für die internationale Faktormobilität, und wenn eine Spezialisierung[23] einen kompletten Faktorpreisausgleich verhindert, ist der Güterhandel nur ein partielles Substitut für die Faktormobilität.
3. Das Stolper-Samuelson-Theorem
Dieses Theorem verknüpft den internationalen Handel mit der inländischen Einkommensverteilung.[22] Ein Anstieg des relativen Preises des arbeitsintensiven Gutes erhöht den Lohnsatz relativ zu beiden Güterpreisen und senkt den Zins relativ zu beiden Güterpreisen.[24] Die Arbeitseinkommen steigen relativ zu den Kapitaleinkommen, so daß Arbeiter, unabhängig von der Einkommensverwendung, besser gestellt werden. Kapitaleinkommenbezieher werden schlechter gestellt, da die Renditen relativ zu den Güterpreisen sinken.
Die nationale Wirkung der Einkommensverteilung durch den Handel läßt sich in Verbindung mit dem Heckscher-Ohlin-Theorem[25] erklären. Ein Land hat in dem Gut einen komparativen Vorteil, welches seinen relativ reichlich vorhandenen Faktor intensiv einsetzt. Der Freihandel wird den relativen Preis dieses Gutes erhöhen und nach dem Stolper-Samuelson-Theorem wird er die Realeinkommen dieses relativ reichlich vorhandenen Faktors steigen, die des knappen Faktors senken. Insgesamt wird das Land aus dem Handel profitieren, denn der Gewinn aus dem reichlich vorhandenen Faktor übersteigt den Verlust des knappen Faktors.
Durch politischen Einfluß könnte eine Kompensation des knappen Faktors durch den reichlichen Faktor sichergestellt werden. Der Gewinn der volkswirtschaftlich besser Gestellten Klasse könnte den Verlust tragen und wäre immer noch besser gestellt.
Wenn PA/PB steigt, dann steigt auch die Lohn-Zins-Relation, wodurch die sektorale Kapitalintensität größer wird, da die Industrie versucht die Substitution der allmählich teurer werdenden Arbeit durch den relativ billigeren Faktor Kapital. Das hat eine Senkung des Realzinses und eine Erhöhung des Reallohns zur Folge. Trotz gleicher Kapitalausstattung produzieren beide Industrien nun kapitalintensiver, obwohl dies paradox erscheint. Wenn in der kapitalreichen Industrie das ertragsgeringste Kapital wegfällt und in der arbeitsreichen Industrie als ertragsreichstes hinzukommt, kann das Kapitalverhältnis jedoch in beiden Industrien steigen. Insgesamt bleibt das Kapitalverhältnis aber gleich.
4. Das Rybczynski-Theorem
Der Zusammenhang des Außenhandels mit dem Wirtschaftswachstum wird durch das Rybczynski-Theorem beschrieben. Wachstum wird in einer Änderung der Ausstattungen eines Landes mit Produktionsfaktoren gezeigt. Voraussetzung ist hier, wie bei dem Stolper-Samuelson-Theorem, daß beide Güter produziert werden, d.h. keines der Länder spezialisiert sich auf nur ein Gut.
Bei Einsatz der gesamten Faktorausstattung und gegebenen Produktionskoeffizienten führt eine Erweiterung der Ausstattung eines Faktors zu einer Erhöhung des Outputs des Gutes, welches diesen erweiterten Faktor intensiv nutzt und zu einem Outputrückgang des anderen Gutes. Die Güter-, sowie die Faktorpreise seien weiterhin konstant. Dies schließt ein unverändertes Faktoreinsatzverhältnis für die MKK, d.h. für die Produktion zu minimalen Kosten, ein. Nun kann die Produktionsmöglichkeitengrenze abgeleitet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9: Die Produktionsmöglichkeitengrenze 26
Die höchstmögliche Produktionsmenge wird durch das verfügbare Arbeits- und Kapitalbudget bestimmt. Dazu müssen beide Budgetgeraden einbezogen werden, da beide Faktoren nur begrenzt zur Verfügung stehen. In der Abbildung 9 sind beide Güter auf den Achsen abgetragen und die Budget-geraden (BG) der Faktoren eingezeichnet. Oberhalb der Arbeits-BG bzw. Kapital-BG kann wegen mangelnder Arbeitskräfte bzw. Kapitalquellen nicht produziert werden. Somit ist die Produktionsmöglichkeitengrenze auf bzw. unterhalb von ABC.[26] Im Punkt B herrscht Vollbeschäftigung, da auf AB Kapital nicht vollständig eingesetzt wird und auf BC Arbeitslosigkeit herrscht. Da Gut B im Vergleich zu Gut A das kapitalintensivere Gut ist, verläuft die Kapital-BG steiler als die Arbeits-BG.
Ausgehend von Punkt B in Richtung zu Punkt F wird der Output von Gut B erhöht, wobei das Kapital weiter komplett eingesetzt wird, aber die Arbeit geht zurück. Das bedeutet die Entlassung von Arbeitern. Der Output von Gut A geht hierbei zurück. Da Gut B das kapitalintensivere Gut ist, benötigt es mehr Kapital- pro Arbeitseinheiten als Gut A.
Abb. 10: Das Rybczynski-Theorem 27
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Rybczynski-Theorem erklärt die Wirkungen bei Variation der Faktoren. Abbildung 10 zeigt, daß sich bei steigendem Arbeitsangebot die Outputmengen bei Vollbeschäftigung von beiden Gütern ändern. Grundlage bildet Abb. 9 (Seite 11). Aufgrund erhöhtem Arbeits-angebot verschiebt sich die Arbeits-BG parallel nach oben, wodurch sich die neue Produktionsmöglichkeitengrenze A’B’C, sowie der neue Output B’ ergibt. Der Output des kapitalintensiven Gutes B ist gesunken, damit das notwendige Kapital bereitgestellt werden kann. Die Ausbringungsmenge des arbeits-intensiven Gutes A ist hingegen gestiegen, um die zusätzliche Arbeit ganz in Anspruch nehmen zu können. Durch das erhöhte Arbeitsangebot weitet sich die Produktions-möglichkeitengrenze in Richtung des arbeits-intensiven Gutes A aus. Dieser Vorgang wird in dem Rybczynski-Theorem beschrieben. [27] [28]
VII. Das Leontief-Paradoxon und andere empirischen Studien über den internationalen Güteraustausch
1. Das Leontief-Paradoxon
Die empirische Relevanz des Heckscher-Ohlin-Theorems war Gegenstand vieler Studien, angefangen 1953 mit der des Nobelpreisträgers Wassily Leontief und zwar der Anwendung seiner Input-Output-Analyse auf die Input-Output-Tabelle der USA.[29] Ob die Faktorausstattungen überhaupt wichtige Determinanten des komparativen Vorteils sind und ob das Heckscher-Ohlin-Samuelson-Modell eine adäquate Beschreibung der Realität liefert waren Bestandteile seiner Untersuchungen.[30]
Leontief wollte anhand diese Input-Output-Tabelle der USA die Kreislaufströme trennen, sowie die tatsächlich verwandte Arbeits- und Kapitalintensität für die Produktion der amerikanischen Ex- und Importe messen. Nach der herrschenden Meinung werden in den USA relativ hohe Löhne gezahlt und da es über relativ viel Kapital verfügt, ist die USA ein kapitalreiches Land. Nach dem Heckscher-Ohlin-Modell sollte das kapitalintensive Gut exportiert und das arbeitsintensive Gut importiert werden.
Leontief berechnete dazu die Kapitalintensität, welche in einer repräsentativen Gesamtheit der amerikanischen Exporte verkörpert war, sowie den Wert, der eine ebenfalls repräsentative Gesamtheit konkurrierender Importgüter beinhaltete. Dabei ignorierte er die Importgüter, welche eigentlich nicht in den USA produziert wurden, wie Kaffee, Tee und Jute. Er vernachlässigte ebenfalls Sektoren, wie den Dienstleistungssektor, die den Außenhandel gar nicht betrafen.
Ergebnis seiner Untersuchung war, daß das kapitalreiche Land USA arbeitsintensive Güter exportierte und kapitalintensive importierte, also entgegen der Aussagen des Heckscher-Ohlin-Modells handelt. Aufgrund dieses Ergebnisses findet sich die Leontief’sche Untersuchung in der Literatur unter dem Namen „Das Leontief-Paradoxon“.[31]
Es bestehen jedoch Zweifel an der Verläßlichkeit des Ergebnisses. Leontief selbst führte andere Hypothesen ein als die des Heckscher-Ohlin-Modells, jedoch kann eine zweifellose Repräsentativität nicht hundertprozentig bewiesen werden. Andererseits wurden weitere Erhebungen bezüglich des amerikanischen Marktes gemacht, die das Leontief-Paradoxon als ein dauerndes Merkmal in den USA zeigen. Dieses Ergebnis war auch bei einigen anderen Ländern festzustellen, jedoch handeln viele weitere nach den Annahmen des Heckscher-Ohlin-Modells.
2. Erweiterung des Heckscher-Ohlin-Modells
2.1. Vernachlässigung einiger Annahmen und Auswirkungen
Die Vernachlässigung einiger Annahmen hat verschiedene Auswirkungen, die im folgenden aufgeführt werden.
Wird die Bedingung konstanter Verhältnisse der Faktorintensität ignoriert, kann eine konstant höhere Intensität eines Gutes für alle Faktorpreisverhältnisse nicht mehr garantiert werden. Diese Situation ist die Faktorintensitätsumkehrung. Die Steigung der Funktion (PB/PA) = f(l/r) hängt von kB < > kA ab. Ist kB > kA, dann wird die Steigung der Funktion negativ, für kB < kA positiv sein und für kB = kA ist sie gleich Null.
Abbildung 11 zeigt das kapitalreiche Land 2 und das arbeitsreiche Land 1, weil (l/r)2 > (l/r)1.
Gut B ist also für das Land 1 relativ kapitalintensiv und somit relativ billiger im Vergleich zu Land 2, graphisch gegeben durch (PB/PA)2 > (PB/PA)1.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.11: Faktorintensitätsumkehrung 32
Land 1 wird nun das kapitalintensive Gut B exportieren. Land 1 ist jedoch das arbeitsreiche Land, so daß sich das Heckscher-Ohlin-Theorem nicht anwenden läßt. [32] Vor dem Handel wird jedes Land genau das andere Gut exportieren, als es das Heckscher-Ohlin-Theorem voraussagt. Für den Fall der Faktorintensitätsumkehrung ist es also nicht gültig. Selbiges gilt für das Faktorpreisaus-gleichstheorem. [33] Ein Ausgleich findet in dieser Situation nicht mehr statt. Die relativen Faktorpreise verlaufen in beiden Ländern in die gleiche Richtung: von 0(l/r)2 nach 0X und von 0(l/r)1 nach 0Y. Eine allgemein gültige Tendenz zum Ausgleich kann nicht mehr vorhergesagt werden.
Es sei nun angenommen, daß sich die Nachfragestrukturen unterscheiden. Der Export des Gutes mit dem weniger verfügbaren Faktor ist möglich. Das Heckscher-Ohlin-Modell schließt diese Variante aus.
Abb.12: Nicht identische Nachfragestrukturen und Widerspruch zum Heckscher-Ohlin-Modell 34
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 12 zeigt die Gleichgewichte E1 (Land 1) und E2 (Land 2) vor einem freien Handel.[34] Die relativen Güterpreise sind durch die Steigungen gegeben. Sie ergeben sich nun durch die Steigung von RR. E’1 gibt den Punkt der Produktion von Land 1 an. Land 1 konsumiert aber bei E1. Deshalb wird es E1A’H1A Einheiten von Gut A importieren und E1B’H1B Einheiten von Gut B exportieren. Diese zum Heckscher-Ohlin-Modell kontroverse Darstellung zeigt, daß Land 1 das Gut exportiert, für dessen Produktion über-wiegend der weniger reichlich vorhan-dene Faktor verwendet wird. Land 2 hingegen importiert das Gut, welches hauptsächlich mit dem reichlich vorhan-denen Faktor produziert wird. Gleich-zeitig kann gesehen werden, daß Land 2 im Punkt E’2 produziert, in E’’2 konsumiert. Es importiert E’2BH2B Einheiten von Gut B und exportiert E’2AH2A Einheiten von Gut A, denn für das arbeitsreiche Land 2 ist B das arbeitsintensive und A das kapital-intensive Gut. Somit ist dieses Ergebnis mit der Behauptung des Heckscher-Ohlin-Modells widersprüchlich.
Diese Umkehrung entzieht dem Heckscher-Ohlin-Modell seine Allgemeingültigkeit. Es ist jedoch möglich, daß das Modell selbst bei unterschiedlichen Nachfragestrukturen gilt. Die Annahme gleicher Nachfrage ist somit hinreichend, aber nicht notwendig für die Gültigkeit des Heckscher-Ohlin-Theorem. Ein möglicher Widerspruch zum H-O-Modell wirkt jedoch nicht entkräftigend auf das Faktorpreisausgleichstheorem. [34]
Die Vernachlässigungen der Annahmen der Faktorintensität ohne Umkehrung und identischer Nachfragestrukturen werden oftmals als mögliche Erklärungsansätze des Leontief-Paradoxons gesehen. Im allgemeinen bleiben die Theoreme von Stolper-Samuelson und Rybczynski bei den Vernachlässigungen und Erweiterungen uneingeschränkt gültig.
2.2. Andere Erweiterungen und weitere Theorien
Die innerhalb der in Kapitel V Punkt 1 formulierten Annahmen können erweitert und somit der Realität etwas näher gebracht werden.
Zuerst kann die Beschränkung auf zwei Güter auf eine größere Anzahl ausgedehnt werden, so daß sich eine Rangordnung des Wettbewerbsvorteils ergibt. Einen solchen Vorteil können sich Länder mit einem relativ starken Preisvorteil sichern und eine dominierende Position im Wettbewerb manifestieren. Ist kein Preisvorteil zu verzeichnen, kann nicht eindeutig bestimmt werden, ob das Gut ex- oder importiert wird.
Wird die Beschränkungsrestriktion auf zwei Länder aufgehoben, ist der Handel multilateral. Es kann weiterhin bestimmt werden, welches Land für welches Gut einen komparativen Preisvorteil aufweist und auf welches Gut es sich spezialisieren wird.
Der in Kapitel V Punkt 2.2. diskutierte Faktorreichtum kann begrifflich noch weiter ausgedehnt werden, so daß sich unterschiedliche Faktorausstattungen auf viele Produkte beziehen können. Die Faktoren Kapital und Arbeit können beispielsweise durch natürliche Produktivkräfte und Fertigkeiten, Humankapital, Arbeitsfähigkeiten[35], soziale und politische Stabilität oder technisches Wissen ergänzt werden. Der freie Güterhandel wird weiterhin durch das Heckscher-Ohlin-Modell erklärt. Dies wird auch durch das Rybczynski-Theorem[36] bestätigt.
Im Allgemeinen bleibt die Gültigkeit der Erklärungen des Heckscher-Ohlin-Modells bei den Erweiterungen der Annahmen bestehen. Der Handel und das H-O-Modell werden innerhalb der Ergänzungen immer noch durch die relative Faktorausstattung erklärt. [37]
Weiterhin läßt sich ein Unterschied zwischen den Gütertypen vermerken. Das Ricardo-Theorem findet Anwendung, wenn die sogenannten Ricardo-Güter, d.h. natürliche Rohstoffe, vorliegen. Handelt es sich jedoch um Industrieprodukte (Heckscher-Ohlin-Güter), gilt vornehmlich das Heckscher-Ohlin-Modell und können insbesondere durch diese Erweiterungen des Modells erklärt werden.
Güter mit einem starken technologischen Fortschritt werden Produktlebenszyklus-Güter genannt und mit ihm soll der Einfluß des Fortschritts auf den Handel bestimmt werden. Diese Theorie basiert jedoch nicht mehr auf dem ursprünglichen Ansatz unterschiedlicher Faktorausstattungen, sondern auf einer zeitlichen Betrachtung. Anfänglich war die Kommunikation zwischen Käufer und Hersteller für inländische Produktion relevant. Dann gewinnen Produktionskosten an Wichtigkeit, da der internationale Markt hinzugenommen wird. Dies hat die Vernachlässigung eigener Exporte zur Folge, so daß schließlich das betroffene Gut importiert werden muß. In der Zwischenzeit hat ein anderes, neu entwickeltes Gut Priorität und der Zyklus beginnt von vorne. Eine Anwendung des Heckscher-Ohlin-Modells ist nur auf wenige Fälle möglich, für einen aggregierten empirischen Test jedoch nicht verwendbar.
VIII. Anhang
1. Die Ökonomen
1.1. Eli Filip Heckscher
[38] Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der schwedische Nationalökonom Eli Filip Heckscher war von 1909-1929 Professor für Wirtschaftsstatistik an der Handelshochschule von Stockholm. 1929 wurde er Professor am Stockholmer Institut für Wirtschaftsgeschichte.
Er war ein wirtschaftshistorisch arbeitender Ökonom von erstaunlicher Schaffenskraft. Darunter widmete er einen Großteil seiner Arbeit der monumentalen Studie der schwedischen Wirtschaftsgeschichte. Er verfaßte eine große Anzahl von Artikeln, mit denen er viele Bereiche der wirtschaftlichen Geschichte bearbeitete. Sein einziger wahrer Beitrag zur Wirtschaftstheorie waren die von ihm entwickelten Punkte der Faktorausstattungstheorie des internationalen Handels. 1919 publizierte er in Schweden einen kurzen Artikel, der 30 Jahre später ins Englische übersetzt wurde. Ausgearbeitet von Ohlin wurden seine Punkte, bekannt als das Heckscher-Ohlin-Theorem, ein wichtiger außenwirtschaftlicher Erklärungsansatz.
Während seines Lebens verfaßte Heckscher 34 Bücher. Seine zwei bekanntesten Werke sind wohl seine Arbeit über die schwedischen Bevölkerungsbewegungen und sein Buch „Merkantilismen“, erschienen 1931 in zwei Bänden. Es liefert eine Studie wissenschaftlicher Doktrinen, die den klassischen Gedankengängen vorausgingen und die Macht der Nationalstaaten als politisches Ziel sahen.
1.2. Bertil Gotthard Ohlin
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bertil G. Ohlin studierte nach seinem Schulbesuch an der Handelshochschule in Stockholm, an der er auch seinen Doktortitel erwarb.
Seine Tätigkeit begann er 1919 in der Zoll- und Vertragskommission, ab 1920 arbeitete er im Wirtschaftsrat mit und war ab 1924 an der Universität Stockholm für die Vorbereitung von Konferenzen zuständig. Seinen Ruf als Nationalökonom erhielt er 1924 an der Universität Kopenhagen. An die Handelshochschule in Stockholm kehrte er 1924 als Professor zurück, an der er 1965 emeritiert worden ist.
Auch an den Hochschulen des Auslandes, z.B. an der Sorbonne in Paris (34), in Camebridge (36) und an der Columbia University in New York und Oxford (47), hat Ohlin als Gastprofessor gelesen. Ohlin hat immer versucht, seine wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse in praktische Politik umzusetzen. Als eingagierter Verteidiger der individuellen Freiheit begann für ihn eine erfolgreiche politische Karriere in der bürgerlichen, liberalen Volkspartei, was seine wissenschaftlichen Arbeiten stark begrenzte. Von 1944-1967 war er ununterbrochen Präsident der liberalen Volkspartei, die unter seiner Führung bis Ende der 50er Jahre zur stärksten Opposition wurde. Bis zu seinem endgültigen Ausscheiden aus der aktiven Politik, war Ohlin von 1938-1970 Mitglied im schwedischen Reichstag. 1944-1945 war er kurze Zeit Handelsminister, von 1949-1960 und 1969-1970 war Ohlin Mitglied des Europarates, sowie 1965-1970 Mitglied des Nordischen Rates.
Von 1969-1974 war Ohlin Präsident im Kommitee des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften. Er war Mitglied der schwedischen Akademie der Wissenschaften und ab 1977 auch Mitglied der Academie des sciences et politiques in Paris. Als späte Krönung wurde ihm zusammen mit dem britischen Nationalökonom James Meade der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften des Jahres 1977 verliehen. Ohlin wurde als „Urheber der modernen Handelstheorie“ gewürdigt. Er habe u.a. aufgezeigt, daß der Austausch von Produkten auf weltweiter Ebene von zahlreichen Faktoren in den einzelnen Ländern im Bereich der Produktion bestimmt werde. Hierzu zählt auch das von Ohlin 1933, nach Ansatzpunktion von Heckscher (1919), weiterentwickelte und von P.A. Samuelson (1948) formalisierte „Heckscher-Ohlin-Theorem“, daß die Richtung und die Stärke der internationalen Güterströme aus den Unterschieden der jeweiligen Produktionsstrukturen erklärt.
Sein wissenschaftliches Hauptwerk ist das Buch „Interregional and International Trade“ (1933). In einigen makroökonomischen Arbeiten aus den Jahren 1933 und 1934 hat er Keynes antizipiert. Da sie in schwedisch verfaßt waren, wurden sie erst nach ihrer Übersetzung von Keynesianern ungläubig zur Kenntnis genommen. Obwohl viele seiner Werke nicht ins Englische übersetzt wurden, entwickelte er doch wesentliche Grundgedanken zur Geldtheorie, Beschäftigung und ökonomische Schwankungen.
1.3. Paul Anthony Samuelson
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach der Highschool erwarb Samuelson 1935 an der renommierten University of Chicago den B.A.-Grad (Bachelor of Arts). Anschließend legte er an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Harvard-University in Cambridge 1936 sein Masterexamen (M.A.) ab und promovierte 1941 zum Ph.D.. Der David A. Wells-Preis der Universität wurde ihm für seine Dissertation verliehen. Mit der Ernennung zum „Junior Fellow“ (1936) wurde ihm eine der höchsten Ehrungen für einen Studenten an Harvard zuteil.
1940 wurde Samuelson gerade einmal 25 Jahre alt, Assistent Professor für Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge/Massachusetts. 1947 erhielt er eine Professur. Von 1966-1985 war er Institutsprofessor, seit 1986 ist er emeritiert. Neben seiner volkswirtschaftlichen Lehrtätigkeit kam eine rege Beratertätigkeit. Nach dem Krieg war er u.a. Berater der Rand Corporation (1949-1975), Mitglied des Forschungsbeirates für wirtschaftliche Entwicklung und Wirtschaftsberater der NATO, sowie der Präsidenten Eisenhower und Kennedy. Seit 1961 war er ständiger Berater des US-Schatzamtes, eine Funktion die er schon von 1945-1952 ausgeübt hatte.
Stark beeinflußt von seinem akademischen Lehrer Hausen vertritt er eine Keynes orientierte Wirtschaftspolitik. Über seine Ausbildung sagte er: Ich bekam unmittelbar alles mit, was für einen Ökonomen vonnöten war: die Zeit vor Keynes, während Keynes und nach Keynes. Und als ich anschließend nach Harvard wechselte, hatte ich das unwahrscheinliche Glück, gleichzeitig bei den Professoren Alwin Hausen, dem amerikanischen Keynes, Joseph Schumpeter, dem Begründer der Theorie von der Unternehmerdynamik, und Wassily Leontief, dem Vater der mathematisch statistischen Ökonomie, studieren zu dürfen.“
Seine bis heute bekannte Dissertation „Foundations of Economic Analyses“ gilt als bahnbrechende Arbeit. Samuelson beschreibt darin in mathematischer Form die grundlegenden „Gesetze“ der Marktwirtschaft. Die Verbindung von dynamischer Theorie mit den Lehrsätzen der statischen Theorie gilt als eine der großen Verdienste Samuelsons. Sein Lehrbuch „Economics: An Introductionary Analyses“ (1948) gilt als das erfolgreichste weltweit. Sein Werk „Linear Programming and Economic Analysis“ (1958, zusammen mit Dorfman und Solow) verband die volkswirtschaftlichen Theorien mit dem für rein praktische Zwecke entwickelten „Operation Research“. Entscheidende Fortschritte in der Theorie des Außenhandels sind Samuelson ferner zu verdanken. Hierzu zählt das von ihm formalisierte „Heckscher-Ohlin-Theorem“. „The Collected Papers of Paul A. Samuelson“ (5 Bände, 1965-1987) ist eine Sammlung aller seiner verstreut erschienenen Einzelbeiträge. Höchste Ehren wurden Samuelson zuteil, als ihm 1970 der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen wurde. 1971 erhielt er den Albert-Einstein-Gedenkpreis. Darüberhinaus erhielt er eine Vielzahl von Ehrendoktorwürden und bekleidet zahlreiche Mitgliedschaften und Ehrenämter. Von 1965-1968 war er Präsident der International Economic Association, deren Ehrenpräsident auf Lebenszeit er seither ist.
2. Literaturangaben
W.J. Ethier: Moderne Außenwirtschaftstheorie, 1991, S. 137-208
G. Gandolfo: International Economics I, 1987, S. 76-87
J.N. Bhagwati & T.N. Srinivasan: Lectures on International Trade, 1983, S. 50-74
M. Chacholides: International Economics, 1980, S. 63-83
Vahlens Kompendium
Gabler Wirtschaftslexikon, 12. Auflage, 1997, Band 2, S. 1734-1770 Band 3, S. 2833, S. 3314 ff
Horst Siebert: Außenwirtschaft, 6. Auflage, 1994, S. 28-95
P.A. Samuelson: International Trade and the Equalisation of Factor Prices / Economic Journal 58, 1948, S. 181-197
T.N. Rybczynski: Factor Endowment and Relative Commodity Prices, Economica, 1955, S. 336-341
Eli F. Heckscher & Bertil Ohlin: Heckscher Ohlin Trade Theory, 1991
[...]
[1] vgl. W.J.Ethier: Moderne Außenwirtschaftstheorie, 1991, S.137-139
[2] vgl. Vahlens Kompendium
[3] Gabler Wirtschaftslexikon, 12. Auflage
[4] vgl. W.J.Ethier: Moderne Außenwirtschaftstheorie, 1991, S.137, S.140/141
[5] vgl. M.Chacholiades: Internatioinal Economics, 1990, S. 63-65
[6] vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 12. Auflage, S. 1734
[7] vgl. M.Chacholiades: International Economics, 1990, S. 63-65
[8] vgl. J.N.Bhagwati & T.N. Srinivasan: Lectures on International Trade, 1983, S. 50
[9] vgl. D.Gandolfo: International Economics I, 1987, S. 78 Fig. 4.1 a) und J.N.Bhagwati & T.N. Srinivasan S.56-59
[10] vgl. W.J.Ethier: Moderne Außenwirtschaftstheorie, 1991, S. 142-143
[11] Die Minimalkostenkombination (l*;k*) wird über den Lagrange-Ansatz ermittelt.
[12] vgl. G.Gandolfo: International Economics, S. 78 und 79 Fig, 4.1. a, b und Fig. 4.2. a, b, sowie vgl. J.N. Bhagwti & T.N. Srinivasan: Lectures on International Trade, S. 57 Figure 5.5, 5.6 und S.60 Figure 5.9, 5.10
[13] Diese Restriktion wird später in Kapitel V, Teil 2.1. vernachlässigt
[14] vgl. J.N.Bhagwati & T.N. Srinivasan: Lectures on International Trade, 1983, S. 56
[15] vgl. W.J.Ethier: Moderne Außenwirtschaftstheorie, 1991, S. 144-145
[16] vgl. M.Chacholiades: International Economics S. 70
[17] Diese Aussage kann durch die relative Kostenkurve bewiesen werden.
[18] vgl. Horst Siebert, Außenwirtschaft, S. 58 Bild 4.15 a
[19] vgl. W.J.Ethier: Moderne Außenwirtschaftstheorie, S. 148, 149
[20] vgl. W.J.Ethier: Moderne Außenwirtschaftstheorie, S. 148,149
[21] vgl. M. Chacholiades: International Economics, 1990, S. 79
[22] vgl. W.J.Ethier: Moderne Außenwirtschaftstheorie, S. 150,152
[23] Um das Faktorpreisausgleichstheorem beweisen zu können, wird angenommen, daß freier Handel eine vollständige Spezialisierung nicht zustande bringt, damit jedes Land weiterhin beide Güter produziert. (vgl.Gandolfo: Enternational Economics, S. 1.85)
[24] vgl. Samuelson, P.A.: International Trade and the Equalisation of Factor Prices / Economic Journal 58,1948, S.181- 197
[25] siehe Kapitel IV, Punkt 1, S. 8
[26] vgl. M. Chacholides, International Economics, S. 72 Figure 4.2
[27] vgl. M. Chacholides, International Economics, S. 73 Figure 4.3
[28] vgl. T.N. Rybczynski: Factor Endowment and Relative Commodity Prices, Economica, 1955, S. 336-341
[29] vgl. D. Gandolfo: International Economics I, 1987, S. 94
[30] vgl. W.J.Ethier: Moderne Außenwirtschaftstheorie, 1991, S. 181-183
[31] vgl. Gandolfo: International Economics I, 1987, S. 95
[32] vgl. Gandolfo: International Economics I, 1987, S. 92-93, Fig. 4.11
[33] siehe Kapitel VI, S. 10
[34] vgl. Gandolfo: International Economics I, 1987, S. 90-91, Fig. 4.10
[35] Für diese stark heterogenen Güter gibt es keinen expliziten Markt. Ihre Wichtigkeit ist jedoch unumstritten.Werden sie dem Kapitel zugerechnet, bleibt das H-O-Modell bestehen. Auch eine Erhöhung der Faktor-anzahl wird dies tendenziell nicht ändern.
[36] siehe Kapitel VI, Punkt 4, S. 12
[37] Gleiches gilt für das Ricardo-Theorem, das in erster Linie natürliche Produktivkräfte berücksichtigt. Es be-hauptet u.a., daß Güter, die natürliche Produktivkräfte in großem Maße brauchen, auch in hohem Maße Kapital brauchen. Es wird schlußgefolgert, daß kapitalreiche Länder kapitalintensive Güter aufgrund von Knappheit natürlicher Ressourcen importieren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Heckscher-Ohlin-Modell?
Das Heckscher-Ohlin-Modell ist eine neoklassische Theorie des internationalen Handels, die besagt, dass komparative Kostenvorteile aufgrund unterschiedlicher Ausstattung mit Produktionsfaktoren entstehen. Länder exportieren Güter, die intensiv den Faktor nutzen, von dem sie reichlich besitzen, und importieren Güter, die intensiv den Faktor nutzen, von dem sie knapp sind.
Welche Annahmen liegen dem Heckscher-Ohlin-Modell zugrunde?
Das Modell basiert auf mehreren Annahmen, darunter zwei Länder, zwei Güter und zwei Produktionsfaktoren (Arbeit und Kapital), unterschiedliche Faktorausstattungen der Länder, gleiche Technologie und Nachfragestruktur, Vollbeschäftigung, gleiche Güter- und Faktorqualität, konstante Skalenerträge, vollständige Konkurrenz, keine Transportkosten und keine Handelsbeschränkungen.
Was ist Faktorintensität?
Faktorintensität bezieht sich auf das Verhältnis von Kapital zu Arbeit, das für die Produktion eines Gutes benötigt wird. Ein Gut gilt als kapitalintensiv, wenn es im Verhältnis mehr Kapital als Arbeit benötigt, und als arbeitsintensiv, wenn es im Verhältnis mehr Arbeit als Kapital benötigt.
Was ist Faktorreichtum?
Faktorreichtum bezieht sich auf die relative Ausstattung eines Landes mit Produktionsfaktoren wie Arbeit und Kapital. Ein Land gilt als kapitalreich, wenn es im Verhältnis mehr Kapital als Arbeit besitzt, und als arbeitsreich, wenn es im Verhältnis mehr Arbeit als Kapital besitzt.
Was besagt das Heckscher-Ohlin-Theorem?
Das Heckscher-Ohlin-Theorem besagt, dass ein Land einen komparativen Vorteil in der Produktion des Gutes hat, das intensiv den Faktor nutzt, von dem es relativ reichlich besitzt.
Was besagt das Faktorpreisausgleichstheorem?
Das Faktorpreisausgleichstheorem besagt, dass der freie internationale Handel zwischen Ländern dazu führt, dass sich die Faktorpreise (Löhne und Zinsen) zwischen den Ländern angleichen.
Was besagt das Stolper-Samuelson-Theorem?
Das Stolper-Samuelson-Theorem besagt, dass ein Anstieg des relativen Preises eines Gutes den Reallohn des Faktors erhöht, der intensiv in der Produktion dieses Gutes verwendet wird, und den Realzins des anderen Faktors senkt.
Was besagt das Rybczynski-Theorem?
Das Rybczynski-Theorem besagt, dass bei konstanten Güterpreisen ein Anstieg der Ausstattung eines Landes mit einem Produktionsfaktor zu einer Erhöhung des Outputs des Gutes führt, das diesen Faktor intensiv nutzt, und zu einem Rückgang des Outputs des anderen Gutes.
Was ist das Leontief-Paradoxon?
Das Leontief-Paradoxon bezieht sich auf die empirische Feststellung von Wassily Leontief, dass die USA, obwohl kapitalreich, arbeitsintensive Güter exportierten und kapitalintensive Güter importierten, was den Vorhersagen des Heckscher-Ohlin-Modells widersprach.
Welche Kritik gibt es am Heckscher-Ohlin-Modell?
Das Heckscher-Ohlin-Modell basiert auf vereinfachenden Annahmen, die in der Realität oft nicht erfüllt sind. Kritiker bemängeln, dass das Modell Faktoren wie technologische Unterschiede, Transportkosten, Handelsbeschränkungen und unterschiedliche Nachfragestrukturen vernachlässigt, die ebenfalls den internationalen Handel beeinflussen können.
Wer waren Eli Filip Heckscher, Bertil Gotthard Ohlin und Paul Anthony Samuelson?
Eli Filip Heckscher und Bertil Gotthard Ohlin waren schwedische Nationalökonomen, die die Grundlagen für das Heckscher-Ohlin-Modell legten. Paul Anthony Samuelson war ein US-amerikanischer Ökonom, der das Modell formalisierte und weiterentwickelte.
- Arbeit zitieren
- Maja Voss (Autor:in), 1999, Das Heckscher-Ohlin-Modell, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95455