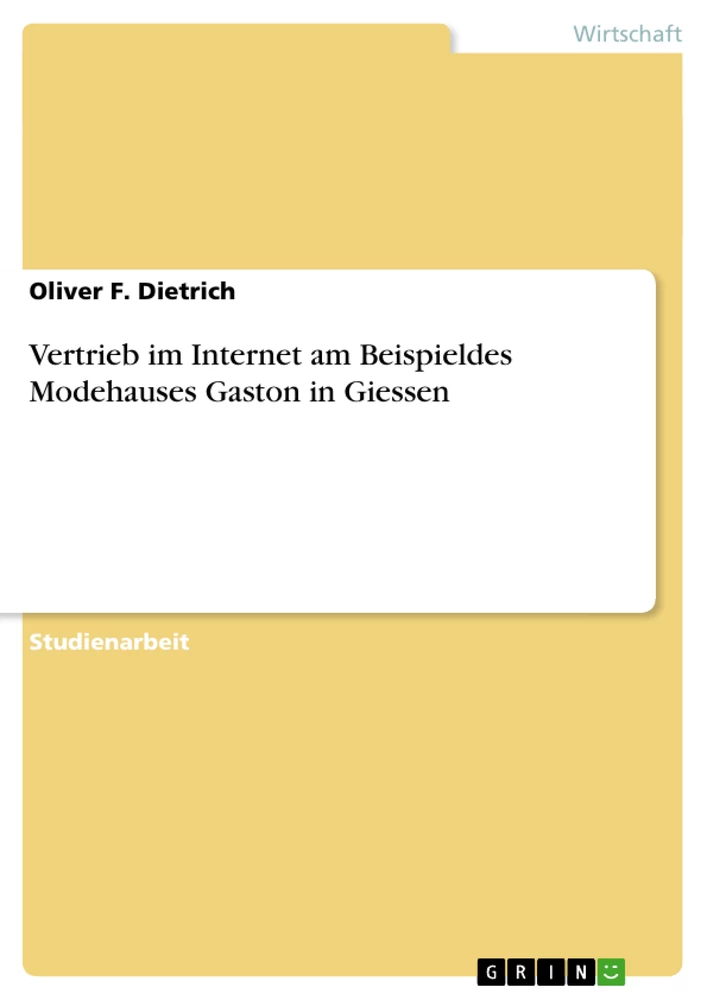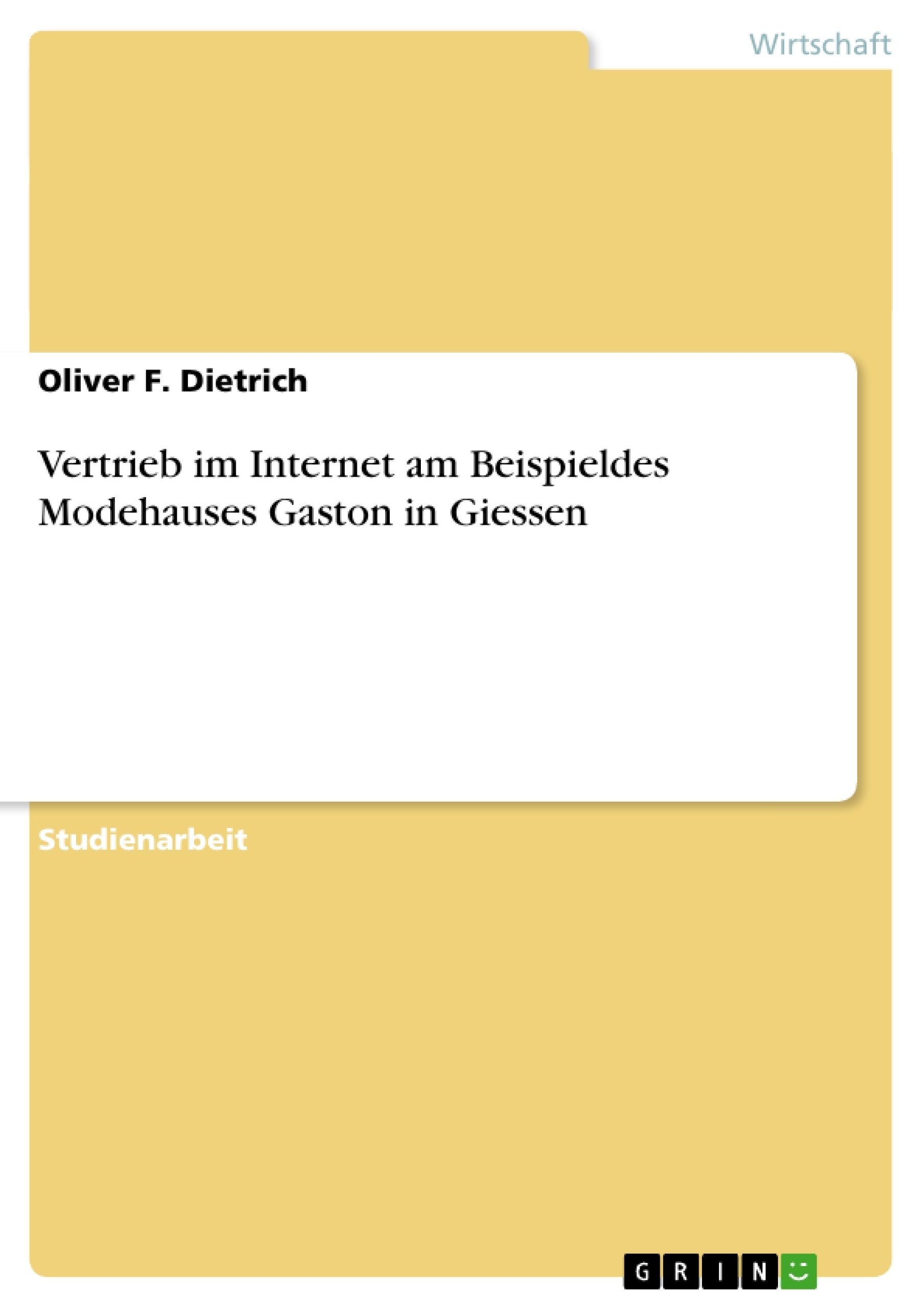Die vorliegende Arbeit soll - wie der Titel zum Ausdruck bringt - in die Problematik des Vertriebs im Internet einführen. Dabei soll die Fragestellung anhand eines Unternehmens untersucht werden, welches erst vor kurzem das Medium Internet in sein Vertriebskonzept aufgenommen hat. Das Modehaus Gaston mit Firmensitz in Gießen führte das Medium Internet Anfang des Jahres 1996 ein und ist somit ein repräsentatives Untersuchungsobjekt für unsere Fragestellung. Ein Interview mit dem Geschäftsführer Herrn vor dem Felde, sowie dem Projektleiter Herrn Möller, sollten als primäre Informationsquelle für die Hausarbeit dienen. In diesem Gespräch stellte sich sehr schnell heraus, daß dem Projekt Internet anscheinend kein fundiertes Konzept vorausging.
Inhaltsverzeichnis
1 Vorwort
1.1 Zum Aufbau dieser Arbeit
2 Was ist das Internet ?
2.1 Differenzierung des Begiffs >Internet<
2.2 Zur Geschichte des World Wide Web als Teil des Internet
3 Vertriebsweg Internet - Zielsetzungen
3.1 Argumente für den Einstieg in das Internet als kommerzieller Anbieter von Waren und Dienstleistungen :
3.1.1 Das Profil der deutschen„Onliner"
3.2 Nachteile, Defizite, Risiken des Vertriebsweges Internet
4 Fallbeispiel: Modehaus Gaston
4.1 Unternehmensbeschreibung
4.2 Zielsetzung und Aufbau des Projektes Internet
4.3 Umsetzung der Zielsetzungen
4.4 Ergebnisse des Vertriebsexperimentes „T-Shirt-Vertrieb via Internet"
4.5 Zukunfsausblick
5 Quellenangabe
Vorwort
Die vorliegende Arbeit soll - wie der Titel zum Ausdruck bringt - in die Problematik des Vertriebs im Internet einführen. Dabei soll die Fragestellung anhand eines Unternehmens untersucht werden, welches erst vor kurzem das Medium Internet in sein Vertriebskonzept aufgenommen hat. Das Modehaus Gaston mit Firmensitz in Gießen führte das Medium Internet Anfang des Jahres 1996 ein und ist somit ein repräsentatives Untersuchungsobjekt für unsere Fragestellung. Ein Interview mit dem Geschäftsführer Herrn vor dem Felde, sowie dem Projektleiter Herrn Möller, sollten als primäre Informationsquelle für die Hausarbeit dienen. In diesem Gespräch stellte sich sehr schnell heraus, daß dem Projekt Internet anscheinend kein fundiertes Konzept vorausging. Im laufe des Gesprächs wurde von dem Geschäftsführer Herrn vor dem Felde angeregt eine andere Firma als Untersuchungsobjekt auszuwählen, da er der Ansicht war, nicht repräsentativ zu sein. Aber genau diese Ansicht wird in dieser Arbeit nicht vertreten. Ziel soll es sein, zu zeigen, daß die meisten kleinen und mittelständigen Unternehmen - wie auch das Modehaus Gaston - glauben, aus Wettbewerbsgründen nicht den Anschluß an einen neuen potentiellen Absatzmarkt verpassen zu dürfen. Kleine Unternehmen reagieren also nur auf einen sich schnell entwickelten Trend, so daß sie sich nicht auf Erfahrungswerte berufen könnten, welche ihnen zur Erstellung eines Konzeptes hätten dienen können. Aus diesem Grund konnte das Modehaus Gaston nur wenige Informationen zur Verfügung stellen.
Zum Aufbau dieser Arbeit
Im ersten Teil meiner Hausarbeit werde ich nun allgemein auf das Thema „Vertrieb im Internet" (Chancen und Risiken) eingehen, um dann im zweiten Teil die herausgearbeiteten Punkte exemplarisch am Beispiel des Modehauses Gaston zu verdeutlichen.
Was ist das Internet ?
Das Internet ist ein elektronisches Mail- und Informationssystem, das verschiedene staatliche Institutionen (vor allem in den USA, aber auch im zunehmenden Maße in Europa), militärische Bereiche, Universitäten und kommerzielle Unternehmen miteinander verbindet.
Das Substantiv „Internet" beschreibt eigentlich nur den Gedanken, der hinter dieser Idee steckt. Wenn man heute vom Internet spricht, dann handelt es sich nicht um ein einzelnes Netzwerk, sondern vielmehr um einen gut koordinierten Zusammenschluß der verschiedensten Rechner (großer und kleiner) weltweit.
Anders als man vielleicht zunächst annehmen könnte, handelt es sich bei Internet nicht um ein zentral organisiertes, weltweites Netzwerk, sondern vielmehr um ein großes Netz, an dem viele verschiedene Computer (oder auch Zusammenschlüsse mehrerer Computer zu LAN´s ) angeschlossen sind, die jeweils von Ihrem eigenen Koordinator verwaltet und am Laufen gehalten werden.
Vorteil des WWW (=World Wide Web) gegenüber anderen Diensten (Unterscheidung s. Punkt 2.1 Differenzierung des Begriffs >Internet<) sind die sogenannten „Links" (Verbindungen), die es dem Nutzer erlauben per Mausklick jede WWW-Seite auf anderen Internet-Rechnern aufzurufen (sofern „Links" in die Pages (=Internetseiten) „eingebettet" wurden). Erst diese „Links" erlauben das zur Zeit vielzitierte „surfen" im Internet.
Differenzierung des Begiffs >Internet <
Zu unterscheiden ist bei dem Gebrauch des Wortes > Internet < in die (1) Dienste (d.h. WWW, FTP, E-Mail u.v.m.) und der (2) Infrastruktur (d.h. das Netz als Transportmedium). Spricht man in der Literatur von >Internet<, wird oft der Fehler begangen , die Infrastruktur mit dem Dienst gleichzusetzen.
Ich begrenze mich nun in dieser Arbeit auf das WWW, da die Bedeutung der anderen Dienste analog schrumpft zum dem Anwachsen des WWW, welches heute mit dem Begriff >Internet< mehr oder weniger gleichgesetzt wird.
Desweiteren ist das WWW der am schnellsten wachsenden Dienst des Internets, was ihn für kommerzielle Zwecke (z.B. Vertrieb von Waren und Dienstelistungen aller Art) am Interressantesten erscheinen läßt.
Zur Geschichte des World Wide Web als Teil des Internet
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1 - Geschichtliche Entwicklung des WWW (Quellen s. Punkt 5.1 Nr. 1,2,3)
Vertriebsweg Internet - Zielsetzungen
Die Zielsetzungen des Vertriebsweges Internet sollten sein:
1) Vollkommen neue Kunden anzusprechen, welche aufgrund von räumlicher Distanz oder anderer persönlicher Privilegien oder Umstände nicht zu meinem bisherigen Kundenkreis gehörten (vgl. Kapitel 3.1 Nr.1).
2) Die bisherigen Kunden noch stärker und langfristig an die Firma zu binden, indem man das Internet als Servicechance erkennt und nützen lernt (vgl. Kapitel 3.1 Nr. 2).
Argumente für den Einstieg in das Internet als kommerzieller Anbieter von Waren und Dienstleistungen :
1) Die Größe des potentiellen Marktes im Internet (Vgl. Kapitel 3.1.1. Das Profil der deutschen „Onliner").Es werden durch diesen neuen Vertriebsweg völlig neuer Märkte erschlossen. Kunden die aufgrund der räumlichen Distanz bisher nicht bedient werden konnten, können nun via Internet bestellen.
Beispiel: Ein Kunde in den USA kann nun problemlos Waren in Deutschland oder anderswo in der Welt bestellen ⇒ die Firma ist weltweit präsent.
2) Das Internet kennt keine Ladenschlußzeiten (Geschäfte sind 24 Stunden am Tag möglich).
Geschäfte im Internet sind Service am Kunden, da er entscheidet, wann er einkaufen möchte ð
⇒ Service am Kunden.
3) Die Einstiegs- bzw. laufenden Kosten für Internet Geschäfte sind im Vergleich zu anderen Vertriebswegen gering.
Hierzu ein Rechenbeispiel :
„Geld ausgeben ist nirgendwo das Problem - Geld sparen ist hier die Kunst. Versuchen Sie mal im richtigen Leben ein Geschäft mit einem monatlichen Gesamtaufwand von 1000,- DM aufzubauen, Personalkosten nicht eingerechnet. Das ist für ein Web-Angebot im Internet schon recht großzügig gerechnet; für ein real existierendes Geschäft ist dies unmöglich zu realisieren. Allein die Anmietung eines Ladenlokals sowie die Einrichtung der Räumlichkeiten verschlingt, bescheiden gerechnet, mehrere zehntausend Mark."
Dieses o.g. Beispiel soll nicht den Eindruck erwecken, daß der Gang in das Internet kostenlos sei. Nachfolgende Aufzählung gibt einen Eindruck der Kostenhöhe und -arten: Es muß der Provider finanziert werden (ca. 100-200 DM pro Monat).
Es müssen Web-Seiten programmiert werden (die Kosten belaufen sich je nach Bereitschaft Geld auszugeben zwischen 0,- DM, wenn Sie die Web-Seiten selbst programmieren, und mehreren zehntausend Mark, wenn ein Fremdauftrag an einen professionellen Anbieter vergeben wird.
⇒ Alles in allem ist der Gang in das Internet im Vergleich zu anderen Vertriebswegen eine kostengünstige Investition in einen eventuell zukünftig schnell wachsenden Markt.
Vgl. Artikel im „Wiesbadener Tagblatt" vom 19.10.1996 : „Das Internet überrollt die Computerbranche" (s. Anlage Z1). Dort beschreibt Gerhard Adler, Geschäftsführer der Marktforschungsgesellschaft Diebold im Vorfeld der Messe „Systems ´96" die Chancen „gerade auch für kleine Anbieter" durch den Gang in das Internet. Jede Unternehmung, ob groß oder klein (dies spielt im Internet keine Rolle, da der Anwender [=pot. Kunde] dies nicht erkennen kann) hat eine Chance, Geschäfte im Internet zu tätigen.
4) Sammeln von Erfahrungen mit diesem neuen Vertriebskanal
Vertrieb im Internet könnte unter Umständen in der Zukunft das Vertriebsmedium für Waren und Dienstleistungen weltweit sein, weshalb es heute gilt, sich „Know-How" anzueignen.
5) Wachstumschancen
Das Internet bietet durch Preisagenturen (s. Anlage Z4: „Erste Preisagenturen im Internet" - Artikel aus der „Welt" vom 28.10.1996), wie die recht junge Firma P.i.x, die Möglichkeit weltweit den günstigsten Artikel zu bestellen. Dies bedeutet „fast" vollkommene Marktransparenz, welche kleinen Unternehmungen zu gute kommen könnte. Der Preis könnte als Kaufkriterium (neben Lieferbereitschaft, Qualität und Service) wieder zunehmen und kleineren, weniger bekannten Unternehmungen Wachstumschancen eröffnen.
Das Profil der deutschen „Onliner"
Dieses Profil ist der Marktuntersuchung des „Stern" aus dem Jahre 1996 mit dem Titel „Der Online-Markt und die Onliner" zu entnehmen. Diese Untersuchung beruht auf Daten bis einschließich Dezember 1995.
Fazit der Untersuchung:
Die Onliner sind überdurchschnittlich jung.
Fast 70% sind jünger als 40 Jahre. Die Altersgruppe der 14-29-jährigen ist deutlich überrepräsentiert, wohingegen die 50-64-jährigen stark unterdurchschnittlich vertreten sind (siehe Anlage J).
Die Onliner sind überduchschnittlich gut gebildet
31,2 % haben Abitur oder einen Studienabschluß. Der Anteil der Bevölkerung mit Abitur/Studium liegt dahingegen nur bei 19,3%
Desweiteren befinden sich Onliner überproportional häufig in gehobenen Einkommensschichten, besonders stark vertreten sind die Personen mit einem Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 5000 DM. 83% der Onliner verfügen über ein Netto-Haushaltseinkommen von mehr als 3000 DM (siehe Anlage K).
Personen, die zu den Onlinern zählen, haben ein deutlich höheres eigenes Einkommen als die Vergleichszielgruppe der Gesamtbevölkerung (siehe Anlage L).
Geldausgabebereitschaft
Insgesamt läßt sich eine hohe Geldausgabebreitschaft der Onliner in fast allen Breichen feststellen, und daß sie das „Leben genießen und einen offenen Konsumstil pflegen".
Der Onliner als Trendsetter(oder Meinungsführer, s. Anlage R)
„Die Onliner nehmen in vielen Märkten eine wichtige Funktion ein, die oft über das Wohl und Wehe von neuen Produkten und Leistungen entscheiden. Positiv ausgedrückt läßt sich dies auf die Formel bringen : „Gewinne die Onliner für Dein Produkt, und Du hast die Weichen für einen erfolgreichen Produktlaunch gestellt"." (Quelle :9 ; siehe Anlage O :"Diffusionsmodell")
Als Fazit der o.g. Untersuchung läßt sich ermitteln, daß die Onliner zu den Interessantesten Zielgruppen in der Bevölkerung zählen : Sie sind einkommensstark und haben eine hohe Geldausgabebereitschaft.
Zu erkunden bleibt lediglich die Akzeptanz des sogenannten „Teleshopping unter den Onlinern".
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, daß das Nutzungsinteresse an Online-Angeboten, speziell am Teleshopping (d.h. dem Bestellen via Internet) bei 37.4 % der Onliner (Gesamtzahl der Onliner ca. 8,03 Mio.Personen) liegt (s. Anlage S). Dies bedeutet ein potentielles Kundenpotential von ca. 3,0 Mio. Personen welche (s.o.) über ein überdurchschnittlichem Einkommen verfügen.
⇒ Des lohnt sich also, diese Zielgruppe mit Angeboten über Internet anzusprechen.
Nachteile, Defizite, Risiken des Vertriebsweges Internet
Hierzu möchte ich zunächst einige Zeilen aus dem Buch „Business-Lösungen im Internet" zitieren (genaue Quellenangabe s. Fußnote Nr. 5), welche den aktuellen Stand recht treffend wiedergeben : „ Der Internet-Boom steht auf tönernen Füßen."
„In Firmen, die irgend etwas für" oder im „Internet machen, fließen derzeit ungeheure Mengen an Geld, obwohl niemand weiß, ob es dort richtig angelegt ist. Die Firma Netscape etwa, Hersteller des populären Internet-Programms, dem Navigator, hatte an der New Yorker Börse zeitweise den Wert von knapp 7 Milliarden US$ „Dabei hat Netscape im ersten Halbjahr 1995 gerade einmal 17 Million Dollar umgesetzt unterm Strich hat das Unternehmen allerdings Verluste in Millionen Höhe gemacht."
„ Die Investitionen in aufstrebende Internet -Firmen sind vor allem Investitionen in die Zukunft dieser Unternehmungen. Die Gegenwart rechtfertigt die Milliardensummen nicht, die in den Internet Firmen stecken."
Dieser kleine Auszug soll die momentane Ungewißheit über das neue Medium verdeutlichen, die überall vorhanden ist. Keiner weiß genau, ob sich wirklich große Geschäfte in der Zukunft über Internet abwickeln lassen werden. Viele jedoch erhoffen es sich, was sich wiederum an den Börsen der Welt (s. Beispiel der Firma Netscape) widerspiegelt.
Aufgrund o.g. Beispiels sollte ebenfalls von der Möglichkeit ausgegangen werden, daß ein Gang in das Internet auch ein „Flop" werden könnte, welcher aber aufgrund der doch recht geringen Kosten im Vergleich zu anderen Vertriebswegen gut kalkulierbar zu sein scheint (vgl. .Kapitel 3.1 Punkt Nr. 3).
Elektronische Bezahlung von Waren noch nicht entwickelt und vor Mißbrauch geschützt - Kreditkartennummern können mißbraucht werden.
Die elektronische Bezahlung steckt noch voller Fehler und Risiken, welche kriminellen Individuen oder Organisationen (etwa Kreditkartenbetrügern) die Möglichkeiten eröffnen, tätig zu werden. „Das Internet ist für jedermann offen. Manipulationen sind nicht zu verhindern, und gegen Viren gibt es kein Rezept. Schlimmer noch - wer seine Kreditkartennummer über die Datenautobahn zum Händler schickt lädt weltweit Betrüger zum Mißbrauch ein" Textquelle : .
Identifizierung des Bestellers nicht gewährleistet.
Hierzu ein Beispiel aus einem Gutachten des Kassler Hochschullehrers Professor Alexander Roßnagel im Auftrag der SPD-nahen Friedrich Ebert-Stiftung :
„Wenn Anna eine Ware bestellt, gibt es keinen Beweis, daß sie die Bestellung abgegeben hat. Cybershop" (entspricht dem Verkäufer) „hätte das" Bestell- „Formular selbst ausfüllen können." Quelle :10
„Oder Berta gibt sich als Anna aus. Cybershop" (=der Verkäufer) „kann die Identität nicht prüfen. Darüber hinaus kann von A bis Z jeder Internet die Kunden- und/oder Kreditkartennummer abfangen" (gewollt oder aber zufällig) „und für seine Zwecke verwenden." Quelle:10
Computerviren und Computerkriminalität
Da das Internet ein offenes Computersystem darstellt, ist die Gefahr von Computerviren und Computerkriminalität jeglicher Art gegeben. Diesbezüglich bedarf es Sicherheitsinstrumentarien und internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verbrechensverfolgung um eine volle Akzeptanz des Mediums in einer breiten Öffentlichkeit zu erlangen (was für ein stetiges, lange anhaltenedes Wachstum unabdingbar wäre). Auf diesem Gebiet steckt das Internet noch in den „Kinderschuhen". Aufgrund der Internationalisierung des Internet ist es schwierig für den einzelnen Nationalstaat sich erfolgreich gegen einen Mißbrauch (wie o. beschrieben zu wehren). Hier bedarf es Absprachen und Verträge um Kunden und Anbietern gesetzliche Rahmenbedingungen zu geben. Als (Negativ-)Beispiel ist hier die Beweislastumkehr beim sogenannten „Electronic-Banking" via Internet (Anfang macht die Bank 24 Ende 1996 - bis dahin ist Home-Banking lediglich über T-Online möglich - anzuführen, bei welchem der Kunde bei eventuellen Pannen im Zahlungsverkehr die volle Haftung zu übernehmen hat (was sicherlich nicht das Vertrauen der Kunden erweckt.) Dies könnte sich wachstumshemmend auswirken.
Momentanes Marktvolumen unbefriedigend, jedoch Wachstumschancen recht optimistisch
Vertrieb im Internet wird vorerst nur ergänzend zum persönlichen Verkauf sowie dem Versandhandelsverkauf angeboten werden, da der Verkauf momentan vom Volumen nicht befreidigend ist. Zukunftsprognosen erwarten jedoch einen Anteil am gesamten Handeslvolumen von ca. 3%, dies wären in Deutschland ca. 27 Mrd. DM in den nächsten Jahren. (Quelle : Artikel im Wiesbadener Tagblatt vom 22.10.1996 mit dem Titel „Im virtuellen Kaufhaus lauern Viren und Betrüger", siehe Anlage Z2). Eine pessimistischere Untersuchung der Mediagruppe München geht von einem weltweiten Marktvolumen im Jahr 2000 von ca. 9 Milliarden US$ aus (siehe Anlage A). Der auf Deutschland entfallenen Anteil entspräche 1,6 Milliarden US$. Die Wahrheit wird wohl (wie bei vielem) in der Mitte liegen. Wie man dieser gravierenden Dissonanz entnehmen kann, herrscht große Unklarheit über die tatsächliche Größe des Marktes im Internet, was es zu einem gewagten Unterfangen werden läßt Investitionen in diesem Bereich zu tätigen.
Fallbeispiel: Modehaus Gaston
In den nun folgenden Abschnitten werden die vorher allgemein herausgearbeiteten Punkte exemplarisch am Beispiel des Modehauses Gaston behandelt.
Anmerkung :
Um den Rahmen dieser Hausarbeit nicht zu sprengen, wurde auf eine ausfühliche Beschreibung der Internetseiten verzichtet. Um dem Leser jedoch eine Vorstellung über die Aufmachung der Seiten zu geben, verweise ich auf das Motivbeispiel in der Anlage T sowie auf die beiliegende Diskette. Bitte beachten Sie die sich auf der Diskette befindene Datei „Hinweis.txt".
Unternehmensbeschreibung
Es handelt sich bei dem Modehaus Gaston nicht um ein selbständiges Modehaus, wie der Name eventuell vermitteln könnte, sondern vielmehr um ein auf die junge Klientel abgestimmten Laden mit entsprechender Ausstattung. Es ist ein Profit-Center der Firma Köhler KG, Gießen mit Zweigstellen in Gießen (2x) sowie einer Filiale in Kassel.
Währenddessen das Stammhaus Köhler sich der älteren, gesetzteren Klientel zuwendet und primär qualitativ hochwertige Waren (Anzüge, Kostüme etc.) im Angebot hat, zielt Gaston auf die junge, ebenfalls kaufkräftige Klientel im Alter zwischen 14 und 29 Jahren (vgl. Kapitel 3.1.1) welche lt. Herrn Möller der „Raver-" oder „Techno"-Szene zugerechnet werden.
Zielsetzung und Aufbau des Projektes Internet
Folgende Zielsetzungen wurden mit dem Projekt Internet verfolgt:
1) Imagebildung : Durch die Präsents auf dem Internet sollte dem Kunden vermittelt werden, daß Gaston „up-to-date" ist.
2) Neukundenwerbung: Das Internet ist (lt. Herrn Möller) das „Informationsmedium der Technoszene", welche immer stärker über die globalen Datennetze kommuniziert.
Da die „Techno"-Anhänger mit der Internet- und der Gaston-Klientel kongruent ist, ermöglicht das Internet-Café dieser Zielgruppe alle o.g. „Bedürfnisse" an einem Ort zu befriedigen. Diese Möglichkeit lockt neue potentielle Käufer aus dem Techno- oder Internetszene in das Internet-Café.
3) Abgrenzung zu anderen Konkurrenten: Die Herren Möller und vor dem Felde stehen auf dem Standpunkt, daß nur „derjenige das Geschäft macht, der die beste Unterhaltung dazu biete".
Sich von den preiswerteren Mode-Filialisten wie H&M zu differenzieren sei zu einer existenziellen Aufgabe von Gaston geworden - das Projekt „Internet-Café" biete dazu die Möglichkeit
4) Eröffnen eines neuen Absatzweges für Produkte des Modehauses Gaston. Vgl. Kapitel 4.3 Nr.4.
Umsetzung der Zielsetzungen
1) Realisierung der Imagebildung:
Dies wurde realisiert dadurch, daß :
a) Gaston -als einer der Pioniere- das Internet als Vertriesmedium erkannte und umsetzte, was das Innovative-Image unterstützen sollte.
B) eine zielgruppengerechte Gestaltung der Homepage erreicht wurde (grelle Farben, Wortwahl der Texte etc).
2) Realsierung der Neukundenwerbung und 3) Abgrenzung zu anderen Konkurrenten:
Dies wurde erreicht durch die kostenlose Möglichkeit im Internet-Café zu „surfen", d.h. sich kostenlos im Internet zu informieren. Zielsetzung war es (wie oben angsprochen.) die Gaston-Klientel aus der Techno-Szene in das Geschäft zu locken (Foto des Internet-Café: s. Anlage T).
4) Realisierung des „Projektes Netstore" (=elektronischer Laden)
Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt, um die Akzeptanz des Internet als Vertriebsmedium für Textilien zu testen. Im Angebot des Netstore befinden sich zur Zeit lediglich T-Shirts mit diversen Motiven (Motivbeispiel - s. Anlage T).
Die Realisierung des „Projektes Internet" Übernahm im Auftrag der Firma Köhler/Gaston die Werbeagentur Möller-Billboards in Gießen. Mit den 6-monatigen Projektarbeiten (Gestaltung der Internet-Seiten) befaßte sich der Geschäftsführer - Herr Möller - persönlich.
Angebotspalete im Netstore:
Im Netstore wird neben der Produktanpreisung (T-Shirts in diversen, grellen Farben und Motiven) auch ein Bestellformular vorgegeben . Durch benützen der Maus soll dieses dem Besteller optimalen Komfort bieten.
Exemplarisches Beispiel einer Auftragsabwicklung bei einer Bestellung im Netstore :
Vorgehensweise bis zur Auslieferung :
Eingabe der personenspezifischen Daten (u. a. Lieferadresse, Namen)
Eingabe der T-Shirt-Größe sowie Motive (diese sind vorgegeben und durch Auswahl mit der Maus leicht auszuwählen.) Eingabe der Bestellmenge.
Zahlungsweise (alternativ besteht die Möglichkeit per Nachnahme oder mit Kreditkarte (Risiken der Kreditkartenübermittlung s. Kapitel 3.2).
Die Bestellung wird nach Eingabe in das Formular als sogenannte E-Mail in einen elektronischen Postkasten des Gaston-Netzwerkes versandt. Dieser Postkasten wird täglich durch die Gaston-Mitarbeiter geleert. Die Auftragsabwicklung folgt nun der Vorgehensweise des Ladenverkaufs mit dem Unterschied, daß die Zustellung über den herkömmlichen Postweg erfolgt.
Ergebnisse des Vertriebsexperimentes „T-Shirt-Vertrieb via Internet"
Seit der Einführung des Internet-Café sowie der eigenen Gaston-Homepage im März 1996 griffen wöchentlich ca. 200 Personen auf die Seiten zu. Wobei der größte Anteil dieser Zahl auf Besucher des Internet-Café fallen dürfte, da diese automatisch auf die Homepage von Gaston geleitet werden, welche diese sozusagen als Plattform zum weltweiten „surfen" verwenden.
Geht man von monatlich 4 Wochen aus, so sind dies in einem halben Jahr 24 Wochen. Multipliziert man dies mit den wöchentlichen Zugriffen auf die Gaston-Homepage von 200 ergibt dies die rechnerische Zahl von 4800 Personen, welche sich die Internetseiten von Gaston angeschaut haben dürften.
Diese Zahl wird jedoch relativiert durch:
1) die Tatsache, daß Gaston über keinen der gängigen Internet-Suchprogramme zu finden war. Was den Verdacht aufdrängt, daß es gar nicht darum ging weltweite Kundschaft anzusprechen, sonder primär darum, den Benutzern des Internet-Terminals im „Café" zu zeigen :„Hey, Gaston ist ja ebenfalls im Internet !"
und 2) die Tatsache, daß man automatisch beim benutzen des Internetanschlusses im Café sich die Homepage betrachtet und dies als voller Zugriff gewertet wird, obwohl man eventuell direkt „weitergesurft" ist.
Bestellt wurden im Laufe des halben Jahres 16 T-Shirts zum Preis von 39,- DM, was einen Gesamtumsatz von (halbjährlich) 624,- DM brutto entspricht.
Stellt man als Kaufmann nun eine (halbjährliche) Gewinn- und Verlustrechnung für das imaginäre Profit-Center „Internet Café" auf ergibt sich folgender Sachverhalt :
Umsatzerlöse :
(s.o.) 39,00 DM * 16 = 624,--
Kosten :
HK der T-Shirts : ca. 20,00 * 16 = 320,-- DM Laufende Kosten für die Bereitstellung des
Internet-Terminals (Telefon) : 1.000,-- mtl. * 6 = 6.000,-DM
Ergebnis. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht war es nicht lohnend. Es ergibt sich ein halbjährliche Verlust in Höhe von 5.696 DM.
Das Projekt „krankt" an zu niedrigen Umsätzen, die jedoch auch zum großen Teil selbstverschuldet sind, da die Internetadresse von Gaston sehr schwer ausfindig zu machen ist.
In keinem der gängigen Suchprogrammen des Internet (z.B. Yahoo oder Altavista) war diese in Erfahrung zu bringen.
Zukunftsausblick
Aufgrund des Scheiterns des Vertriebsexperimentes mit T-Shirts wird Gaston dieses nicht weiter ausbauen. Das Internet-Café wird auch in Zukunft zur Imageverbesserung, -bildung verwendet werden. Ein weiterer Ausbau des Internet-Vertriebs-Angebotes ist aufgrund des schwachen kommerziellen Erfolges auszuschließen, jedoch wird das Internetangebot als Informationsplattform für Gaston weiterhin Bedeutung haben.
Aus imagebildenden Aspekten war das Projekt Internet-Café ein Erfolg. Gaston wurde mehrfach in der Presse erwähnt (einen Artikel ist der Anlage zu entnehmen; Analge T), was sich positiv auf die Bekanntheit ausgewirkt und Neukunden angelockt haben könnte.
Als Vertriebsmedium hat sich hingegen das Projekt Netstore als „Flop" erwiesen. Es mangelt an der Akzeptanz des neues Vertriebsmediums. Das Internet wird allen Prognosen zum trotz zur Zeit lediglich als Informationsmedium benützt.
Geschäfte lassen sich über diesen Weg momentan noch nicht im großem Volumen abwickeln.
Um jedoch in der Zukunft eventuell den Anschluß nicht zu verpassen, wird Gaston die Entwicklung auf diesem Gebiet jedoch weiterhin „aufmerksam verfolgen".
Quellenangabe
1) Skript der Datenverarbeitung Vorlesung Kurs B im Studienschwerpunkt Marketing vom
9.10.1996, Prof. J.Weinberg, Fachhochschule Wiesbaden.
2) Internet - Der schnelle Start ins weltgrößte Rechnernetz, Markt und Technik 1995.
3) Businesslösungen im Internet, Franzis Verlag 1996.
4) Mitschriften geführter Interviews mit den Herren :
Möller (Geschäftsführer der Werbeagentur Möller-Billboards, Gießen) vom 15.10.1996.
vor dem Felde (Geschäftsführer des Modehauses Köhler/Gaston, Gießen) vom 15.10.1996.
5) Marktuntersuchung des „Stern" mit dem Titel „Der Online-Markt und die Onliner" vom August 1996, Verlag : Gruner + Jahr AG & Co..
6) Zeitschrift „Sportswear" Europe Edition, Ausgabe 4/1996.
7) Auszüge aus der Werbekonzeption der Werbeagentur Möller-Billboards mit dem Titel „Projekt Netzone & Netstore.
8) Marktuntersuchung der MGM Media Gruppe München mit dem Titel „Online Publishing"
9) Artikel aus dem „Wiesbadener Tagblatt" vom 19.10.1996 mit dem Titel „Das Internet überrollt die Computerbranche".
10) Artikel aus der „Welt" vom 22.10.1996 mit dem Titel „Im virtuellen Kaufhaus lauern Viren und Betrüger".
11) Artikel aus der „Welt" vom 28.10.1996 mit dem Titel „Das virtuelle Warenhaus ist eröffnet".
12) Artikel aus der Welt vom 28.10.1996 mit dem Titel „Erste Preisagentur im Internet".
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Thema "Vertrieb im Internet"?
Diese Arbeit untersucht die Problematik des Vertriebs im Internet, insbesondere anhand des Beispiels des Modehauses Gaston, welches das Internet als Vertriebsweg eingeführt hat. Die Arbeit behandelt die Chancen und Risiken des Online-Vertriebs, sowie die Zielsetzungen, Umsetzung und Ergebnisse des Projektes Internet bei Gaston.
Was sind die Hauptzielsetzungen für den Einstieg in den Vertriebsweg Internet laut dieser Arbeit?
Die Hauptzielsetzungen sind: neue Kunden anzusprechen, bestehende Kunden stärker an die Firma zu binden, und das Internet als Servicechance zu nutzen.
Welche Argumente werden für den Einstieg in das Internet als kommerzieller Anbieter genannt?
Die Argumente sind: die Größe des potentiellen Marktes, keine Ladenschlusszeiten, geringe Einstiegs- und laufende Kosten im Vergleich zu anderen Vertriebswegen, Sammeln von Erfahrungen mit diesem neuen Vertriebskanal und Wachstumschancen durch Marktransparenz.
Welche Nachteile und Risiken des Vertriebsweges Internet werden in der Arbeit hervorgehoben?
Die Nachteile und Risiken sind: noch nicht entwickelte und gesicherte elektronische Bezahlsysteme (Mißbrauchsrisiko), fehlende Identifizierung des Bestellers, Gefahr von Computerviren und Computerkriminalität, und das momentan noch unbefriedigende Marktvolumen.
Wer sind die deutschen "Onliner" laut der in der Arbeit zitierten Marktuntersuchung des "Stern"?
Die Onliner sind überdurchschnittlich jung (meist unter 40), gut gebildet (Abitur oder Studienabschluss), befinden sich überproportional häufig in gehobenen Einkommensschichten, und haben eine hohe Geldausgabebereitschaft.
Was war die Zielsetzung des Modehauses Gaston beim Einstieg in das Internet?
Die Zielsetzungen waren: Imagebildung, Neukundenwerbung (insbesondere aus der "Techno"-Szene), Abgrenzung zu Konkurrenten, und die Eröffnung eines neuen Absatzweges.
Wie hat das Modehaus Gaston seine Ziele umgesetzt?
Durch die Präsenz im Internet, eine zielgruppengerechte Gestaltung der Homepage, die Einrichtung eines Internet-Cafés, und das "Projekt Netstore" (Verkauf von T-Shirts über das Internet).
Wie waren die Ergebnisse des Vertriebsexperimentes "T-Shirt-Vertrieb via Internet" beim Modehaus Gaston?
Die Ergebnisse waren unbefriedigend. Es wurden lediglich 16 T-Shirts verkauft, was zu einem Verlust aus betriebswirtschaftlicher Sicht führte. Die Internetadresse war zudem schwer auffindbar in Suchmaschinen.
Was ist der Zukunftsausblick für das Modehaus Gaston bezüglich des Vertriebs im Internet?
Aufgrund des Scheiterns des T-Shirt-Vertriebs wird dieses nicht weiter ausgebaut. Das Internet-Café wird weiterhin zur Imageverbesserung genutzt. Ein weiterer Ausbau des Internet-Vertriebs-Angebotes ist aufgrund des schwachen kommerziellen Erfolges ausgeschlossen.
Welche Quellen werden in dieser Arbeit verwendet?
Zu den Quellen gehören unter anderem: Skripte von Vorlesungen, Bücher zum Thema Internet, Interviews mit Geschäftsführern, Marktuntersuchungen (z.B. vom "Stern"), Zeitschriften, Werbekonzepte und Artikel aus Zeitungen wie dem "Wiesbadener Tagblatt" und der "Welt".
- Quote paper
- Oliver F. Dietrich (Author), 1997, Vertrieb im Internet am Beispieldes Modehauses Gaston in Giessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95469