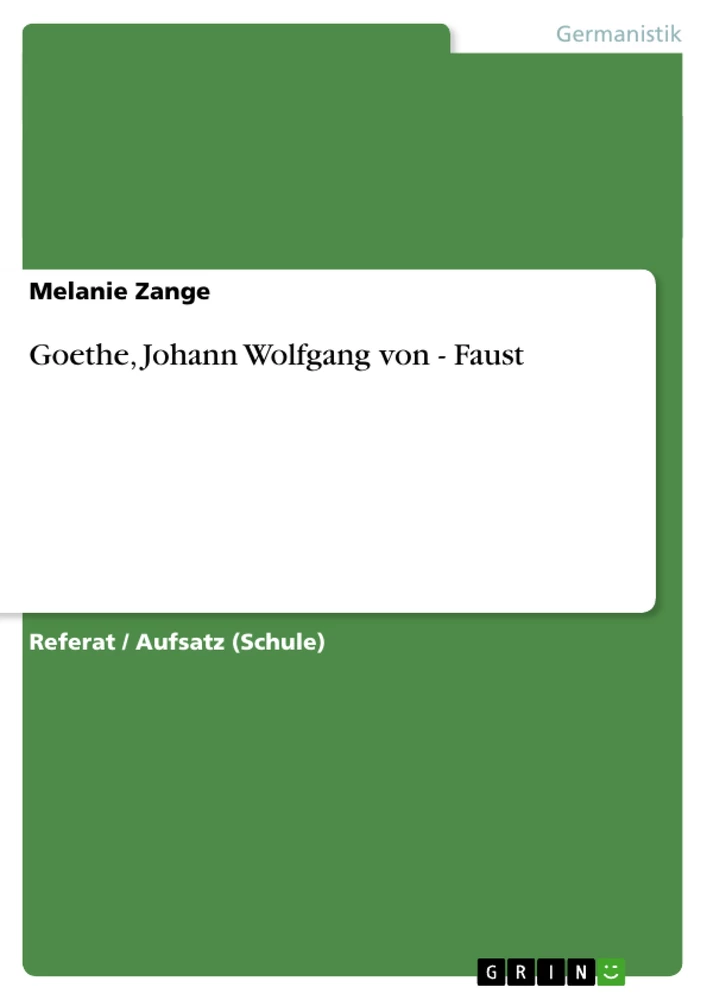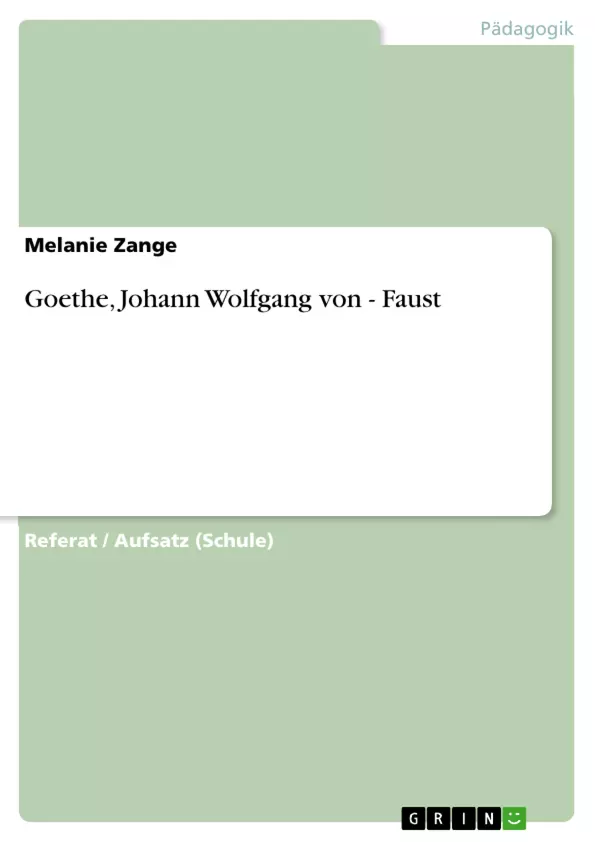Was, wenn ein Pakt mit dem Teufel die Tür zu unendlicher Erkenntnis und sinnlicher Erfahrung öffnet? Johann Wolfgang von Goethes "Faust", ein zeitloses Meisterwerk der deutschen Literatur, stürzt den Leser in einen Strudel aus Ehrgeiz, Verzweiflung und der Suche nach dem Sinn des Lebens. Der alternde Gelehrte Faust, gefangen in der Monotonie des Studierzimmers und unersättlich nach Wissen, schließt einen verhängnisvollen Pakt mit Mephistopheles, dem listigen Teufel. Im Gegenzug für seine Seele verspricht Mephisto, Faust jeden Wunsch zu erfüllen und ihn durch die Höhen und Tiefen menschlicher Existenz zu führen. Diese Reise katapultiert Faust in eine Welt der Verjüngung, der Magie und der leidenschaftlichen Liebe zu Gretchen, einem unschuldigen Mädchen, dessen Leben durch Fausts Streben nach Erfüllung auf tragische Weise zerstört wird. "Faust" ist mehr als nur eine Geschichte; es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den großen Fragen der Menschheit: Was ist der Preis des Wissens? Kann man wahre Erfüllung finden? Und welche Rolle spielen Schuld und Vergebung in unserem Leben? Begleiten Sie Faust auf seiner Odyssee durch die "kleine und große Welt", von der erotischen Verführung bis zur philosophischen Kontemplation, und erleben Sie die unerbittliche Konfrontation zwischen Gut und Böse, Himmel und Hölle, Vernunft und Trieb. Entdecken Sie die zeitlose Relevanz dieses dramatischen Gedichts, das Generationen von Lesern inspiriert und provoziert hat. Tauchen Sie ein in die komplexe Psyche des Faust, die verführerische Bosheit des Mephisto und die herzzerreißende Tragödie der Gretchen. Erleben Sie die sprachliche Brillanz Goethes, die dieses Werk zu einem unvergesslichen Leseerlebnis macht und die bis heute in Theater, Oper und Film widerhallt. Erkunden Sie die allegorischen Ebenen, die tiefen Einblicke in die menschliche Natur und die moralischen Dilemmata, die "Faust" zu einem Eckpfeiler der Weltliteratur machen. Eine unvergessliche Lektüre für alle, die sich mit den fundamentalen Fragen des Daseins auseinandersetzen und die Grenzen der menschlichen Erfahrung ausloten wollen – ein Muss für Liebhaber klassischer Literatur und ein intrigantes Abenteuer für neue Leser.
Faust
Autor: Melanie Zange
Historisch: Johannes Faust geb. 1480 in Knittlingen; gest. 1540 in Staufen bei Breslach Magister, Astrologe, Arzt (ohne Doktortitel)
Vorspiel auf dem Theater
räumliches Konzept:
Vers 239 bis 243: "So schreitet in dem engen Bretterhaus Den ganzen Kreis der Schöpfung aus, Und wandelt mit bedächt'ger Schnelle Vom Himmel durch die Welt zur Hölle."
*** in Faust wird sowohl Himmel und Hölle als auch die Erde dargestellt Gott, der Teufel und der Mensch wird auftreten (Gesamt - Welt - Theater)
Thema:
Vers 167 bis 169: "Greift nur hinein ins volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt, Und wo Ihr's packt, da ist's interessant."
*** das wahre Leben schreibt die besten Geschichten es wird Alltägliches dargestellt
Vers 146 bis 147: "Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe, Wo es in herrlichen Akkorden schlägt?"
*** das Einzelne wird als Thema allgemeiner Gültigkeit dargestellt, das Einzelne ist zu verallgemeinern
Vers 99 bis 104 : "Gebt Ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken!
Solch ein Ragout, es muß Euch glücken; Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht. Was hilft's, wenn Ihr ein Ganzes vorgebracht Das Publikum wird es Euch doch zerpflücken."
*** das Publikum weiß ein thematisch ganzes Stück, das auch in Einzelteilen zusammenpaßt, nicht zu schätzen
Prolog im Himmel
Raphael, Michael, Gabriel:
- die drei Erzengel
- sprechen über Schöpfung und preisen diese
- reden zu Gott
- positive und negative Seiten der Schöpfung (harmonieren zusammen)
*** pansophisches (kosmisches) Weltbild
Mephistopheles:
- bezeichnet sich als Teil des Gesindes (der Diener)
- Gott ist der Herr, das Gesinde sind die Engel (Mephistophanes ist ein gefallener Engel)
- spricht über die Menschen: Vernunft wird schlecht gebraucht/verwendet
- Mensch ist "kleiner Gott der Welt" (ironisch)
- formuliert Anklage: Wie funktioniert der Mensch in der vollkommenen Schöpfung?
Faust:
- der Herr sieht ihn als Diener
- Mephistopheles (sieht Faust so):
*** er dient auf besondere Weise
*** strebt nach dem Erkennen des Göttlichen
*** angetrieben von Suche nach Wahrheit und Erkenntnis
*** will nur das Beste
*** will von der Erde Sinnlichkeit
*** mit nichts zufrieden
*** maßloses Streben
- der Herr:
*** Faust wird sein Ziel erreichen
*** bezeichnet sich selbst als Gärtner, der über die Entwicklung seiner "Wesen" Bescheid weiß
*** Wette: Solange Faust lebt, darf der Teufel ihn prüfen und auf ihn einwirken, wobei Gott in den Glauben Fausts vertraut.
Zusammenfassung von Ijob 1,1 bis 2,10 (biblische Grundlage der Wette):
Im Land Uz lebte ein Mann namens Ijob. Dieser war ziemlich reich und hatte sieben Söhne und drei Töchter. Er war sehr gottesfürchtig und brachte Brandopfer dar, falls seine Kinder gesündigt hätten.
Eines Tages kam der Teufel zu Gott und erzählte von seiner Reise über die Erde. Dabei kommt das Gespräch auf Ijob und dessen Gottesfürchtigkeit.
Der Teufel behauptet, wenn Gott seine Hand gegen ihn ausstreckt, wird er Gott verfluchen. Gott geht auf diese Wette ein und überläßt Ijob dem Teufel.
Ijob verlor zuerst sein Vieh und dann bei einem Brand seine Familie. Doch trotz all dem verfluchte er Gott nicht, sondern nahm es hin.
Als nun Gott und der Teufel sich ein weiteres Mal trafen, sprachen sie wieder über Ijob. Die Wette wurde erweitert, indem nun Ijob seine Gesundheit, aber nicht sein Leben verliert. So schlug der Teufel Ijob mit Geschwüren und Krankheit, doch auch nun lästerte er nicht über Gott oder verfluchte diesen.
Der Tragödie erster Teil
Nacht
Das Gespräch zwischen Faust und Wagner
Faust und Wagner sind zwei sehr unterschiedliche Typen von Wissenschaftlern. Wagner, der Schüler Fausts, sieht den Sinn der Lebens und sein persönliches Ziel darin, sich kaltes, erlernbares Wissen anzueignen.
Dies versucht er durch das Sammeln und die Imitation von schon vorhandenem Wissen.
Er findet die Erfüllung darin, aus dem Vergangenen zu lernen, und er findet es spannend zu erkennen, was die früheren Wissenschaftler gedacht und herausgefunden haben. Er bewundert seine "Vorgänger" und ist stolz darauf, die Möglichkeit zu haben, sich all das, was diese entdeckt haben, durch Lernen anzueignen.
Er folgt nicht, wie Faust, dem Zwang des Herzens, wobei er trotzdem mit Herz und Seele bei der Sache ist.
Doch kann man ihn nicht als "richtigen" Wissenschaftler bezeichnen, denn Faust forscht ebenfalls mit dem ganzen Herzen, versucht allerdings etwas Neues, bisher unentdecktes herauszufinden.
Er sucht nach dem Sinn des Lebens, dem Sinn des Menschseins.
Wagner möchte durch sein Streben Ruhm, Ansehen und die Anerkennung der Gesellschaft erlangen; er besitzt deshalb lediglich eine rationale Welterkenntnis.
Faust hingegen strebt nach dem absoluten Wissen, der absoluten Erkenntnis.
Dies versucht er durch neue, originelle Denk- und Forschungsansätze zu erreichen.
Faust folgt bei seinen Forschungen nicht der Erwartung, die andere Menschen an ihn stellen, sondern allein der Stimme seines Herzens; er forscht einzig für sich selbst. Er ist voll von Zweifeln und steht einer neuen Erkenntnis immer skeptisch gegenüber. Er wird von einem irdischen Trieb und einem beinahe göttlichen Wissensdrang angetrieben. Diese sind wie zwei Seelen in seiner Brust, die er zu vereinen sucht.
Er ist nach der Erkenntnis, daß es nicht weiter geht, daß er gescheitert ist, nicht fähig, seine Forschungen zu beenden, da dies sein innerer Antrieb nicht zuläßt.
Er muß immer weiter suchen, obwohl er sich der Aussichtslosigkeit zu einer Erkenntnis zu kommen bewußt ist.
Dieser Drang und die irrationale Weltansicht fehlen Wagner, der so ewig auf seine rationale Sicht beschränkt bleiben wird.
Sein Wissenschaftsverständnis unterscheidet sich daher erheblich von dem Fausts.
Faust (als er wieder allein ist):
- wundert sich wie Wagner bei seinen Studien nicht verzweifelt, da dieser nur minimale, unbedeutende Dinge herausfindet
- Wagner hat Faust aus seinem Gefühl der Verzweiflung herausgeholt
- die eigenen Taten der Menschen und ihre unverschuldeten Leiden hemmen ihr Leben
- Faust ist nicht den Göttern gleich, er ist vielmehr ein armer, kleiner Wurm, der einfach vernichtet werden kann
- alles, was bisher niedergeschrieben wurde, hilft ihm nicht dabei, das zu finden was ihm fehlt und nach dem er sucht
- alle Hilfsmittel brachten ihn der Lösung keinen Schritt weiter
- man kann die Natur nicht zwingen ihre Geheimnisse preiszugeben, was sie dem Geist der Menschen nicht offenbaren will, bleibt für immer ein Geheimnis
- man muß schwer arbeiten, um das Erbe seiner Eltern antreten zu können und sich dieses erst einmal verdienen
- sein Blick fällt auf eine Flasche, die mit einem Gift gefüllt ist durch deren Anblick wird sein Schmerz gelindert, beim Fassen derselben läßt sein Streben nach dem Wissen nach
- malt sich den Tod aus
- er nimmt eine Schale, füllt diese mit dem Gift und führt sie zum Mund
- Glockenklang ist zu hören, ein Engelschor singt
- Faust hört es und trinkt das Gift nicht
- der Chor der Weiber und der Engel singen von der Auferstehung Jesu und preisen diesen selig
- Faust ist seiner eigenen Meinung nach ungläubig, er strebt nicht nach solchen Zielen
- dieser Glaube, den er von seiner Jugend an kennt, holt ihn ins Leben zurück
- er verbindet Jugenderinnerungen mit dem Lied, das gesungen wird
- Chor der Jünger: Jesus ließ sie auf der Erde zurück Sie weinen über das Glück, das Jesus durch seine Auferstehung widerfährt
- Chor der Engel: Jesus ist den Tod entronnen So sollen auch wir an ein ewiges Leben glauben Jesus ist für alle da, die an ihn glauben
Vers 354 bis 363 Deshalb verschreibt sich Faust der weißen Magie
Vers 377 bis 385 Faust will Wissen mit Leib und Seele, also als ganzer Mensch erleben
Zw. Vers 429 und 430 Nicht Nostradamus, sondern Swedenborgs Anschauungen
Vers 437 bis 446 Nur ein Schauspiel/Abbild, nicht die Ganzheit der Natur erfahren
Vers 481/498/500/512 Erdgeist weist Faust in die Schranken, daß er kein "Obermensch" ist; Faust kann ihn nicht halten
Vers 514 bis 517 Faust verzweifelt
*** Wagner reißt Faust aus dieser Verzweiflung heraus
Vers 527 Wagner immitiert die großen Wissenschaftler
Vers 530 bis 533 distanzierter Wagner
Vers 588 bis 595 Faust pessimistisch (Wagner optimistisch), er stößt an die Grenzen in Wissen und Gesellschaft
Vor dem Tor
Vers 937ff Das Volk kann sich ausruhen, ist fröhlich und zufrieden
Faust fühlt sich als Beobachter, sympatisiert mit dem Volk, weiß aber, daß er nicht dazugehört.
Vers 941ff Wagner kann sich damit nicht identifizieren
Einfaches, natürliches Leben ist nichts für Wagner, er ist ein Bücherwurm und kritisiert die "einfache" Freude.
Faust ist beim Volk beliebt und wird auch bewundert.
Die Arznei, die von ihm und seinem Vater gebraut wurde hat nicht immer geholfen, was an der unvollkommenen Heilkunst lag.
Vers 1050/1053/1055 Faust steht der Herstellung von Arznei skeptisch gegenüber
Wagner verehrt Faust, vielleicht geht ein Abglanz auf ihn über.
Wagner kümmert sich nicht um die mögliche Fehlwirkung der gebrauten Medizin.
Vers 1064 Faust glaubt, daß er nicht in der Lage ist mit seinen bisherigen Mitteln Erkenntnis zu gelangen
=> Ausdruck seines Pessimismus
Die Natur erscheint Faust schön und beruhigend
Vers 1090 - 1095 Faust versucht eins mit der Natur zu werden sinnliche Identifikation mit der Natur
Vers 1104ff Wagner kann die Naturbegeisterung Faust nicht verstehen
Vers 1110ff In Fausts Brust befinden sich zwei Seelen:
1) will Sinnlichkeit erleben (=> Gretchen)
2) Geistiger "Höhenflug" (=> Gelehrtentragödie)
*** Faust ist offen für Mephistos Auftreten
Studierzimmer I
Vers 1335 Stellung Mephistos im Heilsplan Gottes => strebt Böses an, doch Gutes wird erreicht
Vers 1333 Lügner = Diabolo ;
Verderber = Satan ;
Fliegengott = Belzebub
Spannung erzeugend ist, daß Faust nicht gleich zustimmt
Vers 1414 Faust hakt ein, als er hört, daß ihm jemand weiterhelfen könnte
Mephisto kann zwar nicht mehr aus dem Zimmer (Schau?), ist jedoch durchaus in der Lage sich nicht von Faust festhalten zu lassen (schläfert Faust ein).
*** zeigt nochmals, daß Faust, ein Mensch, die Entgrenzung versucht, aber letztlich scheitern muß.
Studierzimmer II
Fausts Freuden liegen in diesem Leben und darauf beschränkt sich auch sein Streben
Vers 1583ff Faust verflucht alles, was er noch nicht erreicht hat die Flüche machen ihn Mephisto ähnlich
Faust ist rastlos / unruhig und dies treibt ihn voran / bestimmt sein Leben
Faust hat mit der Religion sehr wenig Kontakt
Vers 1646/1648 Mephisto bietet sich als Knecht, Geselle und Diener an
Vers 1675 - 1687 Faust verlangt unmögliche Dinge
Vers 1700 Die Wette ist beendet, wenn Faust kein Rastlosigkeit mehr empfindet; dann gehört er Mephisto
*** sobald Faust und Gretchen glücklich wären, wäre die Wette beendet
*** Die Beziehung muß scheitern
ab Vers 1750 Faust formuliert seine Forderungen
er möchte alle Gefühle der Menschheit erleben und damit sein Selbst erweitern
*** Reise in große und kleine Welt
Vers 2055 Faust fühlt sich zu alt
=> Zwei Vorschläge von Mephisto:
1) Verjüngung durch Arbeit => lehnt Faust ab
2) Verjüngungstrank der Hexe
Hexenküche
Vers 2609 erste Reaktion auf das Sehen von Gretchen
Vers 2678ff Faust gefällt Margarete sie wird neugierig auf ihn
Vers 2759 - 2782 Lied vom "König von Thule"
Die Geliebte des Königs lag im Sterben und gab dem König einen Trinkbecher Als nun auch der König sterben mußte, warf er den Becher in das Meer, damit ihn kein anderer bekommt Sowohl der König als auch die Geliebte sterben
=> Liebe und Tod liegen nah zusammen
=> Vorausdeutung für die Beziehung zwischen Faust und Margarete
Entdeckung des Schmucks Gretchen ist neugierig, überwältigt von der Pracht Sie zeigt den Schmuck ihrer Mutter Diese gibt ihm dem Pfarrer Darüber regt sich Mephisto auf Faust bleibt ruhig; Mephisto soll einfach neuen Schmuck besorgen
Ist an Fausts Sprache nach Einnahme des Verjüngungsmittels eine Veränderung zu erkennen (ab Vers 2619)?
Mit dem Auftritt Mephistos verändert sich Fausts Verhalten.
Er spricht wie jemand, der nur an sinnlichen Erfahrungen interessiert ist ("...mir die Dirne schaffen!" Vers 2618).
Ihm ist vermutlich klar geworden, daß er aufgrund der Unterstützung Mephistos einen Wunsch nur äußern muß, und dieser dann erfüllt wird, ohne daß er sich selbst darum bemühen muß.
Abend (2678 - 2804)
- Gretchen ordnet ihr Haar, da sie ihre Nachbarin besuchen will, und verrät in einem Monolog, daß die Begegnung mit Faust sie beeindruckt hat.
- Als sie das Zimmer verlassen hat, erscheinen Faust und Mephisto.
- Faust ist durch Gretchens Welt beglückt, und er drückt dies in religiösen Vokabeln aus, um damit die Geliebt zu erhöhen.
- So spricht er von Gretchens "Heiligtum" (2688), beschreibt sie als "göttergleich" (2707). Er zeichnet sich ein Bild von einem idealen Familienleben, wie es gar nicht sein kann (2697 - 2706).
- Seine Ausdrücke "Liebespein" (2689), "schmachtend" (2690) oder "Wonnegraus" (2709) zeugen von seiner sinnlichen Begierde.
Garten (3073 - 3204)
- Das Rendezvous ist von Mephisto arrangiert
- Beide Paare treten im Wechsel auf
- Faust versteht Gretchens Lebensumstände nicht Sie macht die gesellschaftlich unterschiedliche Stellung von Faust und sich deutlich
- Marthe sieht in Mephisto einen geeigneten Ehemann, wobei er dies umgeht, indem er so tut als würde er sie nicht verstehen (3161)
- Faust versucht den Standesunterschied aus der Welt zu schaffen, indem er die Demut, Einfalt und Niedrigkeit als Tugenden lobt (3102ff)
- das Lob ihrer Einfalt und Demut kann Gretchen gar nicht verstehen, da sie sich deren gar nicht bewußt ist
- Gretchen erzählt von ihrer Familie, ihrer Arbeit und ihren Pflichten (3109 - 3148), um Faust zu zeigen, wer sie ist und was sie kann
- Vers 3117/18 Gretchen will Faust zu verstehen geben, daß sie eine Mitgift besitzt und heiratsfähig ist
- Vers 3121 Sie weist darauf hin, daß sie die Hausfrauen- und Mutterrolle übernehmen kann
- Höhepunkt der Szene ist der Gesprächsabschnitt, der die Liebeserklärung beinhaltet (3163 - 3194)
- Gretchen will Faust deutlich machen, daß sie nichts getan habe, was die Frechheit Fausts bei der ersten Begegnung gerechtfertigt hätte; doch Faust versteht den Tadel nicht
- Gretchens Entscheidung gegen die geltenden Normen zeigt sich im Blumenorakel, welches auf das Ende der Tragödie hinweist
Zunächst bedeutet es den Verlust ihrer Jungfräulichkeit, und weiterhin symbolisiert die Zerstörung der Magerite (Sternblume), die Zerstörung
Gretchens Seins
- Gretchen ist die, die zuerst ihre Liebe gesteht, wobei Faust nur antwortet :Ja, er liebt Dich.
- Vers 3190ff In Bezug auf die Wette darf sich Faust nicht Gretchen hingeben, da dies das Ende der Wette wäre, und er somit verloren
Wald und Höhle (3217 - 3373)
In Fausts Leben gibt es den Bereich des Strebens nach absoluter Erkenntnis und Wahrheit, in den er Gretchen nicht einbeziehen will.
Faust sitzt hier in einer Höhle und richtet ein Dankgebet an den Erdgeist, der ihn abgewiesen hatte, als Faust ihn durch Magie zwingen wollte, ihm jetzt aber das Gefühl des Einklangs mit der Natur schenkt.
Fausts Gefühle schlagen jedoch schnell in Depression um; er denkt an Mephisto, der ihn ihm die Sehnsucht nach Sinnlichkeit erweckt und damit die Harmonie zwischen Faust und der Natur zerstört.
Mephisto erschient nun in der Höhle, um einen Dialog mit Faust zu führen.
Mephisto versucht eine Strategie, mit der er zuerst Fausts Glücksgefühle in der Natur stören und dann das "wilde Feuer" schüren will, das Faust in Richtung der Erfüllung seiner Lust treibt.
Mephisto regt sich über die Doppelmoral der Menschen auf, die darin besteht, daß man nicht über Sexualität reden darf, obwohl sie niemand missen will.
So zeigt sich, daß Mephisto nur die Triebhaftigkeit der Menschen, und nicht ihr Streben nach höheren Zielen, erfassen kann.
Mephisto berichtet Faust dann von Gretchen und will damit seine Begierde anstacheln.
Der Gegensatz zwischen der Betrachtung der Natur, die Fausts höheres Streben verdeutlicht, und Mephistos Drängen, macht die folgenden Äußerungen Fausts möglich, die Bedenken und Gewissensbisse zeigen.
Vers 3347 Faust erkennt, daß er Gretchen nur Unglück bringen wird und ihre heile Welt zerstören wird.
Faust glaubt, daß alles, was jetzt noch folgen wird Schicksal ist und nicht in seiner Hand liegt. Faust ist sich der Zerstörung Gretchens durchaus bewußt, wenn er nicht auf die Erfüllung deiner Begierde verzichtet.
Mephisto kann die Gedanken Fausts nicht verstehen, da er ja nur die triebhafte Ebene des menschlichen Seins erfassen kann.
Inhalt des Gedichts in der Szene Gretchens Stube (3374 - 3413)
Diese Szene zeigt Gretchens Gemütszustand, während Faust sich in der Natur aufhält. Gretchen ist voll von ihren Gefühlen für Faust erfüllt.
Während diesem Selbstgespräch spinnt Gretchen am Spinnrad.
Die immer wiederkehrende Strophe, in der sie vom Verlust ihrer inneren Ruhe spricht, teilt das Gedicht in drei Teile.
Die zweite und dritte Strophe, sagen aus, daß es für sie keine Freude gibt, solange der Geliebte (Faust) nicht bei ihr ist.
In Strophe fünf bis sieben ruft sie sich sein Aussehen in ihr Gedächtnis zurück.
In den letzten beiden Strophen spricht sie von ihrer Sehnsucht nach der Vereinigung mit Faust.
Marthens Garten (3414 - 3543)
Das Gespräch beginnt mit Gretchens Frage nach Fausts Religion. Faust hat eine sehr moderne Einstellung zum Thema Religion. Er hält sie für eine Sache der Gefühle.
Außerdem ist er der Ansicht, man müsse die Religion der anderen achten, auch wenn man selbst keine haben sollte.
Margarete begnügt sich jedoch nicht damit, für sie gehören sowohl die Sakramente als auch der Glauben zur Religion (3421/3423).
Faust antwortet auf die erneuten Fragen nach seinem Gottesglauben mit einer Art Gedicht, was Gretchen verwirrt.
In seiner Rede gibt Faust eine Diskussion über die "Namen Gottes" wider.
Doch bei Faust verliert sich der Gottesgedanke zu einem Gefühl, in das er auch die Beziehung zu Gretchen als Beweis für Gott mit einbezieht.
Als Gretchen bemerkt, daß fast jeder Pfarrer ebenso redet, erwidert er, daß jeder in seiner eigenen Sprache redet (3464).
Gretchen beschließt dieses Thema mit der Feststellung "Du hast kein Christentum." (3468) Margarete geht nun zum Thema Mephisto über, wobei Faust recht schweigsam erscheint. Margarete sieht in Mephisto zwar einen Menschen, doch erkennt sie die Gefahr, die von ihm ausgeht (3488).
Ihr wäre es am liebsten, wenn Faust ihre Abneigung gegenüber Mephisto teilen würde.
Margarete möchte sich verabschieden, da lenkt Faust das Thema auf eine mögliche gemeinsame Nacht, die sie durch ein Schlafmittel, welches er Gretchen für deren Mutter gibt, verleben könnten.
Zwinger (3587 - 3619)
Gretchen hat von ihren Mitmenschen keine Hilfe zu erwarten und wendet sich darum im Gebet an die Mutter Gottes.
Das Gebet gliedert sich in vier Teile:
Zunächst die Anrede und die allgemeine Bitte (3587 - 3589), die Mutter Gottes möge ihr Gehör schenken.
Danach betrachtet Gretchen die Schmerzen Mariens (3590 - 3595), die Gott um Hilfe bat. Weiter schildert Gretchen ihr die eigene Not (3596 - 3615); sie kann nicht ohne Faust leben und bittet Maria um Hilfe.
Am Ende fleht sie Maria an, sie von der Schmach und dem Tod zu erretten, da sie ein uneheliches Kind erwartet (3616 -3619).
Hierbei stellt sich die Frage, warum sie nicht zu Faust geht, ihm von dem Kind berichtet und ihn bittet sie nicht der gesellschaftlichen Diskriminierung auszusetzen.
Häufig gestellte Fragen zu Faust
Was ist das räumliche Konzept im "Vorspiel auf dem Theater"?
Das räumliche Konzept im "Vorspiel auf dem Theater" umfasst den gesamten Kreis der Schöpfung, von Himmel über die Welt bis zur Hölle. Es handelt sich um ein Gesamt-Welt-Theater, in dem Gott, der Teufel und der Mensch auftreten.
Welche Themen werden im "Vorspiel auf dem Theater" behandelt?
Das "Vorspiel auf dem Theater" thematisiert das wahre Leben, das Alltägliche, und die Verallgemeinerung des Einzelnen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob das Publikum ein thematisch ganzes Stück, das auch in Einzelteilen zusammenpasst, zu schätzen weiß.
Wer sind Raphael, Michael und Gabriel im "Prolog im Himmel"?
Raphael, Michael und Gabriel sind die drei Erzengel, die im "Prolog im Himmel" über die Schöpfung sprechen und diese preisen. Sie reden mit Gott und thematisieren sowohl positive als auch negative Aspekte der Schöpfung.
Wie charakterisiert Mephistopheles den Menschen im "Prolog im Himmel"?
Mephistopheles bezeichnet den Menschen ironisch als "kleinen Gott der Welt" und kritisiert den schlechten Gebrauch der Vernunft durch den Menschen. Er stellt die Frage, wie der Mensch in der vollkommenen Schöpfung funktioniert.
Was ist die biblische Grundlage der Wette zwischen Gott und Mephistopheles in "Faust"?
Die biblische Grundlage der Wette ist die Geschichte von Ijob (Hiob) aus dem Alten Testament, in der Gott dem Teufel erlaubt, Ijob zu prüfen, um seine Gottesfürchtigkeit auf die Probe zu stellen.
Was unterscheidet Faust und Wagner als Wissenschaftler?
Wagner strebt nach erlernbarem Wissen und Ruhm, während Faust nach absolutem Wissen und der Erkenntnis des Sinns des Lebens sucht. Faust folgt dem Zwang seines Herzens und ist skeptisch gegenüber neuen Erkenntnissen, während Wagner sich auf bereits vorhandenes Wissen konzentriert.
Warum trinkt Faust das Gift in "Nacht" nicht?
Faust trinkt das Gift nicht, weil er Glockenklang hört und ein Engelschor singt, was Jugenderinnerungen in ihm weckt und ihn ins Leben zurückholt.
Welche Bedeutung hat der Erdgeist für Faust?
Der Erdgeist weist Faust in seine Schranken und zeigt ihm, dass er kein "Übermensch" ist. Faust verzweifelt, als er den Erdgeist nicht halten kann.
Welche Rolle spielt das Volk in der Szene "Vor dem Tor"?
Das Volk ruht sich aus, ist fröhlich und zufrieden. Faust fühlt sich als Beobachter, sympathisiert mit dem Volk, weiß aber, dass er nicht dazugehört, während Wagner sich nicht damit identifizieren kann.
Was sind die zwei Seelen in Fausts Brust?
Die zwei Seelen in Fausts Brust sind der Wunsch, Sinnlichkeit zu erleben, und das Streben nach geistigem "Höhenflug" (Gelehrtentragödie).
Wie positioniert sich Mephisto im Heilsplan Gottes?
Mephisto strebt Böses an, aber durch sein Wirken wird letztendlich Gutes erreicht.
Unter welchen Bedingungen wäre Fausts Wette mit Mephisto beendet?
Die Wette wäre beendet, wenn Faust keine Rastlosigkeit mehr empfindet und vollkommen zufrieden ist. Dies wäre der Fall, sobald Faust und Gretchen glücklich wären.
Was geschieht in der "Hexenküche"?
In der "Hexenküche" nimmt Faust einen Verjüngungstrank zu sich, und seine erste Reaktion ist, Gretchen zu sehen und sich zu ihr hingezogen zu fühlen.
Was ist die Bedeutung des Liedes vom "König von Thule"?
Das Lied vom "König von Thule" in der Szene mit Gretchen handelt von Liebe und Tod, die eng beieinanderliegen, und deutet auf das Schicksal der Beziehung zwischen Faust und Margarete hin.
Was zeigen Fausts Ausdrücke im "Abend" über Gretchen?
Fausts Ausdrücke im "Abend" zeigen, dass er Gretchens Welt beglückt, und er drückt dies in religiösen Vokabeln aus, um damit die Geliebte zu erhöhen.
Welche Bedeutung hat das Blumenorakel im "Garten"?
Im Blumenorakel gesteht Gretchen zuerst ihre Liebe, während Faust erwidert: "Ja, er liebt Dich.". Im Bezug auf die Wette darf sich Faust nicht Gretchen hingeben, da dies das Ende der Wette wäre, und er somit verloren.
Warum kann Mephisto die Gedanken Fausts in "Wald und Höhle" nicht verstehen?
Mephisto kann die Gedanken Fausts nicht verstehen, da er nur die triebhafte Ebene des menschlichen Seins erfassen kann.
Welchen Gemütszustand zeigt Gretchen in der Szene "Gretchens Stube"?
In "Gretchens Stube" wird Gretchens Gemütszustand gezeigt: Sie ist voller Gefühle für Faust und sehnt sich nach ihm.
Welche religiöse Einstellung hat Faust in "Marthens Garten"?
Faust hat eine sehr moderne Einstellung zur Religion und hält sie für eine Sache der Gefühle.
Was bittet Gretchen in ihrem Gebet im "Zwinger"?
Im "Zwinger" bittet Gretchen die Mutter Gottes um Hilfe, da sie von ihren Mitmenschen keine Hilfe zu erwarten hat und ein uneheliches Kind erwartet.
- Quote paper
- Melanie Zange (Author), 1999, Goethe, Johann Wolfgang von - Faust, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95502