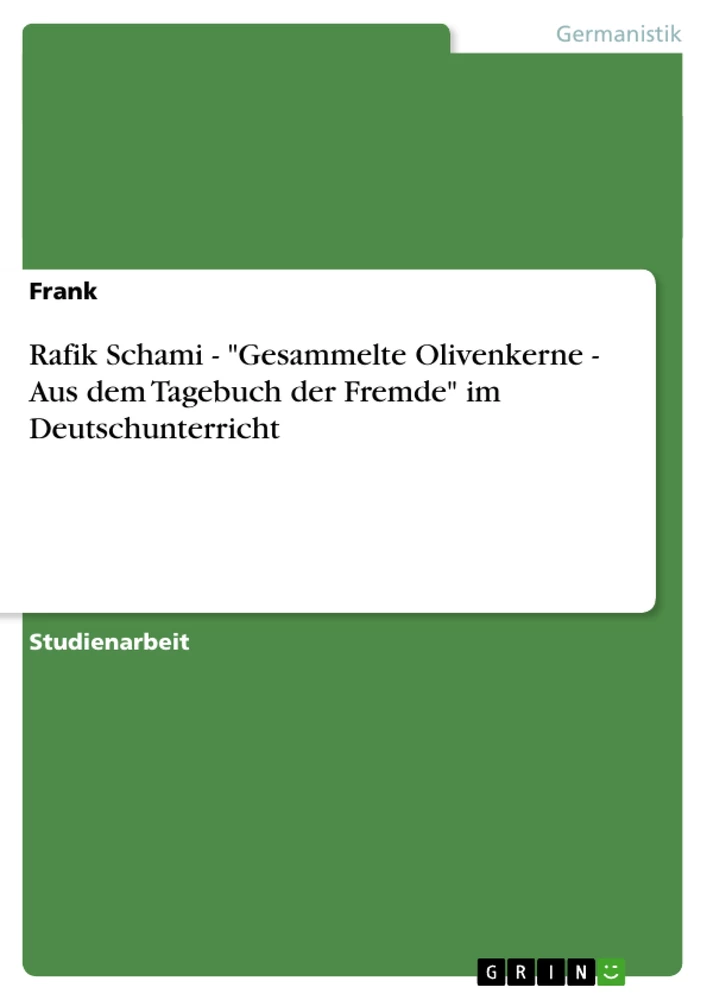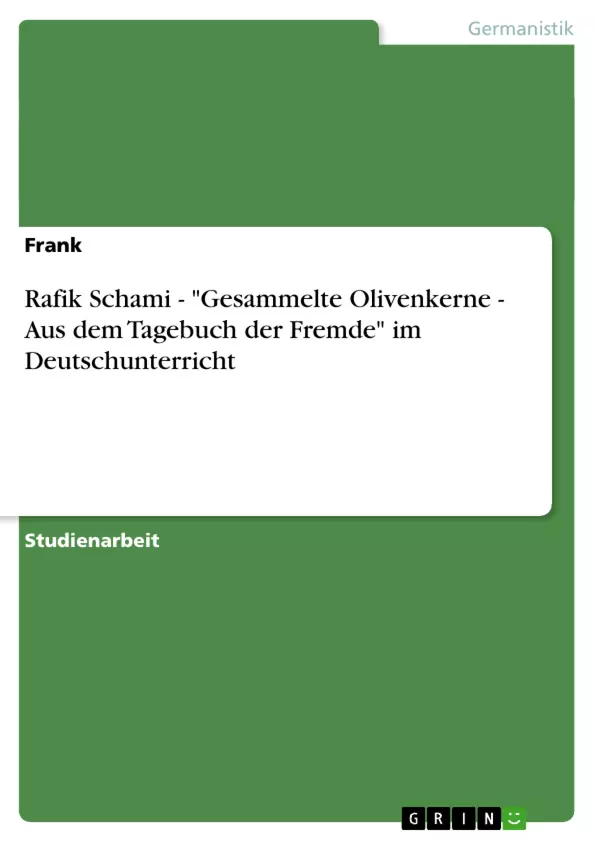Inhaltsverzeichnis
VORBEMERKUNG
1. EINLEITUNG
2. ZUR PERSON DES AUTORS RAFIK SCHAMI
3. DIE ,,GESAMMELTEN OLIVENKERNE - AUS DEM TAGEBUCH DER FREMDE"
3.1. Entstehungsgeschichte
3. 2. Titel und Konzeption
3. 3. Themen und Verläufe
4. DIE OLIVENKERNE IM UNTERRICHT
4.1. Erste Annäherung an die Texte
4.2. Möglichkeiten arbeitsteiligen Literaturunterrichts
4.3. Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht mit
4.3.1. Leseweisen
4.3.2 Illustration von Texten und Bild-Text-Collagen
4.3.3. Schreiben von Parallel- und Gegentexten
4.3.4. Weitere Möglichkeiten des handlungs- und produktionsorientierten
LITERATURVERZEICHNIS
Vorbemerkung
Die vorliegende Arbeit beinhaltet die Verschriftlichung bzw. Ausarbeitung des Referats vom 29. 06. 1998, das ich in der letzten Sitzung des Seminars ,,Moderne Literatur der Gegenwart (1990 - 1998) gehalten habe. Für das Thema habe ich mich aus einem persönlichen Interesse an der sog. Ausländer- oder Migrantenliteratur entschieden und um das Werk Rafik Schamis, der mir bis dahin nur aus der Sekundärliteratur bzw. über Sekundärinformationen aus anderen Seminaren bekannt war, näher kennenzulernen.
Das Erscheinungsjahr der Olivenkerne ist 1997. Daraus ergeben sich - diesem Seminar nicht ganz unbekannte - Probleme für die Literaturrecherche, die sich nur auf das Wenige beziehen kann, was bis dahin über das Buch publiziert wurde. Gibt es über den Autor Rafik Schami wie auch seine zuvor erschienenen Bücher eine Vielzahl an Informationsquellen, so waren z.B. im Internet nur einige wenige Nennungen des Buches zu finden und gaben die Zeitungsartikel, die ich der Autorendokumentation und Ausschnittsammlung des Harenberg Citycenters entleihen konnte, hauptsächlich generelle - auf den Autor und andere seiner Bücher bezogene, ältere - Informationen.
Eine Hilfe waren schließlich die mir auf Anfrage vom Hanser-Verlag zugeschickten drei Zeitungsrezensionen, die allerdings auch mehr eine inhaltlich- ästhetische Stellungnahme zum Buch denn literaturwissenschaftliche Behandlung etc. hergeben.
Insgesamt ist aber zu sagen, daß der Blickwinkel - hier das Thema des Referats - unter dem die Texte betrachtet werden sollen, entscheidend ist: Ihre Kürze und Verständlichkeit erleichtert nämlich - bei aller Hintergründigkeit - eine für Unterrichtszwecke relevante Untersuchung und Verwertung. Die Aspekte der Kürze, Pointiertheit, Einfachheit der Sprache und schließlich die Diversität der angesprochenen Themen lassen die Olivenkerne als - nicht nur im Hinblick auf den Unterricht - ansprechende und wertvolle Literatur erscheinen.
1. Einleitung
Bevor auf das Buch ,,Gesammelte Olivenkerne - Aus dem Tagebuch der Fremde" sowie die Möglichkeiten, die hier enthaltenen Texte für den Unterricht zu verwerten, eingegangen wird, soll der Autor Rafik Schami, sein Lebenslauf und literarischer Werdegang, ins Blickfeld gestellt werden, da dieses Wissen auch für die Rezeption des vorliegenden Buches wie auch der unterschiedlichen Texte wichtig ist.
In einem zweiten Schritt möchte ich auf Entstehungsgeschichte, Konzeption, Titel und Themen aus dieser Sammlung eingehen, wonach Möglichkeiten einer unterrichtsrelevanten Verwertung des Textmaterials aufgezeigt werden. Hier sollen methodische Varianten, speziell solche, wie sie ein handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht bietet, ins Blickfeld gerückt werden.
2. Zur Person des Autors Rafik Schami
Der Syrer Rafik Schami wird 1946 in Damaskus geboren und kommt früh mit mündlich überlieferter Literatur in Berührung. Nach der Schulzeit beginnt er Kurzerzählungen und moderne Märchen in Zeitungen zu veröffentlichen und ist von 1966 bis zu ihrem Verbot Redaktionsleiter einer literarischen Wandzeitung in Damaskus.
Nebst politischen Gründen gehört er auch in religiöser Hinsicht als aramäischer Christ in der islamischen Welt einer Minderheit an; zusammen mit kritischen Israelis plädiert er zudem Anfang der 70er Jahre für ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Israel und Paläs-tina, womit er deutlich die Grenze des politisch Erlaubten überschreitet. Dies hat Syrien ihm bis heute nicht verziehen. 1971 schließlich emigriert er in die Bundesrepublik, wo sich diese frühe Vertrautheit mit dem Außenseiterdasein in seiner Solidarität mit den sogenannten ,,Gastarbeitern" fortsetzt.
Zunächst studiert er Chemie, promoviert, arbeitet in der Industrie und lebt seit 1982 als freier Schriftsteller in Kirchheimbolanden. Bis 1977 schreibt er seine Texte noch in arabischer Sprache, übersetzt sie zum Teil selbst ins Deutsche, Mitte der Achtziger gelingt ihm dann der literarische Durchbruch mit zwei Sammlungen von Märchen, Fabeln und fantastischen Geschichten, 1984 ,,Das letzte Wort der Wanderratte" und 1985 ,,Der erste Ritt durchs Nadelöhr".
Beide Bände zeichnen sich vor allem durch eine Kombination von orientalischen Elementen und märchenhaften Einfällen mit der Beschreibung bundesdeutscher Realität aus. Neben seinem Engagement für eine multikulturelle Gesellschaft thematisieren seine Texte u.a. das Verhältnis Mehrheit - Minderheit, Ausländerfeindlichkeit sowie zunehmende Vorurteile gegen Fremde in vielen Variationen.
Hierbei bedient er sich vorzugsweise eben des modernen Märchens, das nicht harmonisierend oder moralisierend, sondern eher rebellisch - und nicht problemverdeckend - wirken soll.
Neben der Mitherausgeberschaft von sechs Anthologien innerhalb der Reihe ,,Südwind - Gastarbeiterdeutsch" ist Schami - anfangs an der Seite von Gino Chiellino - Mitbegründer des ,,Polynationalen Literatur- und Kunstvereins". Hier beschäftigt ihn die Redaktion der PoLi-Kunst-Jahrbücher.
Viele Auszeichnungen und Literaturpreise werden ihm seit Mitte der Achtziger Jahre verliehen, unter anderem gleich zweimal (1985 und 1993) der begehrte Adelbert-Chamisso-Förderpreis der Robert-Bosch-Stiftung, und in der Begründung des Thäddäus-Toll-Preises 1986 heißt es, Rafik Schami verbinde ,,Fabulierkunst und Erzählfreude mit realistisch genauer Schilderung und bereichere die deutsche Literatur mit einer Vielzahl von Themen, Figuren und Tönen." Seit Mitte der 80er Jahre schreibt er auch zunehmend spezifische Kinderliteratur. Zu Lesungen reist er viele Jahre quer durch die Republik, wovon rund die Hälfte in Schulen stattfinden. Dies erklärt er damit, daß er schon den Kindern zeigen möchte, was er sonst Erwachsenen mit seinen Büchern näherbringen will, nämlich eine größere Sensibilität, Offenheit und Toleranz im Umgang mit Fremden.
3. Die ,,Gesammelten Olivenkerne - Aus dem Tagebuch der Fremde"
3.1. Entstehungsgeschichte
Von 1994 bis 1995 schreibt Rafik Schami allwöchentlich für die letzte Seite der Schweizer Wochenzeitung (WoZ) eine Kolumne mit dem Namen ,,Olivenkerne", die kleine Erzählungen, Plädoyers, Beobachtungen und Anekdoten enthalten sollte - sozusagen als Abspann für die WoZ.
In den Mittelmeerländern sind solche kurzen, ,,lächelnd daherkommen-den" (Olivenkerne, S. 138) Kolumnen ein beliebtes ,,_uvre" und Betätigungsfeld für Schriftsteller, die sich zu Wort melden wollen und so eine Möglichkeit haben, sich politisch in akute bis hin zu alltäglichen Dingen einzumischen. Die in den ,,Gesammelten Olivenkernen" abgedruckten Texte, die naturgemäß sehr unterschiedliche Klangfarben haben, sind allerdings nicht jene, die bereits in der WoZ veröffentlicht wurden. Sie stellen eine unangetastete ,,zeitlose eiserne Reserve" (ebd., S. 140) für den Fall dar, daß Rafik Schami einmal - aus welchen Gründen auch immer - nicht hätte schreiben können.
Dieser Arbeit bzw. dem Entschluß dazu gingen allerdings viele Überlegungen voraus, bis sich Rafik Schami dafür entschied und zusagte, da er, wie er in seinem letzten Text ,,Klein, hart und beherzt" äußert, ,,früher (...) bittere Erfahrungen mit zwei radikalen Zeitungen gemacht (hätte) und (seine) Tage nicht damit vergeuden (wollte), unbelehrbare Trampeltiere zum sensiblen Umgang mit Fremden zu erziehen" (Olivenkerne, S. 137). Doch schließlich reizte ihn die Herausforderung, im Stil der oben angesprochenen Kolumnen solch knappe Texte zu verfassen, ,,die kernig, hart, beherzt und möglichst unterhaltend sein sollten, das heißt: von langer Haltbarkeit" (ebd. S. 139), wobei für ihn, den orientalischen, Ausschweifungen gewöhnten Märchenerzähler, weniger das Problem darin liegen mußte, Themen zu finden als wöchentlich kurz zu schreiben.
3.2. Titel und Konzeption
Die Texte bzw. einzelnen Olivenkerne sind bis auf wenige Ausnahmen nicht viel länger als eine Buchseite, wobei man merkt, daß jeder von ihnen zu einem halben Roman hätte ausgebaut werden können.
Der letzte Text der Olivenkerne, ,,Klein, hart und beherzt", bildet quasi ein erklärendes Nachwort, das Hintergründe zur Entstehung der Kolumne und dem Leser Einblicke in ihre Konzeption gewährt; ohne weiteres hätte dieser Text dem Buch auch vorangestellt werden können, doch folgt der Autor der Ästhetik seiner Texte, deren Ausschnitthaftigkeit, Pointiertheit und ,,Haltbarkeit" (s.o.) so wesentlich besser zur Geltung kommen. Die einzelnen Texte sollen für sich stehend betrachtet werden können und, obwohl sie häufig auf ausgesparte oder nur angedeutete Hintergründe zurückgreifen bzw. anspielen, keiner theoretischen Hinterlegung - auch nicht zur Entstehungsgeschichte - bedürfen.
Olivenkerne hat Schami seine Texte genannt, weil er - wie er begründet - seit seiner Kindheit ,,ein besonders inniges Verhältnis zum Olivenbaum, zu den Oliven und ihren Kernen" habe und weil ,,die Früchte des Olivenbaums nahrhaft (sind), aber nicht jedem schmecken (..), so wie es in der Literatur auch ist" (ebd. S. 138).
Man kann also sagen, daß die Olivenkerne einmal für die unterschiedlichen Erfahrungsgebiete sowie für die unterschiedlichen Arten der Rezeption, der Wahrnehmung und damit der Überlegungen und Betrachtungsweisen stehen. Weiterhin beschreibt Schami den Olivenbaum als ,,Symbol der Verbundenheit mit der Erde, der Güte und Barmherzigkeit" (ebd.) und erzählt in seiner für diese Texte charakteristischen anekdotischen Weise, wie sie als Kinder mit den Kernen auf der Straße gespielt haben, einfache Kunstwerke, Rosenkränze oder Schmuck daraus bastelten, und fügt schmunzelnd hinzu, daß sie dies ,,vielleicht in weiser Vorahnung (geübt hätten), weil in Arabien zu viele Menschen Bekanntschaft mit Gefängnissen machen müssen". Und dort haben die Olivenkerne einen noch größeren Wert, da sie ,,neben den winzigen Glasperlen, das häufigste Arbeitsmaterial (sind), mit dem die Gefangenen ihre Zeit totschlagen und etwas Geld verdienen" (ebd. S, 139). Allein dieser Rückgriff auf - in diesem Fall - frühe Kindheitserinnerungen und sich daran anschließende Assoziationen ist eine ,,Zutat" zum Gesamtrezept der ,,Gesammelten Olivenkerne": Die Sprache ist relativ einfach und entspricht den Themen und Perspektiven in einer fast gedankenähnlichen, unkonventionellen Weise, was auch damit korreliert, daß der in vielen Texten zu findende Ich-Erzähler eigentlich nicht völlig vom Autor getrennt zu werden vermag, wie es in der Regel bei literarischen Texten ist oder sein sollte. Häufig geht Schami nicht nur von persönlichen Erfahrungen aus, sondern bringt sich, seine Biographie und Erfahrungswelt in Form von persönlichen Anleihen und über eine Vielzahl von - aus Gründen der Geheimhaltung wie auch literarisch notwendigen - Namensabkürzungen (,,Mein Freund A.", S. 7; der Lektor seiner Geschichte ,,Blumer", S. 30 usw.) sehr stark in die Texte hinein. Diese datenschutzrechtlichen Vermeidungen des Namens bedeuten allerdings nicht, daß die Identität - außer bei persönlichen Bekannten des Autors freilich - dem Leser immerzu verborgen bleiben muß. Häufig genug weiß der Kontext geschickt über diese ,,Wissenslücke" hinwegzuhelfen, so daß am Ende doch klar ersichtlich ist, um wen es sich letztlich handelt (der ,,tüchtige Weltumsegler und Autor namens G. W." alias Günther Wallraf (vgl. S. 11))
3. 3. Themen und Verläufe
Als ein in Deutschland lebender Orientale steht Rafik Schami in einer gewissen Distanz zu beiden Kulturen, in denen er wurzelt, und nimmt - nicht nur in diesem Buch - all die ihm auffallenden Besonderheiten, Merkwürdigkeiten und Macken gerne ,,aufs Korn", also Dinge, die uns absolut täglich oder sogar normal erscheinen, die wir vielleicht gar nicht mehr sehen. Hierbei bedient er sich eines nie verletzenden Humors und spart gleichzeitig nicht an Selbstironie.
Der Versuch, die 57 Texte nach Kategorien zu unterscheiden, um eine Übersicht darüber zu gewinnen, welche Themen Schami vermehrt behandelt und wo Konstanten oder Schwerpunkte liegen, sieht sich der Schwierigkeit gegenüber, daß bei der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der insgesamt angesprochenen Themen und Bereiche die Eindeutigkeit einzelner Texte aufgrund einer trotzdem starken Verzahnung der Kategorien verschwimmt.
Die folgende während der Arbeit entstandene Tabelle gibt eine Übersicht - zugleich auch über die Schwierigkeit der Kategorienbildung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schließlich gilt es, diese kurzen Stichworte bzw. Charakterisierungen zu einigen wenigen Oberbegriffen zusammenzufassen, wodurch - bei dieser Vielzahl an Schattierungen - die Kategorien freilich immer grober werden müssen. Auffällig ist, daß einige Themen immer wiederkehren und von unterschiedlichen Warten aus fokussiert werden - wodurch sich die folgende Möglichkeit der Kategorisierung anbietet:
- Expertenkritik (an Dichtern, Literaten, Nah-Ost-Experten, Lehrern, Wissenschaftlern, Lektoren etc.)
- Kulturvergleich (Politik, Ideologie, Religion, Ökonomie, Philosophie, Sprache)
- Literatur/Literaturbetrieb (z.B. Bestseller, Krimis, Lektoren, eigenes Schreiben)
- Alltagsbeobachtungen / Anekdoten (Gleichnis, Zusammenleben, Fremdheit)
- Zivilisationskritik (Medien, Zeit/Epoche, Regime, Ökonomie)
Als allumspannenden Rahmen kann man sagen, daß Schami in den Olivenkernen über die ,,Unterschiede zwischen Orient und Okzident sinniert" (Artikel..) - häufig dabei vom Kleinen auf das Große schliessend, wobei er nicht - um auf den Humor zurückzukommen - als moralisierender Oberlehrer auftritt, sondern die Kunst der weisen Frage - auch gerne an eigenen Denkfehlern, Vorurteilen, Verhaltensweisen usw. - demonstriert.
4. Die Olivenkerne im Unterricht
Nicht nur aufgrund ihrer Kürze bieten sich die Olivenkerne für den Literaturunterricht - vorzugsweise in der Sekundarstufe II - an, wobei eine Reihe von Texten auch für die Sekundarstufe I verwertbar sind; hier entscheidet auch wiederum der Blickwinkel, unter dem man sich ihnen nähert bzw. die Zielvorstellung, die der Lehrer für den Unterricht entwickelt hat.
Meiner Meinung nach bietet sich ein handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht mit seinen Methoden an, zumal möglichst große Eigentätigkeit dem Schüler Raum für Motivation, sinnliches - statt rein kognitives - Machen von Erfahrungen, Phantasie und Kreativität eröffnet.
4.1. Erste Annäherung an die Texte
Eine wichtige und vorrangige Aufgabe jeden Literaturunterrichts sollte in der Weckung eines Lesebedürfnisses oder -interesses der Schüler liegen, indem - freilich ohne die kognitiven Belange zu vernachlässigen - von ihren Bedürfnissen ausgegangen und der Zusammenhang zwischen dem zu vermittelnden Stoff, der darauf ausgerichteten Arbeitsweise und der eigenen Subjektivität aufgezeigt wird. Dementsprechend führt der Weg fort von einem starren Vorgeben des Lehrers hinsichtlich des Textmaterials und der Herangehensweise, da ein ,,handelnd- produktiver Umgang mit erzählerischen Texten" (Haas S. 141), wie er hier angestrebt ist, sich immer auch dem einzelnen Schüler in seiner Subjektivität und seinen individuellen Voraussetzungen nähern muß.
Häufig beklagt wird die fehlende Lesebereitschaft der Schüler, deren Medienverhalten auf Kosten des Buches bzw. des Lesen ,,in zunehmendem Maße auf die anderen Medien (Fernsehen, Film, Kassette, Computer)" ausweiche, ,,die ihnen in der leichteren Rezipierbarkeit Erfolgserlebnisse, und das heißt im weitesten Sinne ,,Lese"-Genuß" verschafften (Haas S. 141). Hier trägt die Schule sicherlich ihren Teil zu bei, deren traditionell analytisch auf kognitive Ziele ausgerichtete Didaktik ,,zu einer Belastung für alles Lesen geworden" ist (S. 142). Dem kann nur abgeholfen werden, wenn individuelle Erfahrungen und subjektives Erleben nicht länger ausgespart bleiben: Hier unterscheidet Haas Wahrnehmung und Erfahrung in die zwei Bereiche des ,,Subjekt-Objekt-Schemas einerseits, in dem die Phänomene empirisch-analytisch erkannt und beschrieben werden" und in ,,unabschließbare" Erfahrungen, die Offenheit und Vertrauen innerhalb der Klasse voraussetzen (S. 143). Diese unabschließbaren Erfahrungen, die zu überprüfen kaum möglich erscheint, die aber dennoch von großer Bedeutung für die Subjektivität der Schüler in Bezug auf sich selbst und hier auch auf ihr Verhältnis zur Schule, zum Lesen und zu Literatur sind, müssen - wieder - in ein ,,befruchtendes Wechselverhältnis" zu kognitiv Erfahrbarem im Unterricht treten.
Hierbei stellt sich die Schwierigkeit, die unterschiedlichen Voraussetzungen der Schüler richtig einschätzen zu können, da ein Ziel des Literaturunterrichts in der Schulung der Artikulationsmöglichkeiten liegt und diese daher - um einen klassischen Zirkelschluß zu vermeiden - nicht im vollen Maße vorausgesetzt werden können.
Der Lehrer muß deswegen ,,ein breites Angebot von Umsetzungs- und Anwendungsmöglichkeiten" bereitstellen, wie nun im Folgenden mit dem Stoff verfahren werden kann, und zu verstehen geben, daß es sich um einen dynamischen Findungsprozeß handelt, der den Schülern Wahl- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten einräumt. Wichtig ist auch die Vorgabe eines bestimmten Ziels, das sich allerdings von den üblichen Ergebniserwartungen kognitiven Unterrichts unterscheidet, indem kognitive neben affektive Elemente und beide auf eine andere - mehr dem Schüler zugewandte Ebene - gestellt werden.
Diese Arbeitsatmosphäre muß allerdings erst geschaffen werden. Hierzu bietet sich an, das Buch bzw. den oder die Texte ,,zunächst in der gewohnten Weise vorzustellen und dabei in ein Gespräch über mögliche unterrichtliche Verfahrensweisen einzutreten" (Haas, S. 145).
Leitfragen, die vorab dem Text und der Arbeit vorangestellt werden, bieten sich nur in einer Form an, welche die Annäherung nicht einschränkt und inhaltlich konkretisiert. Es gilt, ein persönliches - mehr emotionales - Verhältnis zur Lektüre allmählich aufzubauen, das Assoziationen und Affekte nicht unberücksichtigt läßt sondern bereits von Anfang an aufgreift. Deshalb schließt sich ein reiner Leseauftrag, der ,,häusliche, individuelle Lektüre verlangt" (vgl. S. 150) wiederum auch aus.
Im Falle der Olivenkerne bietet es sich auch an, jede Stunde ein oder zwei von Schülern ausgewählte Texte zunächst vorlesen zu lassen, wonach erklärt werden soll, ,,warum er diese Stelle ausgewählt hat, was ihm hier gefällt oder mißfällt und insgesamt welche Eindrücke seine Lektüre begleiten" (ebd.). Diese assoziativen Bemerkungen, die vielleicht - je nach Situation - auch schriftlich festgehalten werden sollten, um sie später wieder heranziehen zu können, können in Form von Diskussionseinstiegen als Entscheidungshilfe dafür dienen, welche Texte man jeweils behandelt. Hier eröffnen die Olivenkerne ein reichhaltiges Angebot an Themen und damit Anknüpfungspunkten.
4.2. Möglichkeiten arbeitsteiligen Literaturunterrichts
Ein Vorteil produktionsorientierten Literaturunterrichts ist die Vielzahl an möglichen Aktionsformen, die nicht nur nacheinander sondern auch nebeneinander genutzt werden können, was im Hinblick auf die Motivation und die Vielfalt der Lernformen sinnvoll erscheinen kann. Diese Lernformen sollten dabei möglichst ,,multimedialen" Charakters sein, also ,,entsprechend den verschiedenen Zugriffsweisen auf den Text allen Sinnen" entgegenkommen:
,,Plakate, Bilder, Bild-Text-Friese, gemalte Dias, Fotoreihen als Illustration oder freie Assoziation, geschriebene und/oder gesprochene Texte, Songs, Text-Musik- Kombinationen, Pantomime, Schattenspiel, szenische Interpretationen, Hörspiele u.a." (vgl. Haas, S. 151).
Da neben der Vielzahl an Themen in den Olivenkernen auch von einer Vielzahl an unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen bei den Schülern auszugehen ist, dürfte es relativ leicht fallen, Gruppen zu bestimmten Themenbereichen, bestimmten Texten oder Fragestellungen zu finden bzw. zu bilden, so daß eine größere Zahl an ,,Kernen" letztlich bearbeitet werden kann. Die arbeitsteilig in der Klasse realisierten Aktionsformen sollten nicht unverbunden nebeneinander stehen und ohne konkretes Ziel in Form einer auf einen bestimmten Zeitpunkt festgelegten Präsentation angegangen werden. Nicht nur für den Lehrer ist es wichtig, in einer Zusammenschau die einzelnen Ergebnisse zu veröffentlichen, zu vergleichen und mit den Vermutungen, Zielen und Erwartungen in Verbindung zu setzen. Dieser Rahmen hilft den an diese freien Formen der Arbeit mit Literatur wenig gewöhnten und unsicheren Schüler, auch den Ergebnissen ,,den Ruch des Zufälligen und Fragmenthaften" zu nehmen , indem ,,sie als Einzelteile eines Ganzen sichtbar" (ebd.) gemacht werden.
Für die Olivenkerne können die Ergebnisse beispielsweise den Rahmen des Buches verstehen helfen, der sich aus den unterschiedlich gefärbten Texten konzipiert und dem bei aller Diversität der Themen ein bestimmtes literarisches Rezept zugrunde liegt. Neben den Aspekten des biographischen Lernens und affektiven Sich-Einbringens in die Arbeit darf schließlich das ,,übergreifende Ziel bei allen methodischen Maßnahmen" nicht aus den Augen verloren werden, nämlich ,,beim Schüler auf aktiv-produktive und imaginative Weise Textverständnis anzubahnen, das jeweils durch Rückbezug auf den Originaltext nachgeprüft werden sollte" (Göttler S. 5). Die hier angedachten Formen eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts schließen deshalb Formen der freien Textproduktion im Grunde aus.
4.3. Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht mit den Olivenkernen
4.3.1. Leseweisen
Der schon bei der Frage nach der Annäherung an die Texte angeklungene Aspekt der - nicht einschränkenden - Leitfragen kann in unterschiedlicher Form als ,,Lesehilfe" dem Schüler zur Seite gestellt werden. Um für die unterschiedliche Akzentsetzung in den Arbeitsgruppen eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, sollte der Lehrer Hinweise geben, wie gelesen werden sollte: Zum Einen sollte der Lesevorgang stets ,,mit dem Stift" erfolgen, um ein besseres Memorieren zu ermöglichen und für die Arbeit Strukturierungshilfen zu schaffen. Hierzu gibt der Lehrer einige nützliche Tips, die vielleicht auch an den ersten Texten - wenn nötig - ausprobiert und eingeübt werden, damit z. B. erkannt wird, was essentiell für den Text und seine rasche Durchsicht ist und nicht zuviel unterstrichen wird. Auch sollte den Schülern vorgeschlagen werden, direkt nach der Lektüre jedes einzelnen der kurzen Olivenkern-Texte den Versuch einer stichwortartigen Überschrift zu unternehmen, der eine einigermaßen prägnante Kategorie oder Richtung, die der jeweilige Text einschlägt, hergibt. Die Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben, wurden bereits angesprochen, doch dient dieser Arbeitsschritt nicht unwesentlich dem Hineinfinden in das Buch, dessen Strukturen nach und nach erkannt werden sollen.
Schließlich gilt es auch inhaltlich einige Leseakzente zu setzen: Hier kann der Lehrer beispielsweise dazu anhalten, verstärkt auf die perspektivischen Aspekte der Kurztexte zu achten. So fällt schnell ins Auge, daß Rafik Schami in den Beleuchtungen eines Themas nicht Partei für einen Standpunkt ergreift, was sehr deutlich bei den Texten Paradies I (S. 75) und Paradies II (S. 77) auffällt. Hier beschäftigen den Autor auf der einen Seite die unterschiedlichen Paradiesbilder, die im Westen unter der katholischen Kirche und bei den Sozialisten hervorgegangen sind, und auf der anderen Seite die kulturellen Auswirkungen, welche die Vorstellungen des Orients vom Paradies auf Kultur und Geschichte gehabt haben.
4.3.2 Illustration von Texten und Bild-Text-Collagen
Eine Möglichkeit, mit den Texten auf möglichst sinnliche Weise zu arbeiten, bieten graphische Mittel und Methoden wie die Illustration von Texten oder das Erstellen von Wandzeitungen.
Die im Hanser-Verlag erschienene Ausgabe der Gesammelten Olivenkerne enthält schon ein Beispiel für eine solche Illustration: Eine große Zahl der kurzen Texte ist mit Bildern von Root Leeb versehen, die zu untersuchen sich auch für den Unterricht lohnt. Die comichaften Zeichnungen, die in der Regel noch über der jeweiligen Überschrift plaziert sind, enthalten die wichtigsten Elemente des Textes in unterschiedlich konkreter Form: Sie illustrieren ohne bloß zusammenzufassen, machen das Lesen des darunter stehenden Textes in inhaltlicher Hinsicht also nicht unnötig - und stellen über dies hinaus häufig schon eine pointierte Interpretation dar, die aber nicht von abschließender Art ist und viel Raum für weitere Gedanken läßt.
Auf ähnliche Weise könnten die Schüler nun versuchen, Illustrationen zu entwerfen. Eine Möglichkeit für den Lehrer besteht darin, den Schülern das Buch in Form von Kopien zur Verfügung zu stellen, in denen bei einer Reihe von Texten die Bilder ausgespart bzw. verdeckt sind, so daß zunächst eine Interpretation der sichtbaren vorgenommen und erst anschließend - ohne dabei nur die Vorgehensweise Root Leebs zu verabsolutieren - eigene Versuche vorgenommen werden.
Diese Form der Interpretation durch bildliche Darstellung ist freilich - bei unterschiedlich ausgeprägten Zeichen- und Abstraktionsfähigkeiten der Schüler und unterschiedlich schweren Textsituationen - relativ unsicher hinsichtlich der Qualität der Interpretationen, doch bietet sie sich in der Einstiegsphase an und hilft, eine emotionalere Beziehung zu den Texten aufzubauen. Weiterhin ist hiervon zu erhoffen, daß die beispielsweise zu einer Wandzeitung zusammengestellten Bild-Text-Kombinationen über das gemeinsame Betrachten einige Anhaltspunkte für erste Gespräche im Plenum bieten.
Werden z. B. Gegen- oder Paralleltexte von den Schülern verfaßt, könnte man versuchen, die orientalische Variante des ,,springenden Punkts" ins Europäische zu übersetzen, indem man in den Illustrationen anstelle der Olivenkerne Kirschkerne beispielsweise verwendet.
Der interpretatorische Wert dieser Einzelbilder ist aber - wie schon angedeutet - eher beschränkt, da ,,die Interpretation (..) an Details, Momente, einzelne Situationen gebunden (bleibt)" (Haas, S. 157) und allein die Zusammenfassung solch eines kurzen Olivenkern-Textes in einem Bild eine schwierige Aufgabe darstellt, deren Lösung aber auch gar nicht vom Lehrer intendiert werden kann. Eine weitere Möglichkeit der visuellen Textinterpretation stellt schließlich das Entwerfen von Bild-Text-Collagen dar. Hierzu werden aus Zeitungen und Zeitschriften Text- und Bildelemente zusammengetragen und mit bestimmten Olivenkernen verbunden. Diese Text- und Bildelemente sollen z. B. der Charakterisierung von Personen dienen, die im Blickpunkt eines Textes stehen (z. B. der Dichter in ,,Metamorphose" (S. 13)), der Veranschaulichung von In-halten, Handlungsverläufen, Personenkonstellationen oder eben Oliven- oder Kirschkernen, also von Akzenten oder bedeutsamen Aspekten. Hier eröffnen sich Möglichkeiten der Gruppenarbeit und der Verbindung von spielerischem Suchen und objektivierender Zielsetzung, was der Motivation sehr förderlich sein kann. Auch gestaltet sich in der Einbindung von zentralen Punkten des Textes in die Darstellung die Verbindung zum Text noch enger.
4.3.3. Schreiben von Parallel- und Gegentexten
,,Als Mittel des Verstehens" (Haas, S. 170) stellt das Schreiben von Parallel- und Gegentexten eine Möglichkeit dar, einen flexiblen und zu Transferleistungen fähigen Umgang mit Literatur heranzubilden. Bei dieser Variante der Textarbeit sind die eigenen, realen oder imaginierten Erfahrungen der Schüler von großer Bedeutung, da die angestrebten Übertragungsleistungen eben dieser subjektiven Ebene bedürfen und die Textarbeit in einen viel weiteren, offeneren Rahmen gesetzt wird. Die inhaltlich und ästhetische Vielfalt an Möglichkeiten ist hierbei immens. So können Gegentexte beispielsweise parodistischen Charakters sein, indem Konstellationen oder Handlungsverläufe innerhalb des Basistextes verändert werden. Geschult wird bei dieser Variante ,,ganz ungemein (der) Blick für den Akzent oder auch die Probleme des faktisch vorliegenden Textes", wobei ,,die Alternative (..) immer wieder auch schreibend erprobt werden" muß (Haas, S. 172).
Um einen Gegentext überhaupt schreiben zu können, bedarf es neben der abgeschlossenen und genauen Lektüre des Basistextes einer genaueren Aufschlüsselung desselben, die am Besten schriftlich in Stichpunkten erfolgt oder direkt in einer graphischen Darstellung der Handlungs- und Bedeutungsabläufe und -akzente vorgenommen wird. Am Beispiel des Olivenkerns ,,Metamorphose" (S. 13) läßt sich dies besonders gut veranschaulichen, da der hier - wie in vielen anderen Texten des Buches auch ins Auge fallende - Dreischritt im Spannungsbogen ein gutes Schema für weitere Arbeiten bietet: zunächst wird die Eingangssituation ganz unvermittelt beschrieben, in der eine bestimmte Person - der Dichter - in einer ganz bestimmten Situation - eine Lesung - typisierend dargestellt wird. Dann erfolgt die im Titel angekündigte Metamorphose auf dem Weg von Situation A nach Situation B, wonach als drittes eine satirisch- überspitzte bzw. überzeichnete Charakterisierung dessen vorgenommen wird, was für Schami hier den Olivenkern ausmacht, wenn man so will, die Pointe also. Dieser relativ leicht zu verstehende und zu deutende Text eröffnet den Schülern eine gute Plattform für parallele Überlegungen, da es sich um einen Sachverhalt - das Auf- und Ablegen von Masken in unterschiedlichen Situationen - handelt, der ihnen wahrscheinlich in vielen anderen Formen bekannt ist.
Anhand der damit herausgearbeiteten ,,Schablone" werden die Schüler nun gebeten, eine analoge Geschichte zu verfassen, in der die erzählerische Linie entweder beibehalten, gerne aber auch modifiziert oder verkehrt werden darf. Diese Geschichte kann z.B. aus der Perspektive des Dichters geschrieben werden, indem man seine Absichten und Gedanken auflistet, die ihm die Veränderung notwendig erscheinen lassen. Oder man überlegt sich, welche Wirkung es hätte, wenn sich die Verhaltensweise der handelnden Person nicht oder in entgegengesetzter Abfolge veränderte, was eine recht groteske - deswegen auch aufschlußreiche - Situation hervorbrächte. Auch könnte eine solche Geschichte auf andere Personengruppen - z. B. Politiker, Ärzte usw. - übertragen werden, welche sich in ähnlicher oder anderer Weise in unterschiedlichen Situationen unterschiedlicher Verhaltensmuster bedienen.
Ein Vorteil dieser Arbeitsvariante besteht auch darin, daß die Schüler über spielerisches Ausprobieren und Jonglieren mit eigenen Erfahrungen sowie den textlichen Vorgaben am Ende etwas hergestellt haben, ,,das neben den Ausgangstext tritt und sich in der Diskussion bis zu einem gewissen Grade als etwas Eigenes behauptet" (Haas, S. 171).
4.3.4. Weitere Möglichkeiten des handlungs- und produktionsorientierten
Umgangs mit den Olivenkernen Natürlich kann man die Texte nicht nur bloß inhaltlich-strukturell untersuchen, sondern sich auch beispielsweise der sprachlich-rhetor-ischen Seite zuwenden, indem man die Art und Weise analysiert, in der die einzelnen Abschnitte und Übergänge des Textes beschrieben sind. Eine Fragestellung könnte also lauten, inwiefern Sprache und Inhalt bzw. Absicht zusammenhängen und einander bedingen und wie sich schließlich die Sprache - hier in Bezug auf das Metamorphose-Beispiel - auf dem Weg von Situation A nach Situation B verändert.
Nach dieser Analyse von Aufbau, Stil und Semantik kann man auf weitere Möglichkeiten zurückgreifen, die ein handlungsorientierter Literaturunterricht bietet und die hier nur kurz angesprochen werden sollen:
Im Zuge weiterer Textbegegnungs- und Vermittlungsformen können die Schüler aufgefordert werden, eine Buchbesprechung der Olivenkerne für eine Literaturzeitschrift zu schreiben, einzelne Texte zu Zeitungsberichten umzuschreiben, eine Figur daraus anzuklagen und zu verteidigen und Steckbriefe bzw. Charakterisierungen von ihr zu erstellen. Auch lassen sich Ort und Figuren eines Textes häufig genauer beschreiben, ein Vorspann, eine Vorgeschichte, eine Fortsetzung oder Rahmenhandlung finden oder der Versuch vornehmen, sich selbst in einen Text hineinzuschreiben. Neben den schon angesprochenen Veränderungen am Textmaterial ist auch eine Veränderung des Stils oder der Zeit, in der die Handlung spielt bzw. auf die sie sich bezieht, reizvoll. Über dies hinaus gibt es Formen des szenischen Spiels und der musikalischen Beschäftigung mit dem Unterrichtsstoff, die eine weitere ,,multimedialen" Möglichkeit der Arbeit mit Literatur und Einbindung der eigenen Subjektivität des Schülers bieten.
Literaturverzeichnis
AIN (nur Autorkürzel bekannt): Gesammelte Olivenkerne - aus dem Tagebuch der Fremde - Zeitungsartikel, IN: Bücherwurm, 2/97
Dettloff, Ariane: ,,Ich nenne mich Gastarbeiter" - Rafik Schami will ,,die Geschichten des Volkes" wieder unverknirscht erzählen, SchriftstellerPorträts (XIII) IN: Vorwärts Nr. 29, 1983
Göttler, Hans: Moderne Jugendbücher in der Schule - Modelle zu einem handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht, Schneider Verlag Hohengehren,
Haas, Gerhard: Handlungs- und produktionsorientierter LiteraturunterrichtTheorie und Praxis eines ,,anderen" Literaturunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe, Kallmeyer 1997 (Praxis Deutsch)
Farin, Klaus: Mit List in die Köpfe der Menschen - Ein Gespräch mit dem syrischen Erzähler Rafik Schami IN: Der Tagesspiegel/Literatur Nr. 12728, 1987
Fischer, Jürg: Rafik Schamis WoZ-Kolumnen in Buchform: Klein, hart und beherzt - Ein Dichter aus dem Morgenland wirft amüsierte Blicke auf unsere Kultur. IN: Die Wochenzeitung, Zürich 1. 8. 1997
Landolt, Patrik: Die Bestie Exil - Oder: Wie ich ein deutscher Dichter wurde - ein ZEITGespräch mit Rafik Schami, der aus seiner Heimat Syrien geflohen ist, IN: Die ZEIT Nr. ? 1997
Ohland, Angelika: Geschichten sind wie Freunde - Mit märchenhaften Erzählungen aus Damaskus verführt Rafik Schami zu einem offenen Dialog zwischen Orient und Okzident, IN: Das Sonntagsblatt, Nr. 6 1997
Schami, Rafik: Gesammelte Olivenkerne - Aus dem Tagebuch der Fremde, Carl Hanser Verlag München Wien 1997
Semmler, Thomas: Mit syrischen Augen, IN: Novalis Nr. 7/8, 1997
Stahr, Volker: Von Feen, Ungeheuern und anderen Verrücktheiten, IN: Die Welt Nr. 76, 1990 S. 23
Tantow, Lutz: Rafik Schami, IN: Arnold Lexikon zur Gegenwartsliteratur, Stand: August 1989
Ulrich, Anna Katharina: Zeit für Geschichten - eine Begegnung mit dem Schriftsteller Rafik Schami, IN: Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe N. 247, 1994
Wagner, René: Von Damaskus nach Kirchheimbolanden IN: FAZ Nr. 203, 1990
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments über Rafik Schamis "Gesammelte Olivenkerne"?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau und Analyse von Rafik Schamis Werk "Gesammelte Olivenkerne - Aus dem Tagebuch der Fremde". Es enthält Inhaltsverzeichnis, Vorbemerkungen, eine Einleitung, Informationen über den Autor, eine detaillierte Betrachtung des Buches selbst (Entstehungsgeschichte, Titel und Konzeption, Themen), sowie Vorschläge für den Einsatz des Buches im Unterricht.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Vorbemerkung, Einleitung, Informationen zur Person Rafik Schamis, eine detaillierte Analyse der "Gesammelten Olivenkerne" (inklusive Entstehungsgeschichte, Titel und Konzeption, Themen und Verläufe), sowie Überlegungen zum Einsatz der "Olivenkerne" im Unterricht (verschiedene Ansätze wie arbeitsteiliger und handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht) und ein Literaturverzeichnis.
Welche Informationen werden über Rafik Schami gegeben?
Das Dokument enthält Informationen über Rafik Schamis Lebenslauf, seinen literarischen Werdegang und sein Engagement für eine multikulturelle Gesellschaft. Es wird auf seine frühe Berührung mit mündlich überlieferter Literatur, seine Emigration nach Deutschland, seine literarischen Erfolge und seine Auszeichnungen eingegangen.
Wie werden die "Gesammelten Olivenkerne" analysiert?
Die Analyse der "Gesammelten Olivenkerne" umfasst eine Untersuchung der Entstehungsgeschichte der Kolumnen, eine Erläuterung des Titels und der Konzeption des Buches sowie eine detaillierte Betrachtung der behandelten Themen und deren Verläufe. Es wird auch auf die sprachliche Gestaltung und die Rolle des Ich-Erzählers eingegangen.
Welche Themen werden in den "Gesammelten Olivenkerne" behandelt?
Die "Gesammelten Olivenkerne" behandeln eine Vielzahl von Themen, darunter Expertenkritik, Kulturvergleich (Politik, Ideologie, Religion, Ökonomie, Philosophie, Sprache), Literatur/Literaturbetrieb, Alltagsbeobachtungen/Anekdoten und Zivilisationskritik. Schami sinniert über die Unterschiede zwischen Orient und Okzident, oft mit einem humorvollen Blickwinkel.
Wie können die "Olivenkerne" im Unterricht eingesetzt werden?
Das Dokument schlägt verschiedene Möglichkeiten für den Einsatz der "Olivenkerne" im Literaturunterricht vor, vorzugsweise in der Sekundarstufe II, aber auch in der Sekundarstufe I. Es werden Methoden des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts vorgestellt, die auf die Förderung von Eigentätigkeit, Kreativität und Phantasie der Schüler abzielen. Zu den konkreten Vorschlägen gehören Leseweisen, Illustration von Texten, Erstellung von Bild-Text-Collagen und das Schreiben von Parallel- und Gegentexten.
Was bedeutet handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht in diesem Zusammenhang?
Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht bedeutet in diesem Kontext, dass die Schüler nicht nur Texte analysieren, sondern auch aktiv und kreativ mit ihnen umgehen. Sie setzen sich handelnd mit den Inhalten auseinander, produzieren eigene Texte, Bilder oder andere kreative Werke und entwickeln so ein tieferes Verständnis für die Literatur.
Welche Arten von Leseweisen werden vorgeschlagen?
Es wird vorgeschlagen, den Lesevorgang stets "mit dem Stift" zu begleiten, um das Memorieren zu erleichtern und Strukturierungshilfen zu schaffen. Außerdem sollen die Schüler versuchen, stichwortartige Überschriften für die einzelnen Texte zu finden, um die Struktur des Buches besser zu verstehen. Der Lehrer kann auch dazu anhalten, verstärkt auf die perspektivischen Aspekte der Texte zu achten.
Welche Formen der Textproduktion werden vorgeschlagen?
Es werden verschiedene Formen der Textproduktion vorgeschlagen, darunter das Schreiben von Parallel- und Gegentexten, das Umschreiben einzelner Texte zu Zeitungsberichten, das Schreiben von Buchbesprechungen, das Verfassen von Steckbriefen oder Charakterisierungen von Figuren und das Finden von Vorspännen, Vorgeschichten oder Fortsetzungen.
Welche Literatur wird im Literaturverzeichnis aufgeführt?
Das Literaturverzeichnis enthält eine Auswahl von Texten, die sich mit Rafik Schami und seinem Werk auseinandersetzen, darunter Zeitungsartikel, Interviews, Rezensionen und wissenschaftliche Arbeiten. Es dient als Grundlage für weitere Recherchen und vertiefende Auseinandersetzungen mit dem Thema.
- Quote paper
- Frank (Author), 1998, Rafik Schami - "Gesammelte Olivenkerne - Aus dem Tagebuch der Fremde" im Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95509