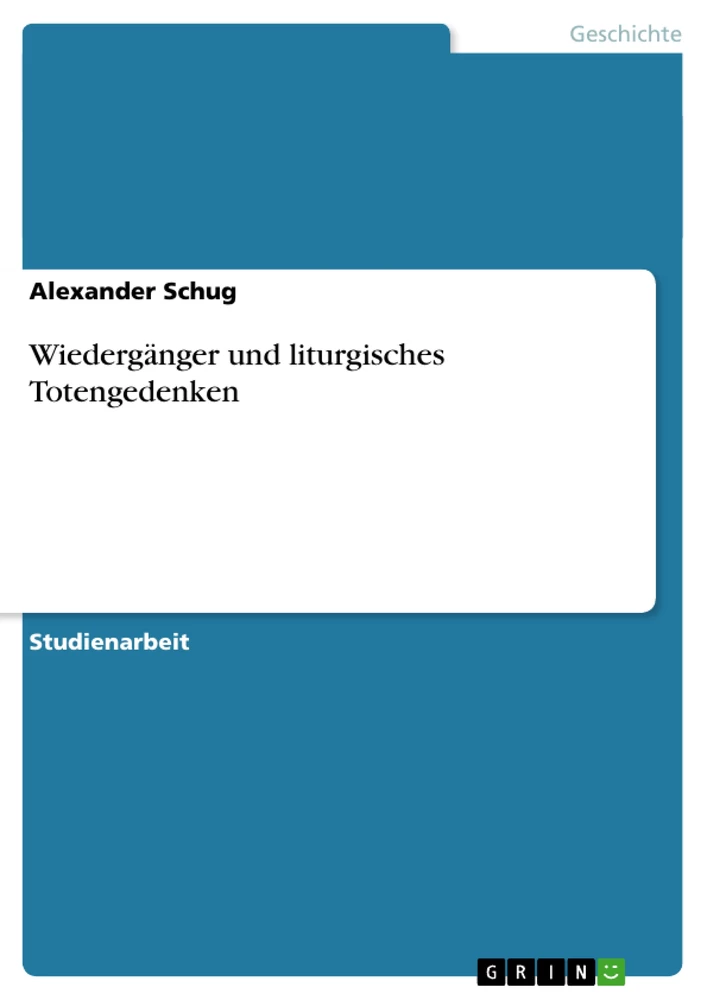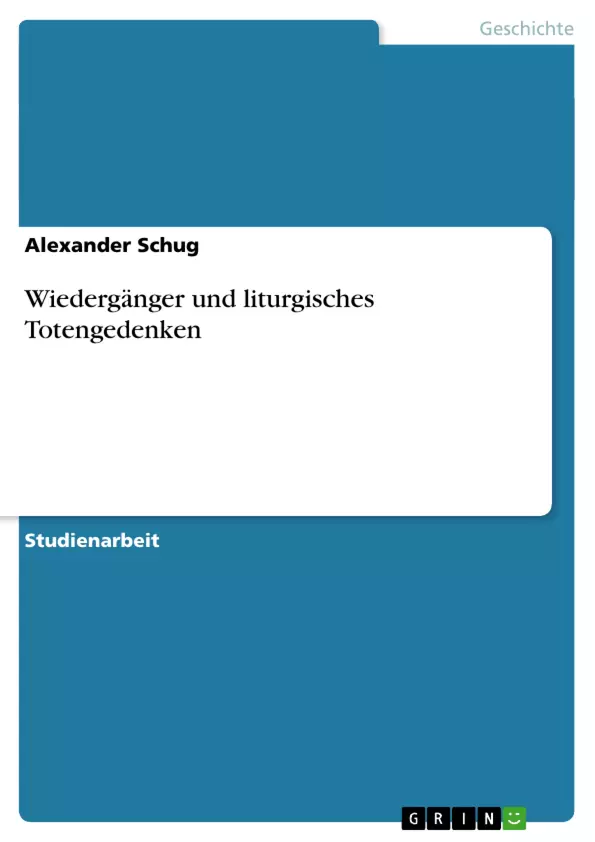Im Zentrum dieser Hausarbeit steht das Motiv der Wiedergänger/Totengeister und die Frage, inwiefern mittelalterliche Berichte über die Wiederkehr von Toten die Entwicklung des liturgischen Totengedenkens widerspiegeln und tradiert haben.
Im ersten Teil wird eine Einführung in das Thema unter Berücksichtigung der literarisch-kulturellen Wurzeln des Wiedergängermotivs und der Grundlagen der liturgischen Memoria geleistet. Der zweite Teil zeigt wie schwer die Kirche und die Kirchenväter sich mit der heidnischen Tradition der Wiedergänger anfänglich taten eh sich die Berichte über Totengeister als ,,didaktisches" Mittel im 6. Jahrhundert entfalten konnten und populärer wurden. Die Akzeptanz und ,,Christianisierung" der Totengeister und die Verknüpfung dieses Motivs mit der liturgischen Memoria ist Thema des dritten Abschnitts. Unter der Überschrift ,,Invasion der Totengeister" wird dann der immer deutlichere Niederschlag von Wiedergängern in schriftlichen Quellen ab dem 10. Jahrhundert verfolgt, was mit der Ausformung der Memorialpraxis in Verbindung gebracht wird. Unter Punkt 5. werden die wichtigen Veränderungen der liturgischen Memorialpraxis, die von Cluny ausgingen, abgehandelt und gezeigt, daß die cluniacensischen Reformen (wie die Einführung des Allerseelenfestes) unter Verwendung des Totengeistermotivs legitimiert wurden. Die Banalisierung der Totengeister, die durch die ,,Predigermaschinerie" sogenannter Bettelorden oder der Zisterzienser bewirkt wurde, wird im sechsten Abschnitt thematisiert. Mit der massenhaften Verbreitung des Totengeistermotivs und der Etablierung eines relativ festen Systems des liturgischen Totengedenkens tritt ab dem 13. Jahrhundert auch eine ,,Säkularisierung" der Totengeisterberichte ein. Nicht nur Kleriker, sondern auch weltliche Autoren verwendeten nun das Wiedergängermotiv und illustrierten damit, daß die kirchlichen Anstrengungen zur gewohnheitsmäßigen Umsetzung des christlichen Totengedenkens erfolgreich waren und in weiten Kreisen, auch außerhalb kirchlicher Institutionen, Anklang fanden und reproduziert wurden. Diesem Gedanken ist Punkt 7. gewidmet. Schließlich werden die Ergebnisse dieser Arbeit in einem Fazit kurz zusammengefaßt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Die frühe kirchliche Ablehnung der Totengeister
- Akzeptanz und Christianisierung der Totengeister
- Die „Invasion der Totengeister“ und die Verbreitung kirchlicher Vorstellungen von liturgischem Totengedenken
- Cluny, die Erneuerung des Memorialwesens und die Totengeister
- Fazit
- Banalisierung und Säkularisierung der Totengeister
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Motiv der Wiedergänger und Totengeister im Mittelalter und deren Einfluss auf die Entwicklung des liturgischen Totengedenkens. Sie analysiert die anfängliche Ablehnung der Kirche gegenüber heidnischen Totengeistertraditionen und die spätere Integration und „Christianisierung“ dieses Motivs. Die Arbeit beleuchtet auch die Veränderungen der liturgischen Praxis und die Rolle von Cluny in diesem Prozess.
- Die Entwicklung des liturgischen Totengedenkens im Mittelalter
- Die Rolle von Wiedergängern und Totengeistern in mittelalterlichen Berichten
- Die anfängliche Ablehnung und spätere Akzeptanz der Totengeister durch die Kirche
- Der Einfluss von Cluny auf die Reform des Memorialwesens
- Die Säkularisierung des Totengeistermotivs
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt kurz den Fokus der Arbeit: die Untersuchung des Motivs der Wiedergänger und Totengeister im Mittelalter und deren Einfluss auf die Entwicklung des liturgischen Totengedenkens. Es benennt die wichtigsten verwendeten Quellen und deren jeweilige Stärken und Schwächen.
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Vorstellung von Totengeistern im griechisch-römischen Heidentum und den germanischen Kulturen. Es wird dargestellt, wie diese Geister in vorchristlichen Erzählungen als gewalttätig und furchterregend beschrieben werden, und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um ihre Rückkehr zu verhindern. Im Kontrast dazu wird der Wandel im frühen Christentum skizziert, von der anfänglichen Vorstellung eines abgeschlossenen Lebens nach dem Tod hin zur Entwicklung von Konzepten wie Läuterung und Fegefeuer, die die Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits stärken.
Die frühe kirchliche Ablehnung der Totengeister: Dieses Kapitel behandelt die anfängliche Ablehnung der Totengeister durch die Kirche und die Kirchenväter. Es analysiert, wie die heidnische Tradition der Wiedergänger mit der christlichen Lehre kollidierte und wie die Kirche versuchte, diese Vorstellung zu unterdrücken. Es wird erörtert, warum die Berichte über Totengeister zunächst als problematisch und nicht mit der christlichen Lehre vereinbar angesehen wurden.
Akzeptanz und Christianisierung der Totengeister: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel in der kirchlichen Sichtweise auf Totengeister, ihre Akzeptanz und schließlich ihre „Christianisierung“. Es wird untersucht, wie sich ab dem 6. Jahrhundert Berichte über Totengeister als didaktisches Mittel verbreiteten und wie dieses Motiv mit der liturgischen Memoria verknüpft wurde. Die Veränderung von der Ablehnung hin zur Integration in die christliche Lehre wird hier analysiert.
Die „Invasion der Totengeister“ und die Verbreitung kirchlicher Vorstellungen von liturgischem Totengedenken: Dieses Kapitel untersucht den zunehmenden Niederschlag von Wiedergängern in schriftlichen Quellen ab dem 10. Jahrhundert und bringt dies mit der Ausformung der Memorialpraxis in Verbindung. Es wird detailliert auf die Rolle von Cluny und deren Reformen, wie beispielsweise die Einführung des Allerseelenfestes, eingegangen und deren Legitimierung unter Verwendung des Totengeistermotivs analysiert.
Banalisierung und Säkularisierung der Totengeister: Hier wird die zunehmende Banalisierung des Totengeistermotivs durch Bettelorden und Zisterzienser beschrieben. Es wird untersucht, wie die massenhafte Verbreitung dieses Motivs und die Etablierung eines festen Systems des liturgischen Totengedenkens ab dem 13. Jahrhundert zu einer Säkularisierung der Berichte führte. Die Verwendung des Wiedergängermotivs sowohl durch Kleriker als auch weltliche Autoren und die Implikationen für die Verbreitung des christlichen Totengedenkens werden untersucht.
Schlüsselwörter
Wiedergänger, Totengeister, liturgisches Totengedenken, Memoria, Mittelalter, Kirche, Cluny, heidnische Tradition, Christianisierung, Säkularisierung, Memorialpraxis, Allerseelenfest.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur mittelalterlichen Darstellung von Totengeistern und deren Einfluss auf das liturgische Totengedenken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Motiv der Wiedergänger und Totengeister im Mittelalter und deren Einfluss auf die Entwicklung des liturgischen Totengedenkens. Sie analysiert die anfängliche Ablehnung der Kirche gegenüber heidnischen Totengeistertraditionen und die spätere Integration und „Christianisierung“ dieses Motivs. Die Arbeit beleuchtet auch die Veränderungen der liturgischen Praxis und die Rolle von Cluny in diesem Prozess.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des liturgischen Totengedenkens im Mittelalter, die Rolle von Wiedergängern und Totengeistern in mittelalterlichen Berichten, die anfängliche Ablehnung und spätere Akzeptanz der Totengeister durch die Kirche, den Einfluss von Cluny auf die Reform des Memorialwesens und die Säkularisierung des Totengeistermotivs.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit besteht aus den Kapiteln: Vorwort (Beschreibung des Fokus und der Quellen), Einleitung (Totengeister im Heidentum und frühes Christentum), Frühe kirchliche Ablehnung der Totengeister (Konflikt mit christlicher Lehre), Akzeptanz und Christianisierung der Totengeister (Integration und didaktische Verwendung), Invasion der Totengeister und Verbreitung kirchlicher Vorstellungen (Rolle von Cluny und Reformen), und Banalisierung und Säkularisierung der Totengeister (Verbreitung und Säkularisierung des Motivs ab dem 13. Jahrhundert).
Welche Rolle spielte Cluny in der Entwicklung des liturgischen Totengedenkens?
Cluny spielte eine bedeutende Rolle bei der Reform des Memorialwesens. Die Arbeit untersucht detailliert die Rolle von Cluny und deren Reformen, wie beispielsweise die Einführung des Allerseelenfestes, und deren Legitimierung unter Verwendung des Totengeistermotivs.
Wie veränderte sich die kirchliche Sichtweise auf Totengeister im Laufe des Mittelalters?
Die kirchliche Sichtweise auf Totengeister veränderte sich von anfänglicher Ablehnung und Unterdrückung hin zu Akzeptanz und schließlich „Christianisierung“. Die Arbeit analysiert diesen Wandel und die Integration des Motivs in die christliche Lehre und liturgische Praxis.
Was versteht man unter der Säkularisierung des Totengeistermotivs?
Die Säkularisierung des Totengeistermotivs beschreibt die zunehmende Banalisierung und weltliche Verwendung des Motivs ab dem 13. Jahrhundert. Die massenhafte Verbreitung und die Etablierung eines festen Systems des liturgischen Totengedenkens führten dazu, dass das Motiv sowohl von Klerikern als auch weltlichen Autoren verwendet wurde, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Verbreitung des christlichen Totengedenkens.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wiedergänger, Totengeister, liturgisches Totengedenken, Memoria, Mittelalter, Kirche, Cluny, heidnische Tradition, Christianisierung, Säkularisierung, Memorialpraxis, Allerseelenfest.
- Arbeit zitieren
- Alexander Schug (Autor:in), 1999, Wiedergänger und liturgisches Totengedenken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9555