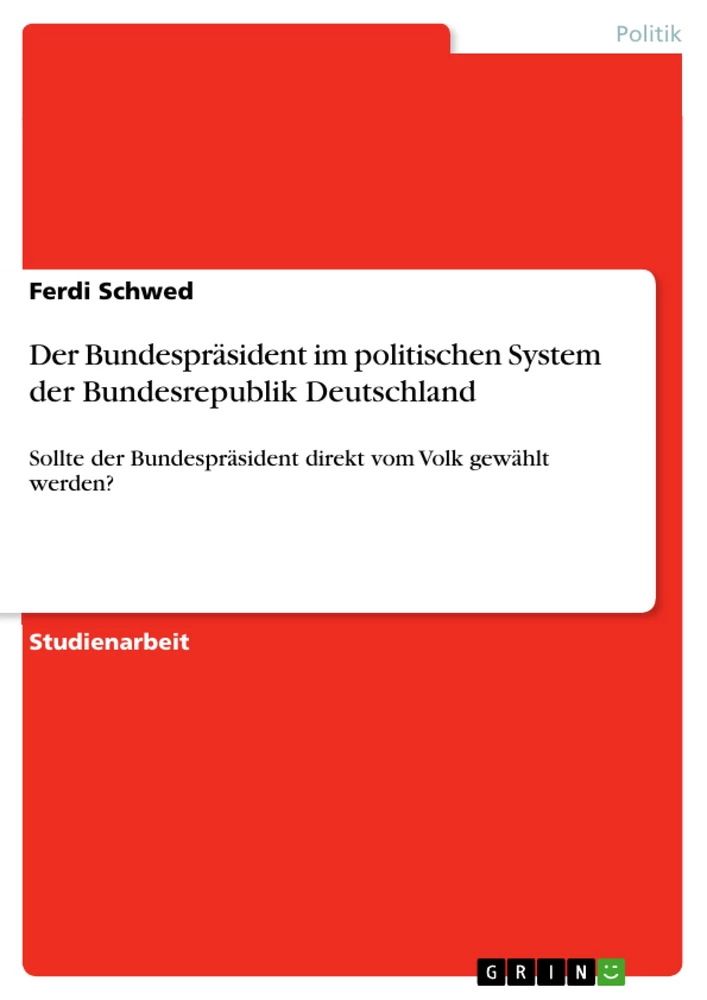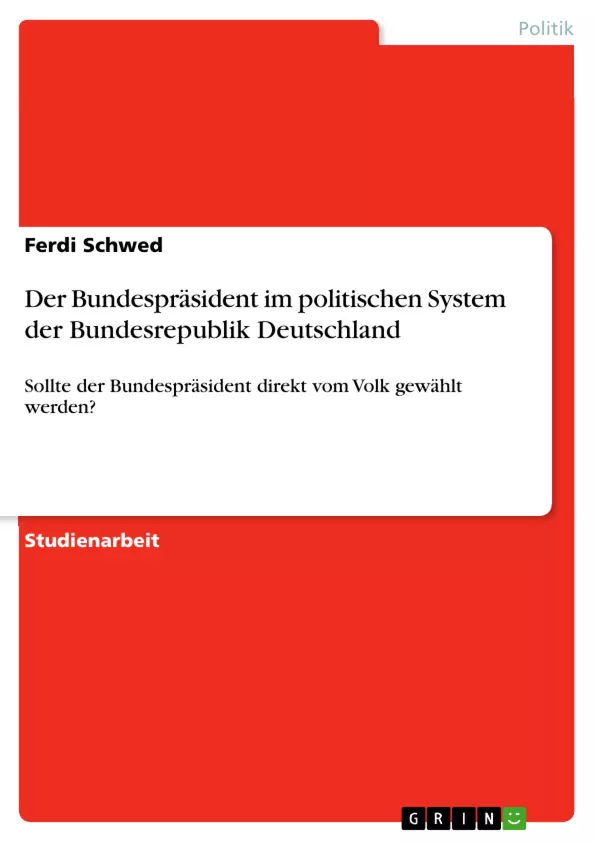Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt werden sollte. Dafür sollen im ersten Teil sowohl die Funktionen des Bundespräsidenten als auch der Wahlvorgang näher betrachtet werden.
Darauffolgend wird der Einfluss des Reichspräsidenten der Weimarer Republik auf das Amt des Bundespräsidenten ins Auge genommen. Anschließend werden die Argumente der Befürworter und Gegner einer Direktwahl erläutert und diskutiert. Zum Schluss wird ein finales Fazit gezogen, in welchem die wichtigsten Argumente nochmals aufgefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland
- 2.1 Stellung und Kompetenzen des Bundespräsidenten
- 2.2 Wahl des Bundespräsidenten
- 3. Der Reichspräsident der Weimarer Republik
- 4. Argumente gegen eine Direktwahl
- 4.1 Der Legitimationsüberschuss
- 4.2 Die Weimar-Argumente
- 4.3 Das Wahlkampfargument
- 5. Argumente für eine Direktwahl
- 5.1 Eine stärkere Integrationsfigur
- 5.2 Kritik an der Bundesversammlung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt werden sollte. Im Fokus steht dabei die Analyse der Funktionsweise des Amtes und der verschiedenen Argumente für und gegen eine Direktwahl. Dabei werden die historischen Parallelen zum Reichspräsidenten der Weimarer Republik beleuchtet und die Auswirkungen einer möglichen Direktwahl auf die politische Landschaft der Bundesrepublik Deutschland diskutiert.
- Stellung und Kompetenzen des Bundespräsidenten
- Wahl des Bundespräsidenten
- Argumente für und gegen eine Direktwahl
- Vergleich mit dem Reichspräsidenten der Weimarer Republik
- Potenzielle Auswirkungen einer Direktwahl auf das politische System
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und erläutert die aktuelle Situation der indirekten Wahl des Bundespräsidenten. Die Kapitel zwei und drei befassen sich mit der Stellung und den Kompetenzen des Bundespräsidenten sowie der historischen Entwicklung des Amtes, wobei die Rolle des Reichspräsidenten in der Weimarer Republik untersucht wird.
Die Kapitel vier und fünf präsentieren die Argumente gegen und für eine Direktwahl des Bundespräsidenten. Die Befürworter argumentieren für eine stärkere Integration des Bundespräsidenten in die Gesellschaft und eine größere Legitimation durch das Volk, während die Gegner Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überlastung des Amtes und der damit verbundenen Herausforderungen im Wahlkampf äußern.
Schlüsselwörter
Bundespräsident, Direktwahl, Bundesversammlung, Weimarer Republik, Reichspräsident, Integrationsfigur, Legitimation, Wahlkampf, politische System, Bundesrepublik Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Bundespräsident aktuell gewählt?
Er wird indirekt durch die Bundesversammlung gewählt, die aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Delegierten der Landesparlamente besteht.
Was sind die Argumente für eine Direktwahl?
Befürworter argumentieren, dass eine Direktwahl die demokratische Legitimation erhöht und der Bundespräsident dadurch eine stärkere Integrationsfigur für das Volk wird.
Welche historischen Gründe sprechen gegen eine Direktwahl?
Die Erfahrungen aus der Weimarer Republik zeigen, dass ein direkt gewählter Reichspräsident mit zu viel Macht eine Gefahr für die parlamentarische Stabilität darstellen kann.
Was ist der „Legitimationsüberschuss“?
Es bezeichnet das Problem, dass ein direkt gewählter Präsident eine höhere Legitimation als der Kanzler hätte, was die Balance im parlamentarischen System stören könnte.
Welche Rolle spielt die Bundesversammlung?
Sie ist das Verfassungsorgan, das ausschließlich zur Wahl des Bundespräsidenten zusammentritt und die föderale Struktur Deutschlands widerspiegelt.
Was sind die Kompetenzen des Bundespräsidenten?
Er hat primär repräsentative Aufgaben, fertigt Gesetze aus und schlägt den Bundeskanzler zur Wahl vor, besitzt aber wenig direkte politische Macht.
- Quote paper
- Ferdi Schwed (Author), 2020, Der Bundespräsident im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956420