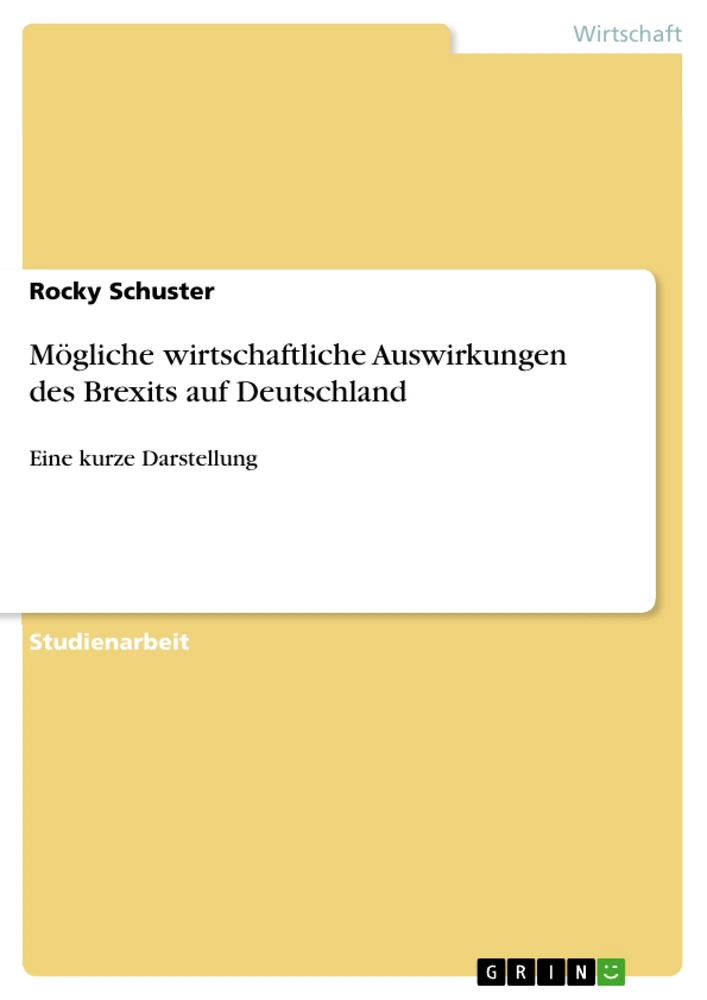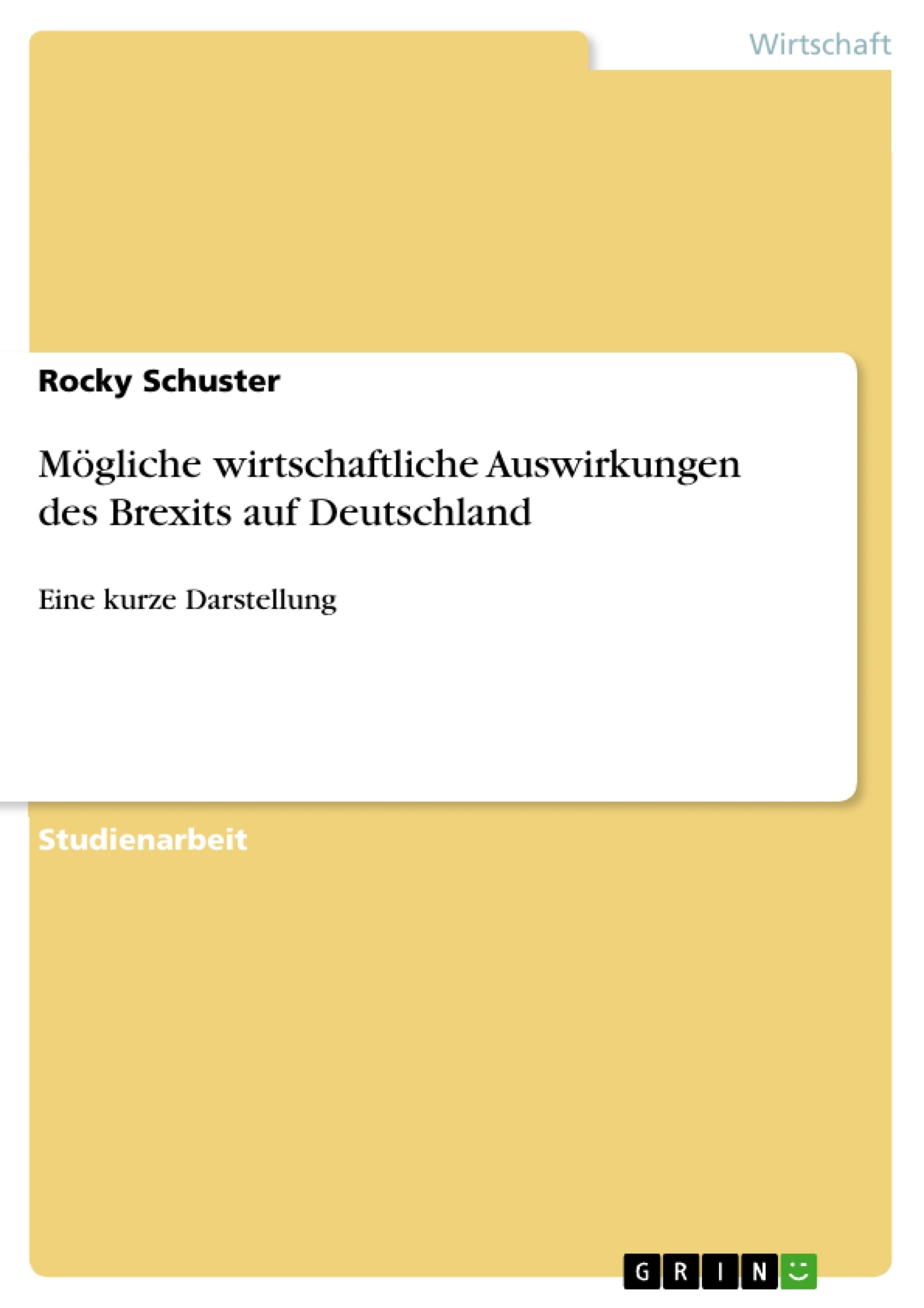Die Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union befassen. Hierbei wird besonders auf die wirtschaftlichen Auswirkungen in Deutschland geachtet. Um die Frage nach den möglichen Auswirkungen zu beantworten, sollten zuerst die Hintergründe des Brexits geklärt und die Ursachen und politischen Motivationen untersucht werden.
Hierzu findet man in den öffentlichen Medien ausreichend Informationen. Außerdem ist es besonders wichtig den grundlegenden Aufbau der deutschen Wirtschaft zu kennen, um Rückschlüsse auf die Auswirkungen für Deutschland ziehen zu können. Zu diesem Thema werden Hauptquellen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Statistischen Bundesamt herangezogen. Im Anschluss werden dann konkrete Auswirkungen zusammengetragen und erläutert. Diese Arbeit stützt sich ausschließlich auf andere Arbeiten sowie auf wissenschaftlichen Studien. Es werden daher keine grundlegend neuen Ansätze zu den Auswirkungen des Brexits beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Der Brexit erklärt
- 2.1 Was ist der Brexit
- 2.2 Warum wollen viele Briten einen Austritt
- 2.3 Die britische Wirtschaft
- 3 Die deutsche Wirtschaft
- 3.1 Die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik
- 3.2 Einblick in die deutsche Wirtschaft
- 3.3 Beziehung zum Vereinten Königreich
- 4 Mögliche Auswirkungen
- 4.1 Allgemeine Auswirkungen
- 4.1.1 Abwertung des britischen Pfund
- 4.1.2 Aktienkurseffekte
- 4.1.3 Direktinvestitionen
- 4.2 Auswirkungen auf Deutschland
- 4.1 Allgemeine Auswirkungen
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die potenziellen Auswirkungen des Brexits auf die deutsche Wirtschaft. Sie konzentriert sich auf die wirtschaftlichen Konsequenzen und untersucht, wie sich der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union auf verschiedene Aspekte der deutschen Wirtschaft auswirken könnte. Die Arbeit stützt sich dabei auf bestehende Forschung und wissenschaftliche Studien.
- Die Hintergründe und Ursachen des Brexits
- Die wirtschaftlichen Folgen des Brexits für das Vereinigte Königreich
- Die deutsche Wirtschaft und ihre Beziehungen zum Vereinigten Königreich
- Die möglichen Auswirkungen des Brexits auf die deutsche Wirtschaft, insbesondere auf den Finanzsektor, die Handelsbeziehungen und die Investitionslandschaft
- Eine Einschätzung der potenziellen Risiken und Chancen, die sich aus dem Brexit für Deutschland ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung
Dieses Kapitel führt in die Thematik des Brexits ein und verdeutlicht die Relevanz der Thematik im Kontext der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation. Es werden die Ziele der Arbeit erläutert und die Vorgehensweise zur Analyse der Auswirkungen des Brexits auf Deutschland skizziert.
- Kapitel 2: Der Brexit erklärt
Dieses Kapitel beleuchtet die Hintergründe und Ursachen des Brexits, insbesondere die Ergebnisse des Referendums in Großbritannien. Es werden die wichtigsten Argumente der Brexit-Befürworter und -Gegner vorgestellt und der politische Prozess des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union beleuchtet.
- Kapitel 3: Die deutsche Wirtschaft
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die deutsche Wirtschaft, ihre Bedeutung als globaler Akteur und die enge Verflechtung mit dem Vereinigten Königreich. Es werden wichtige Wirtschaftsindikatoren und die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien analysiert.
- Kapitel 4: Mögliche Auswirkungen
Dieses Kapitel untersucht die möglichen Auswirkungen des Brexits auf die deutsche Wirtschaft. Es analysiert sowohl allgemeine Auswirkungen auf den globalen Wirtschaftsraum als auch spezifische Folgen für Deutschland. Dazu gehören u.a. Veränderungen im Finanzsektor, Handelsbeziehungen und Direktinvestitionen.
Schlüsselwörter
Brexit, Europäische Union, Vereinigte Königreich, Deutschland, Wirtschaft, Handel, Finanzsektor, Investitionen, Direktinvestitionen, wirtschaftliche Entwicklung, politische Motivationen, wirtschaftliche Auswirkungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat der Brexit auf Deutschland?
Der Brexit beeinflusst Deutschland vor allem durch Veränderungen in den Handelsbeziehungen, mögliche Zölle, Schwankungen bei Direktinvestitionen und Auswirkungen auf den Finanzsektor.
Warum wollten viele Briten den Austritt aus der EU?
Die Motivationen waren vielfältig und umfassten den Wunsch nach nationaler Souveränität, Kritik an der EU-Bürokratie, Fragen der Zuwanderung und die Hoffnung auf eigenständige globale Handelsverträge.
Wie wichtig ist das Vereinigte Königreich als Handelspartner für Deutschland?
Großbritannien war historisch einer der wichtigsten Exportmärkte für deutsche Produkte (z.B. Automobile). Der Brexit erschwert diesen Zugang durch bürokratische Hürden und Währungsschwankungen.
Welche Rolle spielt die Abwertung des britischen Pfunds?
Eine Abwertung des Pfunds macht deutsche Exporte nach Großbritannien teurer, was die Nachfrage senken kann, während britische Waren in Deutschland günstiger werden.
Gibt es Chancen für Deutschland durch den Brexit?
Einige Studien sehen Chancen durch die Verlagerung von Finanzdienstleistungen von London nach Frankfurt oder durch verstärkte Direktinvestitionen innerhalb der verbleibenden EU.
- Quote paper
- Rocky Schuster (Author), 2019, Mögliche wirtschaftliche Auswirkungen des Brexits auf Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956541