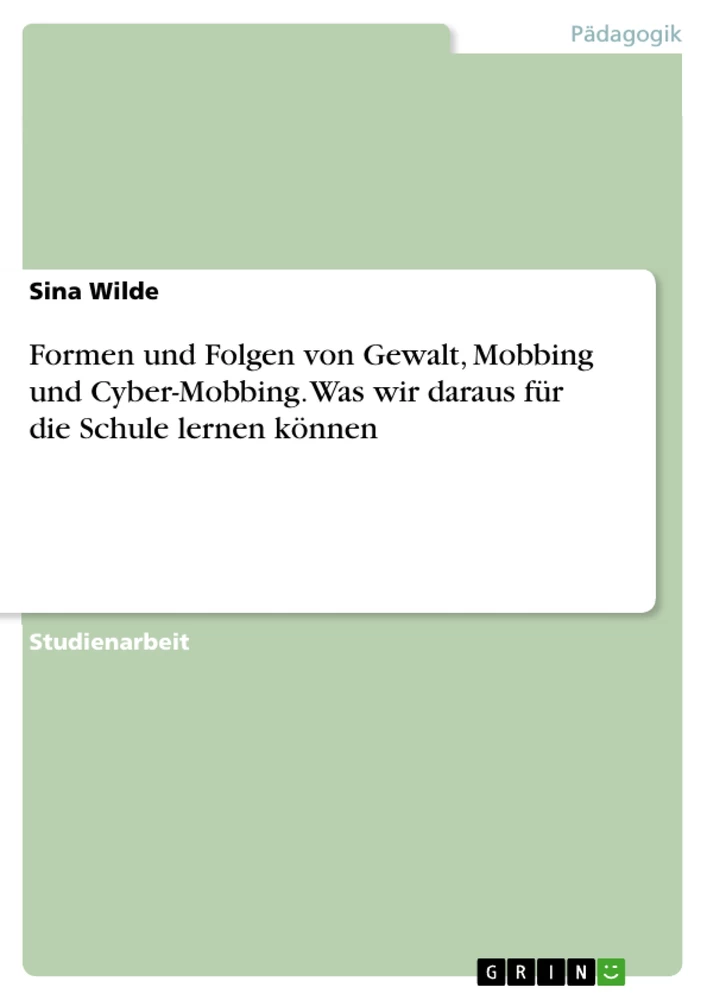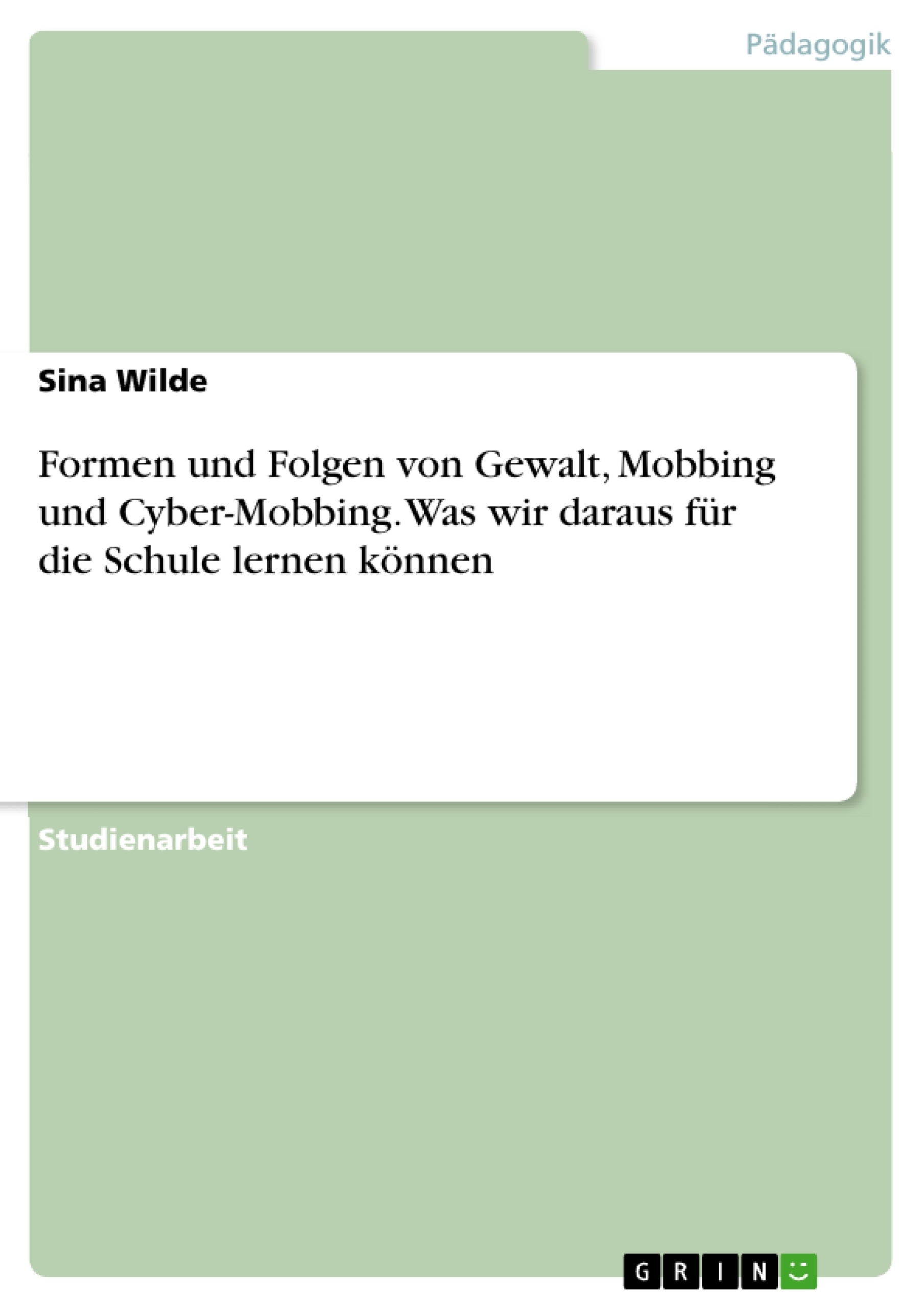Diese Arbeit, erstellt im Rahmen der brandenburgischen Lehrerausbildung, geht der Frage nach, welche Ausdrucksformen von Gewalt und Mobbing man im Allgemeinen unterscheidet und welche Möglichkeiten der Mobbing-Prävention und Intervention es für Schulen gibt.
Zuallererst erfolgt der Versuch einer Begriffsdefinition und Begriffsdifferenzierung von Gewalt, Mobbing und Cyber-Mobbing. Danach folgt eine Untersuchung der verschiedenen Erscheinungsformen und der Folgen von Gewalt und (Cyber-)Mobbing und anschließend folgt eine Betrachtung von Interventions- und Präventionsstrategien bei Mobbing und welche Probleme vonseiten der Lehrer*innen einer erfolgreichen Intervention dabei im Weg stehen können, und wie hoch die Erfolgsrate der verschiedenen Interventionsstrategien ist. Dem schließt sich ein Fazit an, welches das untersuchte Themenfeld noch einmal ab-schließend zusammenfasst.
"Gewalt unter den Kleinsten" titelt 2018 die ZEIT in einem Artikel des Journalisten Parvin Sadigh. Darin heißt es, Aggressionen und Gewaltausbrüche seien jetzt sogar unter Grundschülern keine Seltenheit mehr, welche "Eisenstangen aus dem Schulhofboden [reißen] und einander Platzwunden [verpassen]" würden. Dennoch nehme die körperliche Gewalt laut Marie Christine Bergmann, Soziologin und Beraterin der Polizei Niedersachsen, eher ab, dafür steige die Zahl psychischer Übergriffe im Netz durch Cyber-Mobbing. Doch die sinkende Zahl physischer Übergriffe bietet keinen Grund zur Entwarnung, ganz im Gegenteil. Insbesondere weil Cyber-Mobbing, also psychische Gewalt, ausgeübt in sozialen Netzwerken, Nachrichtendiensten und vielen mehr wesentlich gravierendere Folgen haben kann, aber oftmals nicht rechtzeitig oder schlimmstenfalls gar nicht erkannt wird, weil die Betroffenen sich nicht trauen darüber zu sprechen, da es ihnen zum einen oft zu peinlich ist und sie zum anderen Angst haben, dass sich die Gewalt dadurch verschlimmern könnte. Nicht ohne Grund beschäftigen sich die Erziehungswissenschaften seit Jahrzehnten mit den Ursachen, Auswirkungen und Interventions- und Präventionsmöglichkeiten von Mobbing. Die Ergebnisse ihrer Forschung werden dann im Schul- und Erziehungsalltag dem ultimativen Praxistest unterworfen, denn Fakt ist: Pädagogische Fachkräfte wie Erzieher*innen und Lehrer*innen sind spätestens dann gefordert, wenn Gewalt und Mobbing in ihren Klassenzimmern Einzug hält und Schüler*innen zu Opfern und/oder Tätern werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gewalt, Mobbing und Cybermobbing
- 2.1. Begriffsdefinitionen
- 2.2. Erscheinungsformen von Mobbing
- 2.3. Folgen von Mobbing
- 3. Interventions- und Präventionsstrategien bei Mobbing
- 3.1. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace - problematisches Verhalten von Lehrkräften
- 3.2. „Das Kind ist in den Brunnen gefallen.“ - Mobbing-Intervention oder -Prävention?
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Ausdrucksformen von Gewalt und Mobbing an Schulen und beleuchtet Möglichkeiten der Prävention und Intervention. Ziel ist es, angehenden Lehrkräften ein umfassendes Verständnis der Thematik zu vermitteln, um ein aufmerksames und effektives Handeln im Schulalltag zu ermöglichen. Die Arbeit fokussiert auf die Unterscheidung verschiedener Gewaltformen, die Folgen von Mobbing und die Herausforderungen bei der Intervention.
- Begriffsdefinitionen und Abgrenzung von Gewalt, Mobbing und Cybermobbing
- Erscheinungsformen und Folgen von Mobbing und Cybermobbing
- Interventions- und Präventionsstrategien bei Mobbing an Schulen
- Herausforderungen bei der Intervention durch Lehrkräfte
- Erfolgsaussichten von Interventionsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert den aktuellen Stand der Diskussion um Gewalt und Cybermobbing an Schulen, insbesondere die steigende Bedeutung von Cybermobbing und seine verheerenden Folgen, die bis hin zum Suizid reichen können. Sie betont die Notwendigkeit von Früherkennung und Prävention und führt in die Thematik der Arbeit ein, die sich mit der Definition, den Erscheinungsformen, Folgen und Interventionsmöglichkeiten von Mobbing auseinandersetzt. Die Einleitung verweist auf aktuelle Fallbeispiele, um die Dringlichkeit des Themas zu verdeutlichen und den Leser für die Komplexität der Problematik zu sensibilisieren.
2. Gewalt, Mobbing und Cybermobbing: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Auseinandersetzung mit den Begriffen Gewalt, Mobbing und Cybermobbing. Es differenziert zwischen Aggression, Gewalt und Mobbing und definiert diese Begriffe präzise, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Definitionen aus der Fachliteratur. Es werden verschiedene Formen von Gewalt, einschließlich enger und weiter Definitionen, diskutiert, wobei der Fokus auf den weiter gefassten Gewaltbegriff liegt, der die Schädigung und deren Folgen in den Vordergrund stellt. Der Unterschied zwischen physischer und psychischer Gewalt wird ebenfalls herausgearbeitet. Das Kapitel bildet die Grundlage für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel.
Schlüsselwörter
Gewalt, Mobbing, Cybermobbing, Prävention, Intervention, Schule, Lehrkräfte, Aggression, psychische Gewalt, physische Gewalt, Begriffsdefinitionen, Folgen von Mobbing, Interventionsstrategien.
Häufig gestellte Fragen zu: Gewalt, Mobbing und Cybermobbing an Schulen - Prävention und Intervention
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über Gewalt, Mobbing und Cybermobbing an Schulen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition der Begriffe, den Erscheinungsformen und Folgen von Mobbing, sowie auf Interventions- und Präventionsstrategien. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle von Lehrkräften bei der Intervention gewidmet.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind: Begriffsdefinitionen und Abgrenzung von Gewalt, Mobbing und Cybermobbing; Erscheinungsformen und Folgen von Mobbing und Cybermobbing; Interventions- und Präventionsstrategien an Schulen; Herausforderungen bei der Intervention durch Lehrkräfte; und die Erfolgsaussichten von Interventionsstrategien. Das Dokument untersucht auch die Rolle problematischen Lehrerverhaltens und die Frage nach Intervention versus Prävention.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Gewalt, Mobbing und Cybermobbing (inkl. Begriffsdefinitionen, Erscheinungsformen und Folgen), Interventions- und Präventionsstrategien bei Mobbing (inkl. der Rolle von Lehrkräften), und Fazit.
Wie werden Gewalt, Mobbing und Cybermobbing definiert?
Das Dokument bietet präzise Definitionen von Gewalt, Mobbing und Cybermobbing, unter Berücksichtigung verschiedener Definitionen aus der Fachliteratur. Es differenziert zwischen Aggression, Gewalt und Mobbing und unterscheidet zwischen physischer und psychischer Gewalt, wobei der weiter gefasste Gewaltbegriff, der die Schädigung und deren Folgen in den Vordergrund stellt, im Fokus steht.
Welche Folgen von Mobbing werden behandelt?
Das Dokument beschreibt die verheerenden Folgen von Mobbing, die bis hin zum Suizid reichen können. Es betont die Notwendigkeit von Früherkennung und Prävention.
Welche Interventions- und Präventionsstrategien werden vorgestellt?
Das Dokument beleuchtet verschiedene Interventions- und Präventionsstrategien bei Mobbing an Schulen. Es diskutiert Herausforderungen bei der Intervention durch Lehrkräfte und die Erfolgsaussichten verschiedener Strategien. Die Rolle des Lehrerverhaltens und die Frage nach der optimalen Vorgehensweise (Intervention oder Prävention) werden thematisiert.
Wer ist die Zielgruppe dieses Dokuments?
Die Zielgruppe sind angehenden Lehrkräfte, denen ein umfassendes Verständnis der Thematik vermittelt werden soll, um ein aufmerksames und effektives Handeln im Schulalltag zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gewalt, Mobbing, Cybermobbing, Prävention, Intervention, Schule, Lehrkräfte, Aggression, psychische Gewalt, physische Gewalt, Begriffsdefinitionen, Folgen von Mobbing, Interventionsstrategien.
- Quote paper
- Sina Wilde (Author), 2020, Formen und Folgen von Gewalt, Mobbing und Cyber-Mobbing. Was wir daraus für die Schule lernen können, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956743