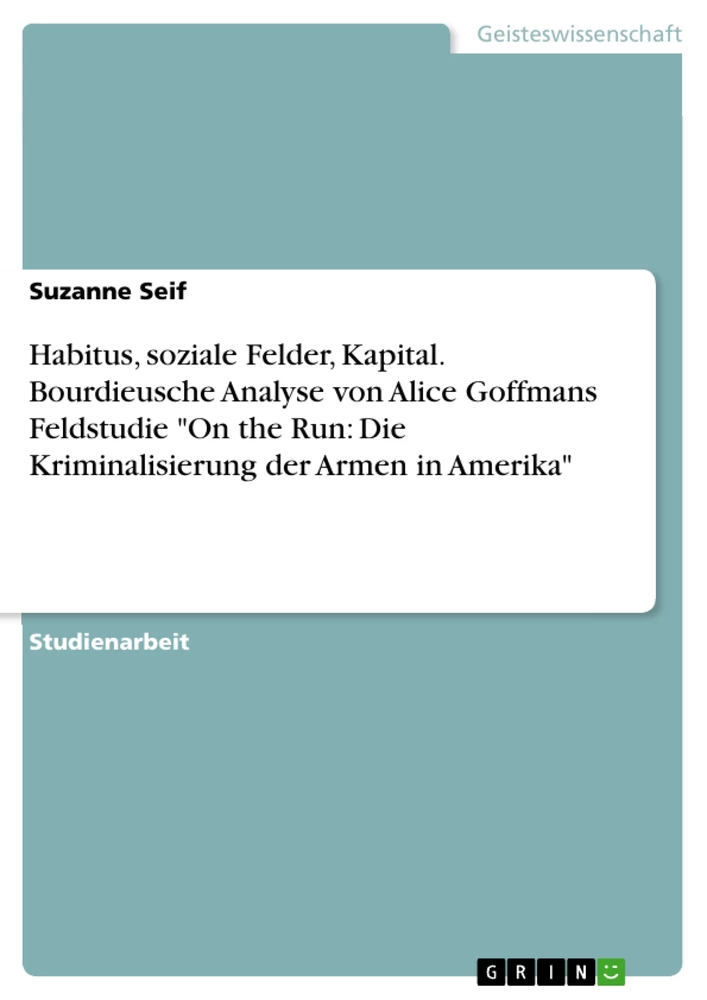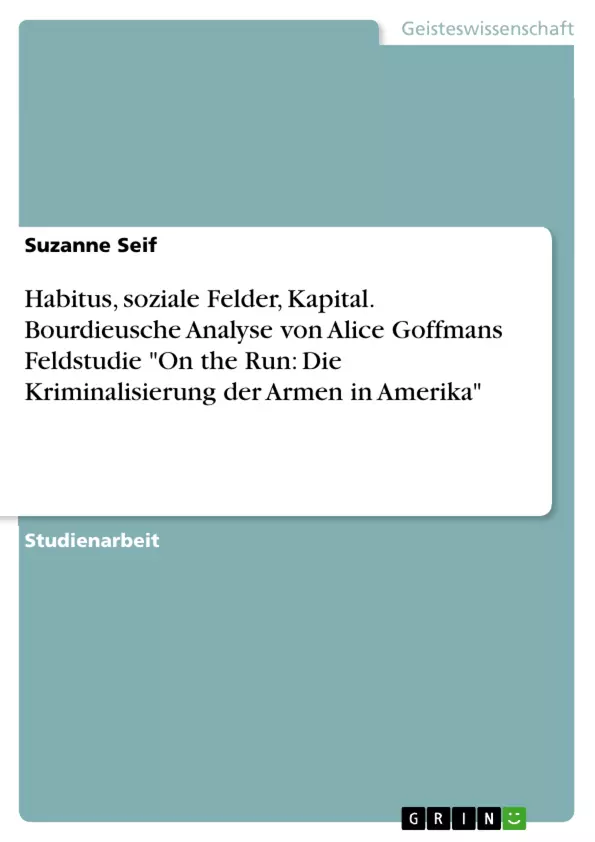Im Zuge dieser Arbeit wurde sich dem ethnografischem Material mittels der bourdieuschen Habitus-Theorie genähert. Ob und inwieweit sich die Kategorien Habitus, Feld und insbesondere Kapital zur Analyse des vorliegenden Materials Goffmans eignet, wird im Folgenden anhand von ausgewählten Beispielen untersucht. Kapitel 1 geht daher exkursartig auf die theoretischen Grundlagen der Konzepte Pierre Bourdieus ein. Zunächst werden die drei Begrifflichkeiten – Habitus, soziale Felder, Kapital – rekonstruiert, sowie wesentliche Aspekte dieser herausgearbeitet. Anknüpfend an eine kurze Inhaltsangabe der Feldstudie „On The Run“ wird dargestellt, ob und wo sich Habitus und Kapitalformen im vorliegenden ethnografischen Material verorten lassen. Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen und kritisch resümiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu
- Habitus
- Soziale Felder
- Kapital
- „On The Run“ - eine Feldstudie von Alice Goffmann
- Analyse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse von Alice Goffmans Feldstudie „On The Run: Fugitive Life in an American City“ durch die Anwendung der Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu. Ziel ist es, die Kategorien Habitus, Feld und insbesondere Kapital auf Goffmans ethnografisches Material anzuwenden, um die soziale Wirklichkeit der Schwarzen Bevölkerung in den USA zu verstehen.
- Der Einfluss des Habitus auf die Lebenswelt der Schwarzen Bevölkerung
- Die Bedeutung sozialer Felder und Kapitalformen in der Kriminalisierung der Armen
- Die Auswirkungen von Drogen, Polizeigewalt und fehlender Sozialpolitik auf die Lebensbedingungen der Schwarzen Bevölkerung
- Die Rolle des Staates in der Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Die Anwendung der Habitus-Theorie als analytisches Werkzeug für die Untersuchung sozialer Phänomene
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die theoretischen Grundlagen der Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu vor. Es werden die zentralen Konzepte Habitus, soziale Felder und Kapital erläutert, um die Bedeutung dieser für die Analyse von sozialer Ungleichheit hervorzuheben. Kapitel 2 beleuchtet die Feldstudie „On The Run“ von Alice Goffmann und untersucht, ob und inwieweit sich die bourdieuschen Konzepte auf die Lebensrealität der Schwarzen Bevölkerung in den USA anwenden lassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Habitus-Theorie, der Kriminalisierung von Armut und der sozialen Ungleichheit. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Habitus, soziale Felder, Kapital, Kriminalisierung, soziale Ungleichheit, Polizeigewalt, Diskriminierung, Schwarze Bevölkerung, ethnographische Feldforschung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Alice Goffmans Studie „On the Run“?
Die ethnografische Feldstudie untersucht das Leben armer schwarzer Bevölkerungsschichten in den USA und deren Kriminalisierung durch das Justizsystem.
Wie wird Bourdieus Habitus-Theorie hier angewendet?
Die Arbeit analysiert Goffmans Material mittels der Kategorien Habitus, Feld und Kapital, um die tieferliegenden sozialen Strukturen der Benachteiligung aufzuzeigen.
Was bedeutet der Begriff „Soziale Felder“ bei Bourdieu?
Soziale Felder sind gesellschaftliche Teilbereiche (wie das Rechtssystem oder die Straße), in denen Individuen um Macht und Ressourcen kämpfen.
Welche Rolle spielt Polizeigewalt in der Studie?
Die Arbeit beleuchtet, wie Polizeigewalt und ständige Überwachung den Habitus der Betroffenen prägen und zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beitragen.
Was ist das Fazit der Analyse?
Die Kategorien Bourdieus eignen sich gut, um die Kriminalisierung der Armen als strukturelles Problem und nicht als individuelles Versagen zu verstehen.
- Quote paper
- Suzanne Seif (Author), 2020, Habitus, soziale Felder, Kapital. Bourdieusche Analyse von Alice Goffmans Feldstudie "On the Run: Die Kriminalisierung der Armen in Amerika", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956832