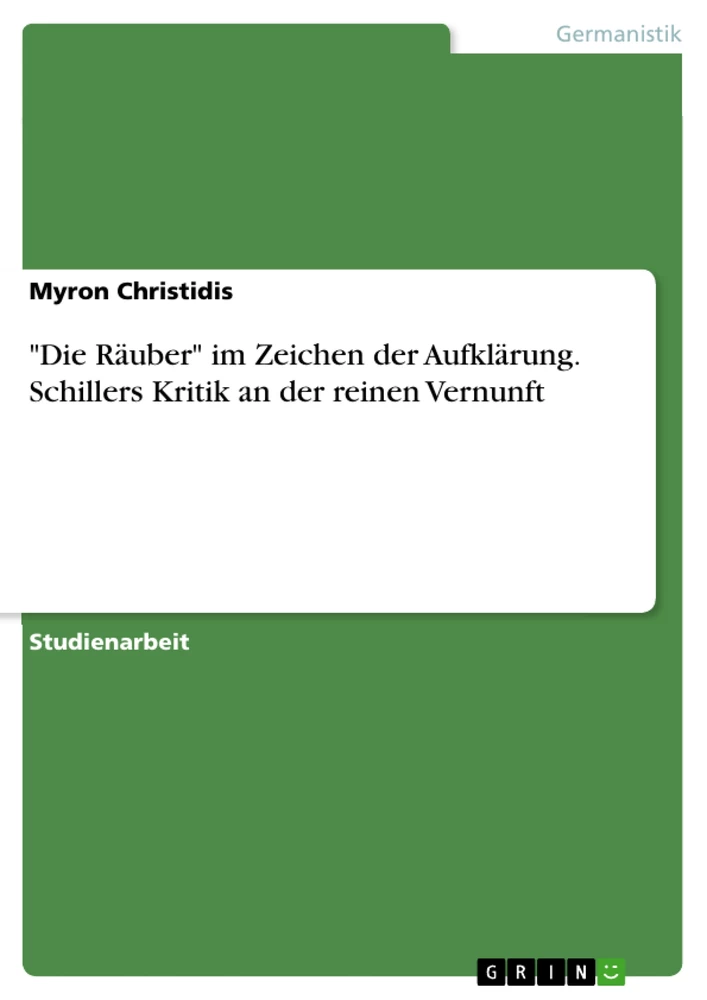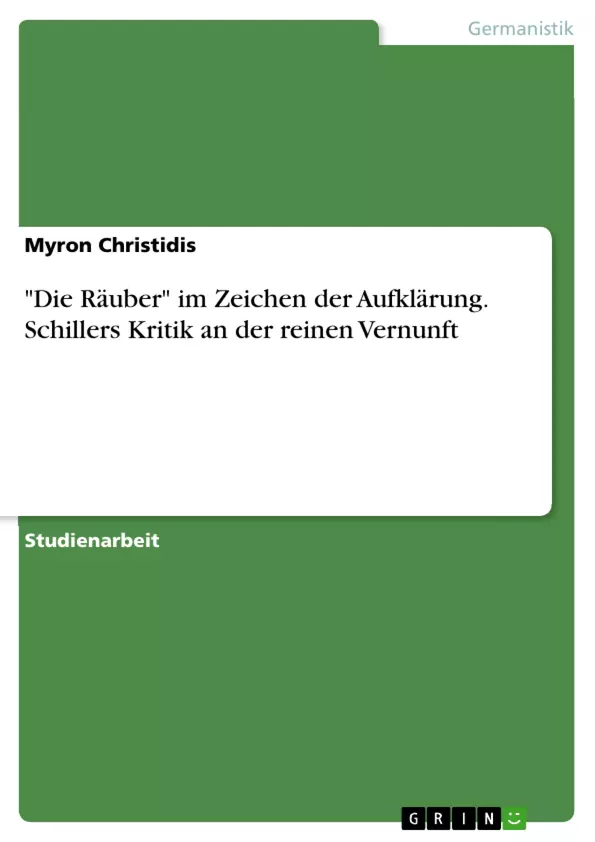Durch die Brüder Moor kritisiert und hinterfragt Schiller die Umstände und vorherrschenden Anschauungen seiner Zeit. Er legt dabei besonderen Fokus auf die Ideen der Aufklärung. Diese Arbeit soll durch nähere Betrachtung der Figuren Franz und Karl Moor und ihrer Denkweisen, Handlungen und Motive diese Kritik demonstrieren und konkretisieren.
"Ein fränkischer Graf, Maximilian von Moor, ist Vater von zween Söhnen, Karl und Franz, die sich an Charakter sehr unähnlich sind. Karl, der ältere, ein Jüngling voll Talenten und Edelmut, gerät zu Leipzig in einen Zirkel lüderlicher Brüder, stürzt in Exzesse und Schulden, muß zuletzt mit einem Trupp seiner Spießgesellen aus Leipzig entfliehen. Unterdes lebte Franz, der jüngere, zu Hause beim Vater, und da er heimtückischer schadenfroher Gemütsart war, wußte er die Zeitungen von den Lüderlichkeiten seines Bruders zu seinem eigenen Vorteil zu verschlimmern."
Mit diesen Worten beginnt Friedrich Schiller die Selbstrezension seiner Räuber, welche 1782 anonym veröffentlicht wurde. Schiller inszeniert Karl Moor als den heldenhaften, doch unglücklichen Protagonisten, seinen Bruder Franz als den bösartigen und raffinierten Gegenspieler. Die mitgeteilten Gedanken und Handlungen der beiden Brüder im Verlauf des Dramas und auch Schillers eigene Vorrede suggerieren jedoch, dass sich sowohl Franz als auch Karl als „unmoralische Charaktere“ verstehen lassen und auch als solche erdacht sind. Franz entpuppt sich schon früh als Bösewicht, da er den Leser bereits im ersten Akt mittels eines Monologs in seine Pläne einweiht, seinen Vater loszuwerden und dessen Besitz an sich zu reißen. Durch seine rationale Denkweise und klaren Ausführungen erweist er sich in diesem und weiteren Monologen zudem als Vertreter der Aufklärung. Ich werde mich bei der Analyse besonders auf La Mettries Materialismus und Immanuel Kants Definition der Aufklärung beziehen, nach welcher diese einen „Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“ bietet. Karl Moor findet einen solchen Ausgang zunächst unfreiwillig. Im Gegensatz zu Franz stellt er sich als impulsive und emotionale Figur heraus – er scheint seinem Bruder in keiner Hinsicht zu gleichen. Schiller meint seinem Publikum in Karl Moor einen tragischen Helden zu präsentieren, der aus den vermeintlich richtigen Gründen die falschen Entscheidungen trifft. So wird er von seinem Bruder getäuscht und avanciert prompt zum Anführer der raubenden und mordenden Räuberbande, die dem Drama seinen Namen verlieh.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Franz, das „majestätische Ungeheuer“
- Absage an die „Blutliebe“
- Franz Ausgang aus der Unmündigkeit
- Die Angst vor dem „,Götzen des Pöbels“
- Karl, der „ehrwürdige Missetäter“
- Karl über das „schlappe Kastratenjahrhundert“
- Der Robin Hood der böhmischen Wälder
- Die Rückkehr in das „Geleise der Gesetze“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Schillers „Die Räuber“ im Kontext der Aufklärung und untersucht die Kritik an der reinen Vernunft, die das Stück durch die Figuren Franz und Karl Moor artikuliert. Das Werk dient als Plattform, um die Auswirkungen der Aufklärungsideen auf die menschliche Moral und die soziale Ordnung zu beleuchten.
- Kritik an der reinen Vernunft und deren Auswirkungen auf die Moral
- Die Rolle der Familie und die „Blutliebe“ im Kontext der Aufklärung
- Franz Moor als Vertreter einer radikalen Vernunftphilosophie
- Karls Entwicklung vom „ehrwürdigen Missetäter“ zum „Götzen des Pöbels“
- Die Ambivalenz des Bösen und die Faszination des „majestätischen Ungeheuers“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Schillers „Die Räuber“ und seine Figuren Karl und Franz Moor im Kontext der Aufklärung vor. Sie beleuchtet die Ambivalenz der Charaktere und ihre unterschiedlichen Beziehungen zur Vernunft.
Im zweiten Kapitel wird Franz Moor als „majestätisches Ungeheuer“ und seine radikale Vernunftphilosophie untersucht. Seine Absage an die „Blutliebe“ und seine Überzeugung, dass das Recht beim Überwältiger wohnt, werden im Kontext der Aufklärungsideen und der materialistischen Lehre nach La Mettrie beleuchtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Karl Moor, dem „ehrwürdigen Missetäter“. Seine Kritik am „schlappen Kastratenjahrhundert“ und seine Rolle als Robin Hood der böhmischen Wälder werden erörtert. Die Kapitel behandelt auch die Rückkehr Karls in das „Geleise der Gesetze“ und die Auswirkungen seiner Handlungen auf die Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit analysiert Schillers „Die Räuber“ unter den Schlüsselbegriffen Aufklärung, Vernunft, Moral, Familie, „Blutliebe“, Franz Moor, Karl Moor, „majestätisches Ungeheuer“, „ehrwürdiger Missetäter“, Materialismus, La Mettrie, Kant, Böses, Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Schiller in „Die Räuber“?
Schiller hinterfragt die radikalen Ideen der Aufklärung und kritisiert eine „reine Vernunft“, die moralische Bindungen und familiäre Gefühle ignoriert.
Inwiefern ist Franz Moor ein Vertreter der Aufklärung?
Franz nutzt eine kalte, rationale Logik und materialistische Philosophien (wie die von La Mettrie), um Verbrechen zu rechtfertigen und sich von der „Unmündigkeit“ loszusagen.
Warum wird Karl Moor als „ehrwürdiger Missetäter“ bezeichnet?
Karl handelt aus edlen Motiven und Empörung über ein „schlappes Kastratenjahrhundert“, begeht dabei jedoch als Räuberhauptmann schwere Verbrechen.
Was bedeutet der Begriff „Blutliebe“ im Stück?
Die „Blutliebe“ bezeichnet die natürliche Bindung zwischen Familienmitgliedern, die Franz Moor als bloße Gewohnheit abtut und rational dekonstruiert.
Welchen Einfluss hat Immanuel Kant auf die Interpretation?
Kants Definition der Aufklärung als „Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“ dient als Rahmen, um Franz Moors radikale Emanzipation von Gott und Gesetz zu analysieren.
- Quote paper
- Myron Christidis (Author), 2020, "Die Räuber" im Zeichen der Aufklärung. Schillers Kritik an der reinen Vernunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956854