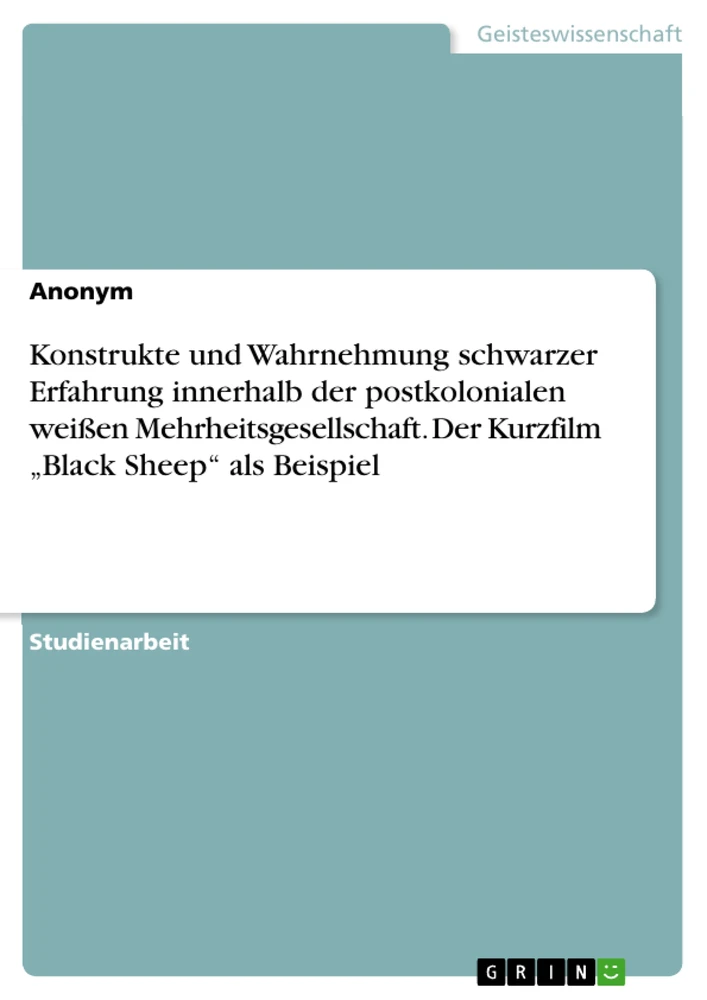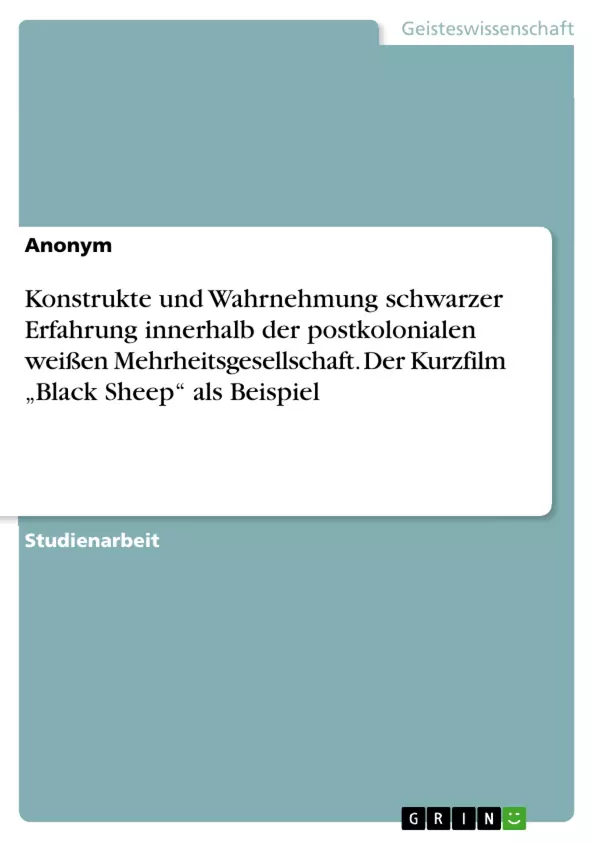In dieser Arbeit geht es um die Vergegenwärtigung von Frantz Fanons Untersuchungen in "Schwarze Haut, weiße Maske" anhand einer Analyse des Kurzfilms „Black Sheep“. Der dargestellte Cornelius Walker bildet ein Individualschicksal ab. Gerade dieses wird versucht, mit der Arbeit auf theoretischer Ebene zu betrachten und Fanons Untersuchungen zu rahmen. Man beabsichtigt den deskriptiven, fremdwahrnehmenden Charakter einer Untersuchung der Lebensrealität, eine subjektive Erkenntnisquelle gegenüberzusetzen. Als Leitgedanke Fanons Arbeit und der Analyse zieht sich der Anspruch die schwarze Erfahrung nicht isoliert von realen Umständen zu betrachten. Zu Beginn soll Fanons Konzept der erlebten Erfahrung schwarzer Menschen dargestellt werden. Anschließend wende ich diese Beobachtungen auf den Kurzfilm an.
Die Debatte um das Schwarzsein und Otherness gewinnt in heutigen medialen und gesellschaftlichen Diskursen an Aufwind. In Ausschluss der Betroffenen ist ein Nachempfinden schwarzen Daseins in weißen Mehrheitsgesellschaften fern von Realitätssinn. Stimmen schwarzer Individuen bieten einen Zugang zur phänomenologischen Wahrnehmung.
Wir leben in einer postkolonialen Welt. Die Machtverhältnisse dieser Weltordnung sind ein direktes Produkt des Unterjochens des globalen Südens. Strategien weißer Hegemonie und die Vereinnahmung und Unterdrückung schwarzer Völker sind Kollektiverfahrungen der afrikanischen Diaspora. Eine medien- und kulturwissenschaftliche Betrachtung und Analyse dieses Phänomens ermöglicht das 1952 veröffentlichte Werk "Schwarze Haut, Weiße Masken".
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Frantz Fanons „Schwarze Haut, Weiße Masken“
- II.I. Der Minderwertigkeitskomplex schwarzer Menschen
- II.II Mythologie und Mystifizierung
- II.III Kulturelle Assimilation und Selbstentfremdung
- III. Remembering Fanon
- IV. Die Wahrnehmung des Schwarzseins anhand des Kurzfilms „Black Sheep“
- IV.I. Die Minderwertigkeitsgefühle Cornelius Walkers
- IV.II. Der Einfluss mythenträchtiger Glaubenssätze auf Walkers Selbstwahrnehmung
- IV.III. Cornelius Walkers Anpassungswille
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion und Wahrnehmung schwarzer Erfahrung innerhalb der postkolonialen weißen Mehrheitsgesellschaft. Sie analysiert, wie internalisierte rassistische Muster die Identität und das Selbstwertgefühl schwarzer Menschen prägen. Der Fokus liegt auf der Anwendung der Theorien Frantz Fanons auf den Kurzfilm „Black Sheep“, um individuelle Schicksale im Kontext gesellschaftlicher Strukturen zu beleuchten.
- Die Konstruktion des „Schwarzseins“ in der postkolonialen Gesellschaft
- Internalisierte Rassismus und seine Auswirkungen auf die Identität
- Die Rolle von Mythos und Stereotypen in der Selbstwahrnehmung schwarzer Menschen
- Der Einfluss kolonialer Machtstrukturen auf die psychische Verfassung
- Die Anwendung von Fanons Theorie auf ein individuelles Beispiel im Kurzfilm „Black Sheep“
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der postkolonialen Machtverhältnisse und der Konstruktion schwarzer Identität ein. Sie stellt Frantz Fanon und Homi Bhabha als zentrale Bezugspunkte vor und erläutert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die subjektive Erfahrung schwarzer Menschen in den Mittelpunkt stellt und Fanons Werk mit der Analyse des Kurzfilms „Black Sheep“ verbindet. Die Autorin betont ihre eigene Positionierung als afrodeutsche Frau und die Notwendigkeit, die Perspektive der Betroffenen zu berücksichtigen, um ein realistisches Verständnis des Themas zu erlangen. Die Arbeit zielt darauf ab, Fanons Konzept der erlebten Erfahrung schwarzer Menschen darzustellen und auf den Kurzfilm anzuwenden, wobei Fanons Ablehnung jeglicher Objektivität in der Untersuchung hervorgehoben wird.
II. Frantz Fanons „Schwarze Haut, Weiße Masken“: Dieses Kapitel analysiert Fanons Werk „Schwarze Haut, Weiße Masken“. Es beschreibt Fanons Kritik an der wissenschaftlichen Begründung rassistischer Ideologien und dessen Bemühen, den irrationalen Rassenhass zu widerlegen. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Minderwertigkeitskomplexes schwarzer Menschen, der aus der Erfahrung kolonialer Unterdrückung und der Internalisierung weißer Überlegenheitsvorstellungen resultiert. Fanon beleuchtet, wie die „Nicht-Valorisierung“ des schwarzen Selbst in der weißen Mehrheitsgesellschaft zu einer tiefen Zerrüttung der Identität führt und ein pathologisches Verhältnis zum Selbst hervorruft. Das Kapitel veranschaulicht, wie die koloniale Erfahrung die ursprüngliche Kultur ersetzt und ein Gefühl der Unangepasstheit sowohl an schwarze als auch an weiße Identitätsangebote verursacht.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse Schwarzer Erfahrung in der Postkolonialen Gesellschaft
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion und Wahrnehmung schwarzer Erfahrung innerhalb der postkolonialen weißen Mehrheitsgesellschaft. Sie analysiert, wie internalisierte rassistische Muster die Identität und das Selbstwertgefühl schwarzer Menschen prägen, und konzentriert sich dabei auf die Anwendung der Theorien Frantz Fanons auf den Kurzfilm „Black Sheep“.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich zentral auf die Theorien von Frantz Fanon, insbesondere dessen Werk „Schwarze Haut, Weiße Masken“. Sie untersucht, wie Fanons Konzepte zur Erklärung der individuellen Erfahrungen im Kurzfilm „Black Sheep“ angewendet werden können.
Welche Aspekte von Fanons Werk werden behandelt?
Die Analyse von Fanons Werk umfasst dessen Kritik an wissenschaftlichen Rechtfertigungen rassistischer Ideologien, die Untersuchung des Minderwertigkeitskomplexes schwarzer Menschen, die Auswirkungen der Internalisierung weißer Überlegenheitsvorstellungen, die „Nicht-Valorisierung“ des schwarzen Selbst und die daraus resultierende Identitätskrise.
Welche Rolle spielt der Kurzfilm „Black Sheep“?
Der Kurzfilm „Black Sheep“ dient als Fallbeispiel, um Fanons Theorien auf eine konkrete, individuelle Erfahrung anzuwenden. Die Analyse des Films beleuchtet, wie die im Film dargestellten Minderwertigkeitsgefühle, der Einfluss mythenträchtiger Glaubenssätze und der Anpassungswille des Protagonisten Cornelius Walker im Kontext der gesellschaftlichen Strukturen zu verstehen sind.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Analyse von Fanons „Schwarze Haut, Weiße Masken“, einem Kapitel, das sich mit dem Kurzfilm „Black Sheep“ befasst, und weiteren Kapiteln, die den Zusammenhang zwischen Fanons Theorie und dem Film herstellen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion des „Schwarzseins“, internalisierten Rassismus und dessen Auswirkungen auf die Identität, die Rolle von Mythen und Stereotypen in der Selbstwahrnehmung, den Einfluss kolonialer Machtstrukturen auf die psychische Verfassung und die Anwendung von Fanons Theorie auf das individuelle Beispiel im Kurzfilm.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz, der die subjektive Erfahrung schwarzer Menschen in den Mittelpunkt stellt und Fanons Werk mit der Analyse des Kurzfilms „Black Sheep“ verbindet. Die Autorin betont dabei ihre eigene Positionierung als afrodeutsche Frau und die Notwendigkeit, die Perspektive der Betroffenen zu berücksichtigen.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt den Inhalt jedes Kapitels detailliert, beginnend mit der Einleitung, die die Thematik und den methodischen Ansatz vorstellt. Es folgt eine Zusammenfassung der Analyse von Fanons Werk und der Anwendung seiner Theorien auf den Kurzfilm „Black Sheep“.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Konstrukte und Wahrnehmung schwarzer Erfahrung innerhalb der postkolonialen weißen Mehrheitsgesellschaft. Der Kurzfilm „Black Sheep“ als Beispiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957067