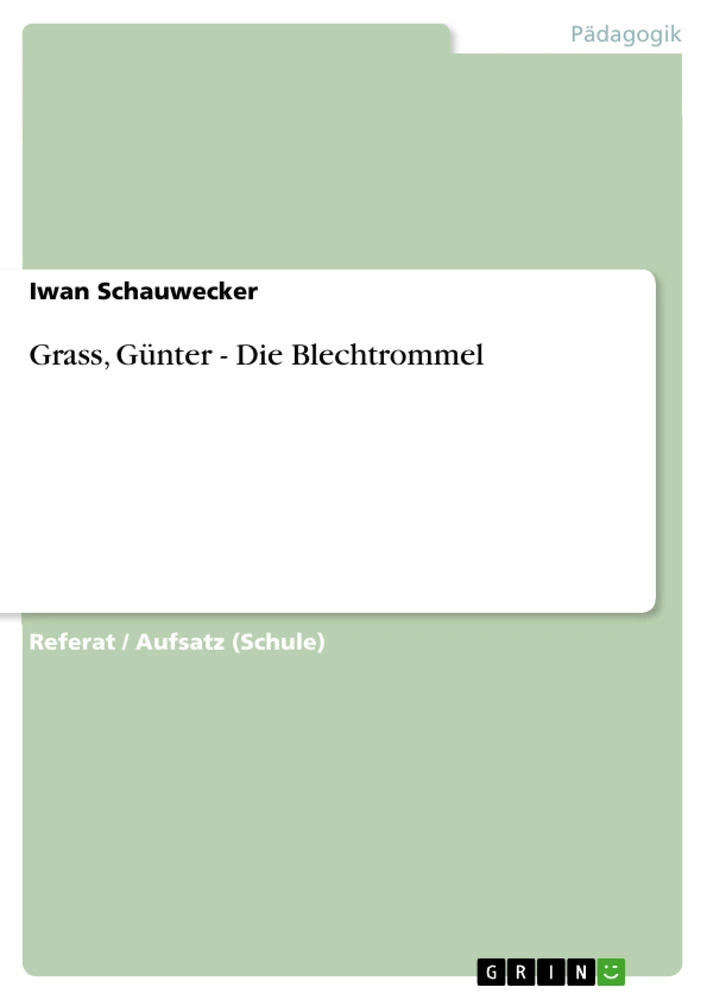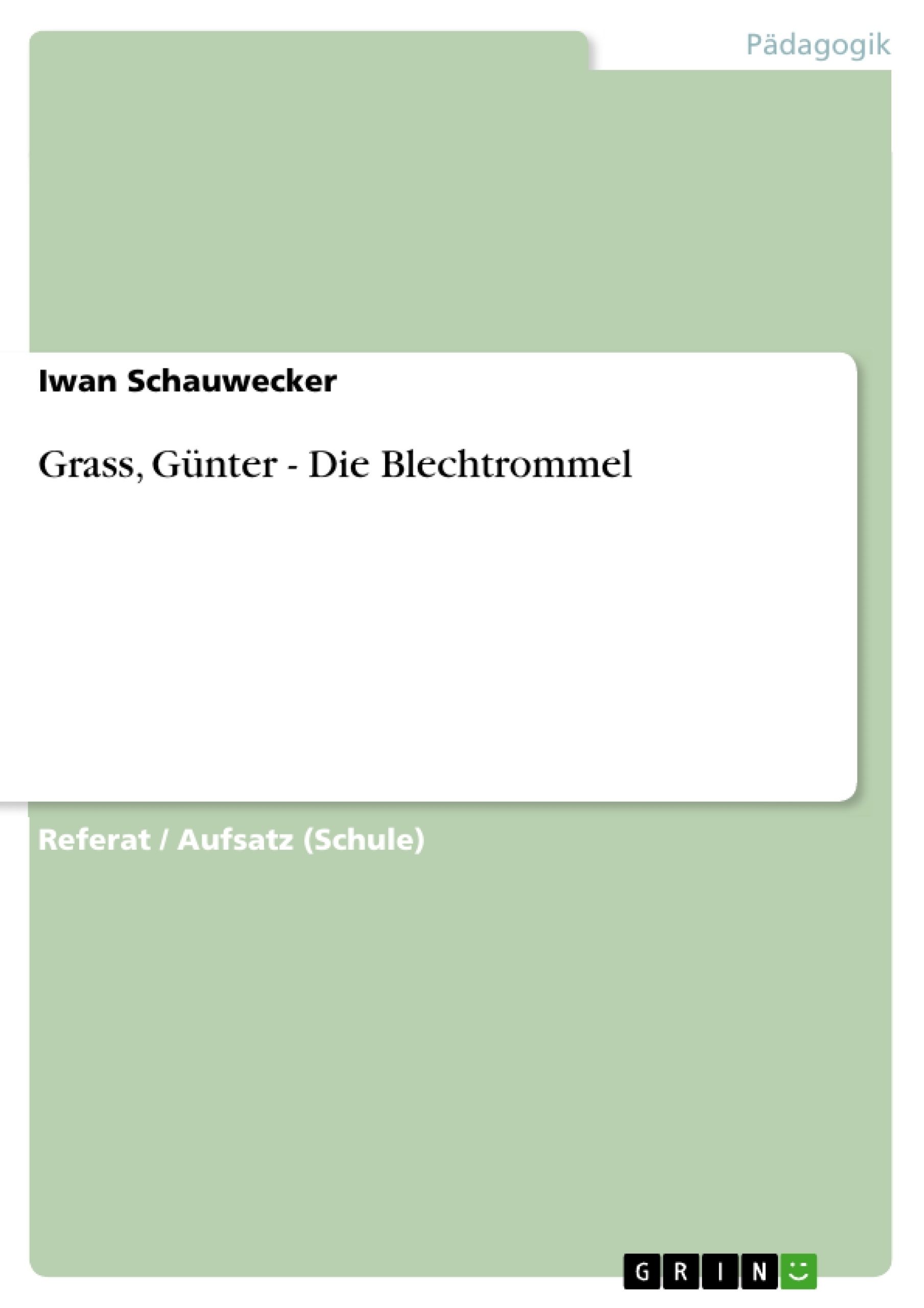Grass - Die Blechtrommel
Iwan Schauwecker
,,Was soll ich noch sagen: unter Glühbirnen geboren, im Alter von drei Jahren vorsätzlich das Wachstum unterbrochen, Trommel bekommen, Glas zersungen, Vanille gerochen, in Kirchen gehustet, Luzie gefüttert, Ameisen beobachtet, zum Wachstum entschlossen, Trommel begraben, nach Westen gefahren, den Osten verloren, Steinmetz gelernt und Modell gestanden, zur Trommel zurück und Beton besichtigt, Geld verdient und den Finger gehütet, den Finger verschenkt und lachend geflüchtet, aufgefahren, verhaftet, verurteilt, eingeliefert, demnächst freigesprochen, feiere ich heute meinen dreissigsten Geburtstag und fürchte mich immer noch vor der schwarzen Köchin - Amen. (p.705)
Dies das Fazit von Oskar, dem Hauptakteur, auf der zweitletzten Seite des Buches ,,Die Blechtrommel". Auch ich werde versuchen dieses verrückte Buch zusammenzufassen, sicher ein bisschen ausführlicher, jedoch kaum trefflicher als der gewählte Einstieg dies tut. Es ist schwierig oder fast unmöglich die Erlebnisse von Oskar auf einen Nenner zu bringen, weshalb ich mich auf die mir wichtig erscheinenden Szenen beschränken werde und diverse amüsante Nebenschauplätze, welche keinen direkten Einfluss auf die Hauptgeschichte haben, bewusst ausklammern werde. Zur Gliederung meines Vortrags: Zuerst hört ihr etwas zum Aufbau, dann eine kurze Biographie des Autors Günter Grass, dann die Zusammenfassung des Buches mit verschiedenen Einschüben und zum Schluss eine persönliche Interpretation und Betrachtungen zum Stil.
Aufbau:
Das Buch ist ziemlich klar gegliedert. Die Blechtrommel ist in drei Bücher aufgeteilt. Das erste Buch handelt von der Zeit vor dem 2.Weltkrieg in Danzig, Oskars Jugendgeschichte. Das zweite Buch von der Zeit während des 2.Weltkriegs und das dritte Buch von der Nachkriegszeit in Westdeutschland. Ausserdem ist das Buch in fast fünfzig Kapitel unterteilt, welche in ihrer Gesamtheit einen sehr genauen Einblick in die Lebensgeschichte von Oskar ermöglichen. Von 1952 bis 1954 schreibt Oskar seine Autobiographie nieder, immer wieder gibt es innerhalb seiner Geschichte Einschübe aus der Gegenwart, aus der Erzählzeit.
Manchmal wirken diese Einschübe ein bisschen verwirrend, aber im grossen Ganzen sind die Abläufe doch sehr gut verständlich.
Grass - Die Blechtrommel
Iwan Schauwecker
,,Was soll ich noch sagen: unter Glühbirnen geboren, im Alter von drei Jahren vorsätzlich das Wachstum unterbrochen, Trommel bekommen, Glas zersungen, Vanille gerochen, in Kirchen gehustet, Luzie gefüttert, Ameisen beobachtet, zum Wachstum entschlossen, Trommel begraben, nach Westen gefahren, den Osten verloren, Steinmetz gelernt und Modell gestanden, zur Trommel zurück und Beton besichtigt, Geld verdient und den Finger gehütet, den Finger verschenkt und lachend geflüchtet, aufgefahren, verhaftet, verurteilt, eingeliefert, demnächst freigesprochen, feiere ich heute meinen dreissigsten Geburtstag und fürchte mich immer noch vor der schwarzen Köchin - Amen. (p.705)
Dies das Fazit von Oskar, dem Hauptakteur, auf der zweitletzten Seite des Buches ,,Die Blechtrommel". Auch ich werde versuchen dieses verrückte Buch zusammenzufassen, sicher ein bisschen ausführlicher, jedoch kaum trefflicher als der gewählte Einstieg dies tut. Es ist schwierig oder fast unmöglich die Erlebnisse von Oskar auf einen Nenner zu bringen, weshalb ich mich auf die mir wichtig erscheinenden Szenen beschränken werde und diverse amüsante Nebenschauplätze, welche keinen direkten Einfluss auf die Hauptgeschichte haben, bewusst ausklammern werde. Zur Gliederung meines Vortrags: Zuerst hört ihr etwas zum Aufbau, dann eine kurze Biographie des Autors Günter Grass, dann die Zusammenfassung des Buches mit verschiedenen Einschüben und zum Schluss eine persönliche Interpretation und Betrachtungen zum Stil.
Aufbau:
Das Buch ist ziemlich klar gegliedert. Die Blechtrommel ist in drei Bücher aufgeteilt. Das erste Buch handelt von der Zeit vor dem 2.Weltkrieg in Danzig, Oskars Jugendgeschichte. Das zweite Buch von der Zeit während des 2.Weltkriegs und das dritte Buch von der Nachkriegszeit in Westdeutschland. Ausserdem ist das Buch in fast fünfzig Kapitel unterteilt, welche in ihrer Gesamtheit einen sehr genauen Einblick in die Lebensgeschichte von Oskar ermöglichen. Von 1952 bis 1954 schreibt Oskar seine Autobiographie nieder, immer wieder gibt es innerhalb seiner Geschichte Einschübe aus der Gegenwart, aus der Erzählzeit.
Manchmal wirken diese Einschübe ein bisschen verwirrend, aber im grossen Ganzen sind die Abläufe doch sehr gut verständlich.
·Karte, Folie
Biographie:
Günter Grass wurde am 16.Oktober 1927 in Danzig als Kind deutschpolnischer Eltern geboren. Notgedrungen Hitlerjunge, musste er 1944 auch noch Soldat werden. 1946 kam er nach kurzer Kriegsgefangenschaft in die britische Zone. In den folgenden Jahren schlug er sich als Bergarbeiter und Jazzmusiker durch und durchlief 1946-1949 eine Steinmetzlehre, auch war er an der Kunstakademie tätig. Erste Anerkennung als Schriftsteller fand Grass im Jahre 1955. Von 1956-1960 lebte Grass in Paris und schrieb während diesen Jahren die Blechtrommel. Mit diesem Buch schaffte Grass den definitiven Durchbruch. Neben der Blechtrommel schrieb Grass bis heute noch diverse andere Bücher unter anderem ,,Katz und Maus", ,,Hundejahre" und ,, Der Butt" Die Blechtrommel sollte aber sein erfolgreichster Roman bleiben.
Auch politisch gilt Grass als einer der engagiertesten Schriftsteller Deutschlands und macht immer wieder mit Reden und Aufsätzen zu aktuellen Themen auf sich aufmerksam. Inzwischen ist Grass mit seiner dritten Frau verheiratet und hat neben diversen renommierten Preisen dieses Jahr auch den Literaturnobelpreis, als krönenden Höhepunkt seiner Karriere, entgegennehmen können.
Wir werden sehen, dass die Biographie augenfällig viele Gemeinsamkeiten mit der in autobiographischem Stil geschriebenen Geschichte aufweist.
Zusammenfassung:
Der Zwerg, der Erzähler Oskar Matzerath lebt in einer Heil- und Pflegeanstalt. Er beharrt darauf chronologisch zu erzählen. Er beginnt seine Geschichte bei seiner Grossmutter Anna Bronski. Diese sitzt in ihren vier Röcken am Rande eines Kartoffelackers im Herzen der Kaschubei, sie röstet Kartoffeln. Joseph, ein sich auf der Flucht befindender Brandstifter versteckt sich an jenem Oktobertag des Jahres 1899 unter den vier gleichfarbigen Röcken der Grossmutter und zeugt dort Oskars Mutter Agnes. Anna Bronski wird zur Frau von Joseph. Dieser findet Arbeit als Flössner, wird aber schliesslich doch als Brandstifter entlarvt und verschwindet auf mysteriöse Weise. Es wird nicht klar ob er ertrinkt oder ob ihm eine Flucht in die USA gelingt.
Im Jahre 1923 heiratet der Kolonialwarenhändler Alfred Matzerath, Agnes Koljaiczek in Danzig. 1924 wird Oskar geboren, er schildert seine Geburt wiefolgt: Ich erblickte das Licht dieser Welt in Gestalt zweier Sechzig-Watt-Glühbirnen. Bis auf den obligaten Dammriss verlief meine Geburt glatt. Mühelos befreite ich mich aus der von Müttern, Embryonen und den Hebammen gleichviel geschätzten Kopflage.
Die Mutter, Agnes, verspricht Oskar bei seiner Geburt eine Blechtrommel, die er an seinem dritten Geburtstag bekommen sollte.
Mit drei Jahren beschliesst Oskar sein Wachstum einzustellen und so nicht in die Erwachsenenwelt eintreten zu müssen. Oskar stürzt an seinem dritten Geburtstag absichtlich die Kellertreppe runter. Gemeinläufig sieht man darin den Grund für die Einstellung seines Wachstums.
Oskar lernt trommeln. Auch ist Oskar in der Lage mit seiner monumentalen Stimme Glas zu zersingen; sein Schrei tötet Blumenvasen und zerbricht Fensterscheiben, schneidet Vitrinen, Uhrengläser und Glühlampen auf. Auch die Grundschule sollte für Oskar von kurzer Dauer seien, schon am ersten Schultag macht Oskar deutlich wie viel er von seinem Eintagesabenteuer Schule und seiner Lehrerin hält. Nachdem Oskar seine Trommel nicht hergeben wil und er die Klassenfenster in Brüche gehen lässt eskaliert die Situation vollends:
Weiss der Teufel wo sie den Rohrstock hergezaubert haben mochte. Jedenfalls war er auf einmal da, zitterte in jener sich mit der Frühlingsluft kreuzenden Klassenluft, und durch diese Luftmischung liess sie ihn sausen, liess ihn biegsam sein, hungrig, durstig, auf platzende Haut versessen sein, auf das Sssst, auf die vielen Vorhänge, die ein Rohrstock vorzutäuschen vermag, auf die Befriedigung beider Teile. Und sie liess ihn auf meinen Pultdeckel knallen, dass die Tinte im Fässchen einen violetten Sprung machte. Und sie schlug, als ich ihr die Hand nicht zum Draufschlagen anbieten wollte, auf meine Trommel. Auf mein Blech schlug sie. Sie, die Spollenhauersche, schlug auf meine Blechtrommel. Was hatte die zu schlagen? Gut, wenn sie schlagen wollte, warum dann auf meine Trommel? Sassen nicht gewaschene Lümmel genug hinter mir? Musste es unbedingt mein Blech sein? Musste sie, die nichts, rein gar nichts von der Trommelei verstand, sich an meiner Trommel vergreifen? Was blitzte ihr da im Auge? Wie hiess das Tier, das schlagen wollte? Welchem Zoo entsprungen, welche Nahrung suchend, wonach läufig? - Es kam Oskar an, es drang ihm, ich weiss nicht aus welchen Gründen
aufsteigend, durch die Schuhsohlen, Fusssohlen, fand hoch, besetzte seine Stimmbänder, liess ihn einen Brunstschrei ausstossen, der gereicht hätte, eine ganze herrliche, schönfenstrige, lichtfangende, lichtbrechende, gotische Kathedrale zu entglasen.
Ich formte mit anderen Worten einen Doppelschrei, der beide Brillengläser der Spollenhauer wahrhaft zu Staub werden liess. Mit leicht blutenden Augenbrauen und aus nunmehr leeren Brillenfassungen blinzelnd, tastete sie sich rückwärts, begann schliesslich hässlich und für eine Volksschullehrerin viel zu unbeherrscht zu greinen, während die Bande hinter mir verstummte, teils unter den Bänken verschwand, teils die Zähnchen klappern liess. (p.89)
Dieser Auszug verdeutlicht die Kraft Oskars Stimme.
Anstelle der wenig erfolgreichen Volksschule besucht Oskar eine Bekannte der Matzeraths, welche sich selbst inniglich ein Kind gewünscht hätte, und so auch mit dem kleinen Oskar Vorlieb nimmt. Sie lehrt ihm lesen und schreiben. Als Fibel dienen Oskar die Bücher ,,Rasputin und die Frauen" und Goethes ,,Wahlverwandtschaften". Diese beiden Bücher begleiten Oskar während der ganzen Geschichte.
Die Ehe zwischen Agnes und Alfred hat zwar Bestand, steht aber unter keinem guten Stern, Agnes macht Alfred dafür verantwortlich, dass Oskar die Treppe runtergestürzt ist und jetzt ein Krüppel sei. Ausserdem hat Agnes ein Verhältnis mit dem guten Freund der Familie und Vetter Jan Bronski einem Polen. Oft ist Oskar allein wenn Agnes sich im geheimen mit Jan trifft, manchmal sieht er auch zu, und denkt sich dass Jan wahrscheinlich eher sein Vater sei als Alfred Matzerath. Schon in jungen Jahren beschliesst Oskar, dass er den Nachnamen Bronski anstelle von Matzerath tragen sollte.
Bei einem Zirkusbesuch lernt Oskar den Liliputaner Bebra kennen, dieser rät ihm niemals vor der Tribüne zu stehen, sondern immer entweder auf oder unter ihr. Bebra entwickelt sich im Laufe der Geschichte zu einer Art Anhaltspunkt für Oskar, welcher ihm in schwierigen Zeiten beisteht.
Neben Oskars Stimme hat auch seine Trommel eine magische Kraft in sich, deren Wirkung er auf Parteiveranstaltungen der Nationalsozialisten erproben kann: Unter den Tribünenbänken hockend, lässt er seine Trommel ertönen und bringt mit seiner Störmusik, mit Walzer oder Charleston die Marschmusik der NS aus dem Rhythmus, ganz zum Ärger der Nazis. Diese sonntäglichen Störaktionen finden im Jahre 36 statt, auch Alfred M. beteiligt sich aktiv an den den NS-versammlungen, währendem sich seine Frau immer öfters mit Jan trifft.
Die Mutter plagt das schlechte Gewissen, weil sie fremd geht, jede Woche geht sie deshalb zur Beichte und nimmt Oskar mit. Dieser ist jedesmal aufs neue fasziniert vom kirchlichen Inventar.
Der vollplastische Jesus hielt jedoch die Augen übermüdet oder um sich besser konzentrieren zu können, geschlossen. Was hatte der Mann für Muskeln! Dieser Athlet mit der Figur eines Zehnkämpfers. Ich sammelte mich, sooft Mama Hochwürden Wienke beichtete, andächtig und den Turner beobachtend vor dem Hochaltar. Glauben sie mir, dass ich betete! Mein süsser Vorturner nannte ich ihn, Sportler aller Sportler, Sieger im Hängen am Kreuz unter Zuhilfenahme zölliger Nägel. Und niemals zuckte er! Das ewige Licht zuckte, er aber erfüllte die Disziplin mit der höchstmöglichen Punktzahl. (p.158)
Oskar fühlt sich in der Kirche wie in einem Erlebnispark und macht neue Erfahrungen in allen Lebensbereichen. Neben dem erwachsenen Jesus macht er sich auch am blutjungen Jesus zu schaffen, die nächste Szene gibt einen Eindruck davon.
Als Oskar das Giesskännchen des Jesusknaben, das fälschlicherweise nicht beschnitten war, eingehend betastete, streichelte und vorsichtig drückte, als wolle er es bewegen, spürte er auf teils angenehme, teils neu verwirrende Art sein eigenes Giesskännchen, liess darauf dem Jesus seines in Ruhe, damit seines ihn in Ruhe lasse. (p.161)
Neben dem Giesskännchen ist Oskar aber vor allem auch an den Trommelkünsten des Jesus interessiert, trommeln tut dieser aber nicht, was Oskar, der ein Wunder erwartet hat in Rage bringt. Trotz seiner Wut gelingt es ihm nicht die farbigen Kirchenfenster zur Strafe zu zerstören.
Nach diesem sakralen Misserfolg von Oskar folgt eine meiner Lieblingsszenen, der Titel des Kapitels heisst Karfreitagskost. Das Kapitel handelt von einem Ausflug von Alfred, Agnes, Jan und Oskar an die Ostsee, auf der Hafenmole treffen sie einen Fischer an. Dieser zieht eine Wäscheleine mit einem schwarzen Pferdekopf dran, hoch. Dazu der folgende Auszug.
Aber als die kleinen und mittleren Aale im Sack waren und der Stauer, dem bei seinem Geschäft die Mütze vom Kopf gefallen war, anfing dickere, dunkle Aale aus dem Kadaver zu würgen, da musste Mama sich setzen, und Jan wollte ihr den Kopf wegdrehen, aber das liess sie nicht zu, starrte unentwegt mit dicken Kuhaugen mitten hinein in das Würmerziehen des Stauers.
,,Besschen kieken!" stöhnte der zwischendurch. ,,Na nu mechten wä!" Riss mit dem Wasserstiefel nachhelfend dem Gaul das Maul auf, zwängte einen Knüppel zwischen die Kiefer, so das der Eindruck entstand: Das vollständige gelbe Pferdegebiss lacht. Und als der Stauer - jetzt sah man erst dass der oben gelb und eiförmig aussah - mit beiden Ärmen hineingriff in den Rachen des Gaules und gleich zwei herausholte , die mindestens armdick waren und armlang, da riss es meiner Mutter das Gebiss auseinander: Das ganze Frühstück warf sie , klumpiges Eiweiss und Fäden ziehendes Eigelb zwischen Wissbrotklumpen im Milchkaffeeguss über die Molensteine und würgte immer noch, aber es kam nichts mehr; denn soviel hatte sie nicht zum Frühstück gegessen, weil sie Übergewicht hatte und unbedingt abnehmen wollte.(p.171)
Alfred macht auf starke Nerven und zeigt wenig Verständnis für die Sensibilität seiner Frau. Er überlässt es Jan Agnes zu trösten.
Ein grosser Streit bricht am Abend aus. Als Alfred nicht darauf verzichten will, die Aalsuppe vom Menuplan zu streichen überkommt Agnes einen erneuten Heulanfall und erneut tauchen Vorwürfe wegen der offenen Falltüre auf, welche vordergründig für das Schicksal von Oskar verantwortlich ist. Natürlich ist auch die Dreierbeziehung für Agnes eine enorme Belastung, Oskar verzieht sich in den Schrank und wird dort wegen der heftigen Streitereien vollends vergessen.
Agnes kommt mit der Situation nicht mehr zurecht und scheint verrückt zu werden, sie frisst Fisch von morgens bis abends, alle sind beunruhigt und niemand kann etwas dagegen tun Agnes vergiftet sich und stirbt nach vier Tagen im Spital. Allgemein nimmt man an, der Tag auf der Mole hätte sie definitiv aus dem Gleichgewicht geworfen. Weiter sei der Kellersturz von Oskar eine schwere Belastung gewesen und nebenbei gesagt war Agnes auch noch im dritten Monat schwanger, von Alfred ihrem Ehemann oder von Jan ihrem heimlichen Verehrer, das bleibe dahin gestellt. Mit dem Tod von Agnes geht praktisch die einzige Bezugsperson von Oskar verloren, der Tod im Mai 37 trifft ihn schwer.
Das zweite Buch beginnt mit den ersten Kampfhandlungen in Danzig, kurz vor dem eigentlichen Ausbruch des zweiten Weltkrieges. Im August 1939 versetzt der Hausmeister die Polnischen Post in Danzig in den Verteidigungszustand. Es folgen Kämpfe um das Gebäude der Polnischen Post. Jan Bronski wird von Oskar in die Post hineingelockt. Oskars Onkel, welchen Oskar aber als seinen wahren Vater ansieht, und die andern Mitarbeiter der Polnischen Post verteidigen das Gebäude erfolglos. Jan Bronski, wie gesagt Oskars mutmaßlicher Vater wird wegen Freischerlerei erschossen. Am ersten September, also genau zum Zeitpunkt des Beginn des 2. Weltkrieges gesteht sich Oskar ein, daß seine Trommel, nein sogar er selbst, der Trommler, erst seine Mutter und dann seinen "Onkel und Vater" ins Grab gebracht hat. Denn er, Oskar, hatte den Männern von der Heimwehr in einer erzählt, dass Jan Bronski ihn in die Post geschleppt hätte um ihn als Kugelfang zu benutzen. Ende 1939 taucht Maria im Geschäft des Vaters auf. Denn Oskar war zu klein und ausserdem auch nicht gewillt hinter dem Ladentisch im Geschäft zu stehen. Diese Maria wird (abgesehen von den anonymen Krankenschwestern) zu Oskars erster richtiger Liebe. Bei einem Badetag an der Ostsee kommt es zu ersten Liebesszenen. Oskars Spezialität ist das stimulierende Brausepulver mit Waldmeister- und Himbeergeschmack, das Oskar in Marias Hand und später in ihrem Bauchnabel zum schäumen bringt.
,,So sehr das Grün sich auch vermehrte, Maria wurde rot, führte die Hand zum Mund, leckte die Innenfläche mit langer Zunge ab, tat das mehrmals und so verzweifelt, dass Oskar schon glauben wollte, die Zunge tilge nicht jenes sie so aufregende Waldmeistergefühl, sondern steigere es bis zu jenem Punkt, womöglich noch über jenen Punkt hinaus, der normalerweise allen Gefühlen gesetzt ist.
Dann liess das Gefühl nach. Maria kicherte, blickte sich um, ob auch keine Zeugen des Waldmeisters vorhanden wären und liess sich, da sie rings die in Badeanzügen atmenden Seekühe teilnahmslos und niveabraun gelagert sah, auf das Badelaken fallen; auf so weissem Plan verging ihr dann langsam die Schamröte." (p.321)
Anfang November 1940, besteht kein Zweifel mehr. Maria ist schwanger. Oskar, so meint er wäre der Vater, doch entdeckt er ein Zusammensein von seinem angeblichen Vater Alfred mit Maria. Dieser heiratet Maria dann auch, doch Oskar bleibt weiterhin davon überzeugt, dass es sein Kind sei. Oskar versucht vergeblich Maria zu überreden das Kind abzutreiben. Im Sommer 41 wird Kurt geboren.
Zu seinem dritten Geburtstag, so verspricht es Oskar, soll auch er von ihm eine Blechtrommel bekommen.
Nach Oskars 18. Geburtstag im September 42 erobert die sechste Armee Stalingrad, Sondermeldungen im Radio sind an der Tagesordnung.
Im Frühling 43 wird Oskar Mitglied des Fronttheaters und reist mit Bebra, dem Leiter des Fronttheaters und der neapolitanischen Zwergenschönheit Roswitha Ranguna nach Frankreich.
Am Fusse des Eifelturms bestaunen Oskar,94 cm gross oder eher klein, und Roswitha 98 cm hoch, dieses monumentale Bauwerk und werden sich ihrer eigenen Grösse und Einmaligkeit bewusst. In Paris reisst sich Oskar Roswitha, die Zwergenprinzesin unter den Nagel. Im April 1944 zieht der Zwergentrupp mit dem Fronttheater an den Atlantikwall um dort Aufführungen zu geben. Roswitha stirbt bei der Invasion der alliierten Truppen.. Bebra und Oskar kehren nach Berlin zurück, wo sie sich trennen. Oskar trifft einen Tag vor Kurts Geburtstag in seiner immer noch unversehrten Heimatstadt Danzig ein. Die Begrüssung seines Vaters bei seiner Heimkehr ist so herzlich, daß sich Oskar von jenem Tage an nicht nur Oskar Bronski, sondern auch Oskar Matzerath nennt. Oskar schenkt seinem Sohn Kurt eine Trommel, welche dieser jedoch sogleich zu Schrott schlägt. Oskar, der Dreikäsehoch, bezieht Prügel von seinem Sohn Kurt, dem zwei Zentimeter grösseren Dreikäsehoch.
Nach dem Zersingen der Fenster einer Schokoladenfabrik wird Oskar Führer einer vierzigköpfigen Jugendbande. Oskar der sich zum Jesus der Bande ernannt hat, hat Jünger erhalten. Von September 44 bis Januar 45 verübt die Bande in Jesu Namen Einbrüche, rauben Parteikassen, Lebensmittelkarten, plündern Kirchen aus, montieren Krippenfiguren und Statuen ab, wobei sie auf frischer Tat ertappt werden, beim Versuch die Jungfrau Maria vom Sockel zu holen. Ausser Oskar, dem kleinen Oskar, werden alle Mitglieder der Bande verurteilt. Die Russen haben unterdessen die deutsche Front durchbrochen, stehen vor und in Danzig und legen die Stadt in Schutt und Asche. Alfred Matzerath und seine Familie werden von den Russen in ihrem Keller entdeckt. Alfred verschluckt angesichts der eindringenden Russen sein Parteiabzeichen, das Oskar mit geöffneter Anstecknadel ihm zugesteckt hat, und erstickt daran.
Hätte er doch zuvor wenigstens mit drei Fingern die Nadel des Parteiabzeichens geschlossen. Nun würgte er an dem sperrigen Bonbon, lief rot an, bekam dicke Augen, hustete, weinte lachte und konnte bei all den gleichzeitigen Gemütsbewegungen die Hände nicht mehr oben behalten. Das jedoch duldeten die drei Iwans nicht. Sie schrien und wollten wieder seine Handteller sehen. (p.469)
Bei der Beerdigung von Alfred gesteht sich Oskar ein, dass er diesen vorsätzlich getötet hat, Zitat:"Weil jener aller Wahrscheinlich nach nicht nur sein mutmasslicher, sondern sein wirklicher Vater war; auch weil er es satt hatte sein Leben lang einen Vater mit sich herumschleppen zu müssen."
Oskar schmeisst seine Trommel in das offene Grab seines Vaters und beschliesst zu wachsen. Als er dann von seinem Sohn Kurt mit einem Kieselstein am Hinterkopf getroffen wird, fällt er ins Grab und beginnt tatsächlich erneut zu wachsen. Mit 21 Jahren misst er einen Meter und 21 cm.
Oskar erkrankt, eine Ärztin, rät ihm und seinen Angehörigen in Richtung Westen wegzukommen, weg von dem schon weitgehend von Polen bewohnten Danzig, das nun Gdansk heisst.
Hier findet ein Wechsel des Erzählstils statt. Da Oskar aufgrund seiner geschwollenen Finger schlecht schreiben kann, bittet er seinen Pfleger Bruno dies zu tun. So erfolgt eine Umänderung des autobiographischen Stils in eine Erzählform dritter Person. Auch wenn Oskar in seiner Biographie teilweise ebenfalls über sich selbst in der dritten Person schreibt, so stellt der Pfleger Oskars Situation objektiver dar und vermittelt dem Leser ein anschaulicheres Bild über ihn.
In einem Güterzug fahren Oskar, Maria und Kurt lange Zeit Richtung Westen. Denn des öfteren wird der Zug von ehemaligen Partisanen und polnischen Jugendbanden angehalten und ausgeraubt.
Das ständige Rütteln im Zug fördert Oskars Wachstum. Er meint er sei während der Fahrt um etwa zehn Zentimeter gewachsen, doch leider hat sich das Ausbilden eines Buckels nicht verhindern lassen. Oskar wird in einen Spital in Hannover eingeliefert, wo er sich mit diversen Krankenschwestern anfreundet und wenig später nach Düsseldorf verlegt. Die Zeit von August 45 bis Mai 46 verbringt Oskar im Spital. Vor seiner Entlassung wird Oskar gemessen. Er misst zu diesem Zeitpunkt stattliche 123 cm. In dieser Grösse verlässt Oskar als ein, zwar verwachsener, ansonsten aber ziemlich gesunder junger Mann den Spital, um ein neues, nunmehr erwachsenes Leben zu beginnen.
An dieser Stelle beginnt das dritte Buch, welches ich persönlich für den schwächsten Teil der Blechtrommel halte und deshalb nur kurz zusammenfassen werde.
Maria verdient sich in den ersten Jahren im Westen ihren Lebensunterhalt vornehmlich mit Schwarzhandel. Oskar fällt ihr immer mehr zur Last und beschliesst selbstständig zu werden. Er macht eine Lehre als Steinmetz und dient als Modell bei der Kunstakademie, Schüler und Professoren schätzen seine aussergewöhnlichen Proportionen sehr. Oskar hat seine eigenes Zimmer als Untermieter, wo er eines nachts über eine andere Untermieterin, die Krankenschwester Dorothea herfällt und diese auf dem Kokosläufer im Gang vergewaltigt worauf diese die Flucht ergreift.
Oskar spielt Trommel in einer Jazzband und ist äusserst erfolgreich. Bebra, wir kennen ihn schon, ist Chef einer Konzertagentur. Er bringt Oskar und seine Blechtrommel ganz gross raus. Oskar spricht zu seiner Missgunst vor allem Rentner an, da er mit seiner Trommelei Erinnerungen an deren Kindheit weckt und diese in Trance geraten und sich wie Kinder fühlen können. Oskar wird ein reicher Mann. Als Oskar von einer Tournee zurückkehrt ist sein Meister Bebra tot. Um ihn trauernd leiht sich Oskar einen Rotweiler mit dem er einsame Spaziergänge unternimmt. (Oskars Einsamkeit)
Auf einem dieser Spaziergänge bringt ihm dieser Hund einen weiblichen, beringten Finger. Oskar konserviert diesen Finger in einem Einmachglas und vergöttert ihn auf krankhafte Weise. Dieser Ringfinger wird zu einem Hauptindiz im Mordfall der Krankenschwester Dorothea, Oskar ist sofort der Hauptverdächtige und wird auf der Flucht in Paris geschnappt. Oskar wird schuldig gesprochen jedoch als nicht zurechnungsfähig beurteilt und mit 28 Jahren in die Heil- und Pflegeanstalt gesteckt.
Dort endet die innere Romanebene und Grass kehrt auf die äussere Romanebene, die Erzählebene zurück. Oskar feiert seinen dreissigsten Geburtstag und ist kurz davor wieder entlassen zu werden, da man den wahren Täter im sogenannten Ringfingerprozess gefunden habe. Eine eifersüchtige Krankenschwester habe die Schwester Dorothea unter die Erde gebracht.
Für Oskar ist diese Nachricht eher ein Schock als eine Erleichterung, ihm hat das Leben im Bett in der Pflegeanstalt gefallen und jetzt soll er, der dreissigjährige Oskar, wieder in die Welt raus.
In eine Welt die geprägt ist von Furcht. Der Furcht, vor der schwarzen Köchin (siehe Auszug 1), dieser Lebensangst die Oskar schon immer begleitet hat, bleibt ihm und lässt ihn nicht mehr los.
Interpretation
Ich denke dass Günter Grass den Grundstein zu seinem Erfolgsroman mit dem Gnomen Oskar Matzerath gelegt hat. Diese abstruse Figur lässt ihm jederzeit alle Möglichkeiten offen der Geschichte einen völlig neuen Lauf zu geben, manchmal märchenhaft und lustig, manchmal erschreckend real. Oskar, wachstumsmässig ein dreijähriger, hat den Verstand eines Erwachsenen und ist ein überaus scharfer Beobachter und Beurteiler seiner Umwelt. Seine Hellhörigkeit und Intelligenz ermöglichen ihm jegliches gesellschaftliches Laster zu erkennen.
Durch den Umstand, dass der Erzähler im ersten Satz seines Buches klar macht, dass er Insasse einer Irrenanstalt sei, wird der Leser von Beginn weg zu kritischem Lesen angehalten. Kritisch ist auch der Erzähler selbst, er verurteilt die miefige Kleinbürgerwelt, die geprägt ist von Heuchelei und Verlogenheit. Im Buch unter anderem zum Ausdruck gebracht durch die Dreiecksbeziehung von Agnes.
Oskars Entschluss an seinem dritten Geburtstag sein Wachstum einzustellen verstehe ich als Protest, Oskar verweigert jegliche Teilnahme an der Welt. Sein Erzählstil lässt ihn in einer Art Luftblase erscheinen, unberührbar und unfehlbar, angeekelt von der Aussenwelt. Persönlich verweigert er jeglichen Beitrag an eine Leistungsgesellschaft, wir erinnern uns an seinen ersten und einzigen Schultag, an dem er sehr direkt mit der verständnislosen Erwachsenenwelt konfrontiert wird.
Oskar sieht die Welt von unten: als Zeuge, den man wegen seiner Grösse leicht übersieht, oder wegen seines Alters nicht beachtet. Er aber, sieht alle Lügen und Gemeinheiten, aus denen die Welt besteht.
Nach und nach wird man überzeugt vom Schlechten im Menschen. Aber Oskar selbst, der nimmermüde Kritiker, ist auch keine engelhafte Gestalt. Viel eher ein kleiner Satan, Richter und Henker in einer Person.
Abgeklärt, wie Oskar ist, bringt er es auf raffinierte Weise fertig eine Person nach der anderen ins Jenseits zu befördern. Trotz seiner Boshaftigkeit fühlte ich niemals Mitleid für Oskars Opfer, denn so wie Oskar es mir schilderte hatte ich oftmals volles Verständnis für sein Handeln und wurde noch bestärkt in meiner Meinung vom armen, weltvergessenen Oskarchen.
Neben der Kritik am Kleinbürgertum ist Oskar auch nicht einverstanden mit der NSDAP. Oskar ist zwar vollkommen apolitisch, aber äusserst feinfühlig was Ästhetik anbelangt. Er nervt sich über die vorgetäuschte Ordnung, die Symmetrie, die Uniformen. Dies erklärt auch seine Störaktionen bei den sonntäglichen Naziversammlungen.
Die Trommel, der immerwährende Begleiter von Oskar, dient ihm als Sprachrohr, um seiner Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Die Trommelei dient ihm aber auch immer wieder dazu, vor der Welt zu flüchten und seine gestauten Aggressionen abzubauen. Ab und zu passiert es Oskar, dass er seine Trommel vergisst. Immer wenn Oskar die Aufmerksamkeit einer Person erlangt ist er fähig seine Trommel wegzulegen. Zum Beispiel auch als Oskar sich in Maria verliebt, Zitat: Mein neu gewachsener Stock lässt mich meine Trommel und beide Trommelstöcke vergessen. Insgesamt empfand ich das Trommeln immer wieder als starken Ausdruck seiner Frustration.
Bei Kriegsende bricht Oskar seine Künstlerkarriere ab und begräbt seine Trommel, mit 21 Jahren will er Verantwortung übernehmen und sich in die Gesellschaft integrieren. Das Leben in der rauhen Welt ist hart für Oskar und nach einer mehrjährigen Trommelabstinenz entschliesst sich Oskar erneut für die Kunst und zieht sich so zum Schluss wieder aus der Welt zurück, in die Irrenanstalt Eine der auffälligsten Eigenschaften diese Romans ist sicher auch die starke Bindung an geschichtliche Begebenheiten. Oft stehen private Vorgänge stellvertretend für geschichtliche Geschehnisse der jeweiligen Zeit. Der ganze Roman liefert einen Abriss der deutschen Geschichte der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts und schafft so einen sehr interessanten und lehrreichen Rahmen. Im Zentrum steht der Zweite Weltkrieg, aber Grass geht noch weiter zurück, zum deutschen Kaiserreich, schneidet den ersten Weltkrieg an, die deutsch - polnischen Grenzstreitigkeiten, die Machtübernahme der NSDAP und deren Programm, die Kristallnacht, die KZs, die Euthanasieprogramme, denen Oskar auch fast zum Opfer gefallen wäre, die Invasion, die Eroberung Danzigs, die Flucht in den Westen, das Flüchtlingsleid und das nachfolgende Wirtschaftswunder im Nachkriegsdeutschland.
Hier ein Auszug, in dem das Spielwarengeschäft zerstört wird, von welchem Oskar seine Trommeln bezogen hatte, die Kristallnacht:
Sie, dieselben Feuerwerker, denen ich, Oskar, davongelaufen zu sein glaubte, hatten schon vor mir den Markus besucht, hatten Pinsel in Farbe getaucht und ihm quer übers Schaufenster in Sütterlinschrift das Wort Judensau geschrieben, hatten dann, vielleicht aus Missvergnügen an der eigenen Handschrift, mit ihren Stiefelabsätzen die Schaufensterscheibe zertreten, so dass sich der Titel, den sie dem Markus angehängt hatten, nur noch erraten liess. Die Tür verachtend, hatten sie durch das aufgebrochene Fenster in den Laden gefunden und spielten nun dort auf ihre eindeutige Art mit dem Kinderspielzeug.
Ich fand sie noch beim Spiel, als ich gleichfalls durch das Schaufenster in den Laden trat. Einige hatten sich die Hosen heruntergerissen, hatten braune Würste, in denen noch halbverdaute Erbsen zu erkennen waren, auf Segelschiffe, geigende Affen und meine Trommeln gedrückt. (p.233)
Das Buch macht aber trotz seines geschichtlichen Rahmens niemals einen verstaubten Eindruck, sondern überzeugt immer wieder mit sehr lebendigen Bildern, was sicher auch in den Auszügen zum Ausdruck gekommen ist. Oft sind es sehr provokative Bilder, wenn sie nicht abstossend sind, dann pornographisch oder gotteslästerlich, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber Grass bringt es fertig diese angehäuften Provokationen mit phänomenaler Genauigkeit und Sprache zu präsentieren, so dass ich manchmal leer schlucken musste aber niemals gedacht habe: das ist doch unterste Schublade, primitiv.
Oftmals wirkt die Anordnung dieser angesprochenen Details chaotisch, umso erstaunlicher ist es, dass es Grass gelingt das Buch in seiner Gesamtheit sehr klar zu gliedern, und so einen immerwährenden Fluss aufrechtzuerhalten.
Grass Stil ist natürlich stark geprägt von diesen Bildern, weiter von überlangen Sätzen, welche oftmals durch lange Aufzählungen noch verlängert werden, eines seiner Markenzeichen (-> Auszüge). Um seinen Bildern noch einen höheren Wahrheitsgehalt zu geben, sie noch plastischer erscheinen zu lassen, arbeitet Grass mit auffällig vielen Adjektiven (Auszüge).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Günter Grass' "Die Blechtrommel"?
"Die Blechtrommel" ist ein Roman von Günter Grass, der die Geschichte von Oskar Matzerath erzählt, einem Mann, der beschließt, im Alter von drei Jahren sein Wachstum einzustellen, um der Welt der Erwachsenen zu entgehen. Oskar, der in Danzig vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg aufwächst, erlebt und kommentiert die historischen Ereignisse aus seiner einzigartigen Perspektive. Er wird in eine deutsch-polnische Familie hineingeboren und hat Schwierigkeiten, die Identität seines Vaters festzustellen. Das Buch ist in drei Teile gegliedert, die Oskars Kindheit, die Kriegsjahre und die Nachkriegszeit in Deutschland behandeln. Oskars Trommel dient ihm als Ventil und Ausdrucksmittel, sein schriller Schrei kann Glas zerspringen lassen.
Wer ist Oskar Matzerath?
Oskar Matzerath ist der Protagonist und Ich-Erzähler von "Die Blechtrommel". Er ist ein kleinwüchsiger Mann, der im Alter von drei Jahren beschliesst, nicht mehr zu wachsen. Er ist ein scharfer Beobachter seiner Umgebung, die er mit viel Ironie und Kritik kommentiert. Oskar ist ein begabter Trommler und kann mit seinem Schrei Glas zerspringen lassen. Er ist in eine deutsch-polnische Familie hineingeboren und versucht, die Identität seines Vaters zu klären. Er verbringt Zeit in einer psychiatrischen Anstalt, in der er seine Geschichte aufschreibt.
Was sind die wichtigsten Themen in "Die Blechtrommel"?
Zu den wichtigsten Themen in "Die Blechtrommel" gehören die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, die Ablehnung des Nationalsozialismus, die Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung, die Suche nach Identität, die Verweigerung des Erwachsenwerdens, die Kraft der Kunst (insbesondere der Musik) als Ausdruck von Protest und die Darstellung historischer Ereignisse aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Auch die Rolle von Scheinheiligkeit und Verlogenheit in der Gesellschaft wird kritisch beleuchtet.
Wie ist "Die Blechtrommel" aufgebaut?
Der Roman ist in drei Bücher unterteilt. Das erste Buch spielt vor dem Zweiten Weltkrieg in Danzig und konzentriert sich auf Oskars Kindheit. Das zweite Buch behandelt die Zeit des Krieges, und das dritte Buch die Nachkriegszeit in Westdeutschland. Das Buch ist aus der Ich-Perspektive von Oskar Matzerath geschrieben, der sich in einer psychiatrischen Anstalt befindet und seine Geschichte aufschreibt. Es gibt Einschübe in die Gegenwart des Erzählers.
Wer sind die wichtigsten Nebenfiguren in "Die Blechtrommel"?
Zu den wichtigsten Nebenfiguren gehören:
- Anna Bronski: Oskars Großmutter, die eine wichtige Rolle in der Familiengeschichte spielt.
- Agnes Matzerath: Oskars Mutter, die eine komplizierte Dreiecksbeziehung führt und an Fischvergiftung stirbt.
- Alfred Matzerath: Oskars mutmaßlicher Vater, ein Kolonialwarenhändler, der Mitglied der NSDAP wird und schließlich erstickt.
- Jan Bronski: Ein polnischer Cousin und Liebhaber von Agnes, der als Oskars möglicher Vater in Betracht gezogen wird und während der Kämpfe um die polnische Post in Danzig stirbt.
- Maria: Die Verkäuferin in Alfreds Laden, die Alfred heiratet und Oskars Sohn Kurt zur Welt bringt.
- Kurt: Der Sohn von Maria und mutmaßlich Oskar.
- Bebra: Ein Liliputaner und Leiter des Fronttheaters, der Oskar während des Krieges begleitet.
Was symbolisiert die Blechtrommel im Roman?
Die Blechtrommel ist Oskars ständiger Begleiter und dient ihm als Ausdrucksmittel. Sie symbolisiert seinen Protest gegen die Welt der Erwachsenen und die herrschenden Verhältnisse. Sie ist auch ein Instrument, mit dem er seine Frustration abbauen und vor der Welt fliehen kann. Die Trommel ermöglicht es ihm, auf Missstände aufmerksam zu machen und sich gegen Autoritäten aufzulehnen.
Welche Rolle spielt Danzig in "Die Blechtrommel"?
Danzig ist der zentrale Schauplatz des Romans und prägt Oskars Leben und Identität. Die Stadt ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Nationalitäten. Die politischen und sozialen Spannungen in Danzig spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte und beeinflussen Oskars Entwicklung.
Wie wird der Nationalsozialismus in "Die Blechtrommel" dargestellt?
Der Nationalsozialismus wird in "Die Blechtrommel" kritisch und satirisch dargestellt. Oskar beobachtet die Aufmärsche und Propaganda der Nazis mit Skepsis und untergräbt sie durch seine Trommelei. Der Roman zeigt, wie der Nationalsozialismus in das Leben der Menschen eindringt und sie manipuliert. Oskar selbst verweigert sich der ideologischen Vereinnahmung durch das Regime.
Was ist das Besondere an Günter Grass' Schreibstil in "Die Blechtrommel"?
Günter Grass' Schreibstil zeichnet sich durch detaillierte Beschreibungen, lange und verschachtelte Sätze, eine Vielzahl von Adjektiven und eine Mischung aus Realismus und Fantasie aus. Er verwendet oft provokative und groteske Bilder, um seine Kritik an der Gesellschaft und der Politik zu verdeutlichen. Sein Stil ist geprägt von Ironie, Sarkasmus und einer gewissen Morbidität.
Wie interpretiert man das Ende von "Die Blechtrommel"?
Das Ende des Romans, in dem Oskar in eine psychiatrische Anstalt gesteckt wird und seinen dreißigsten Geburtstag feiert, kann unterschiedlich interpretiert werden. Es deutet darauf hin, dass Oskar trotz seiner Rebellion und seiner Versuche, sich der Welt zu entziehen, letztendlich von ihr eingeholt wird. Gleichzeitig lässt das offene Ende die Möglichkeit offen, dass Oskar in der Anstalt eine Art von Freiheit findet und sich von den Zwängen der Gesellschaft befreit.
- Quote paper
- Iwan Schauwecker (Author), 1999, Grass, Günter - Die Blechtrommel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95721