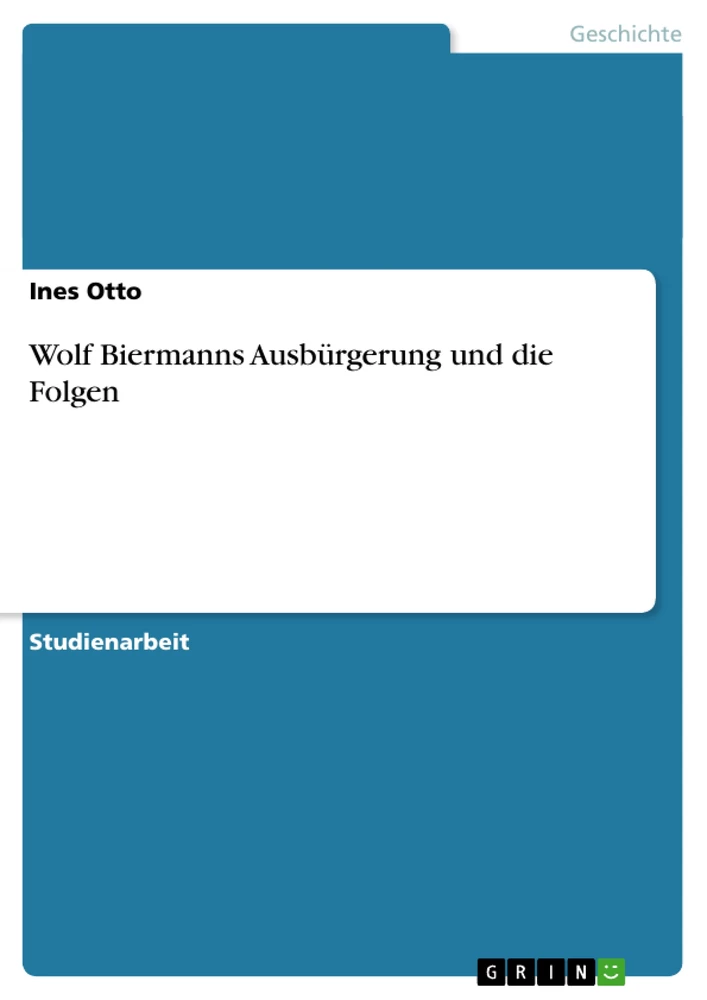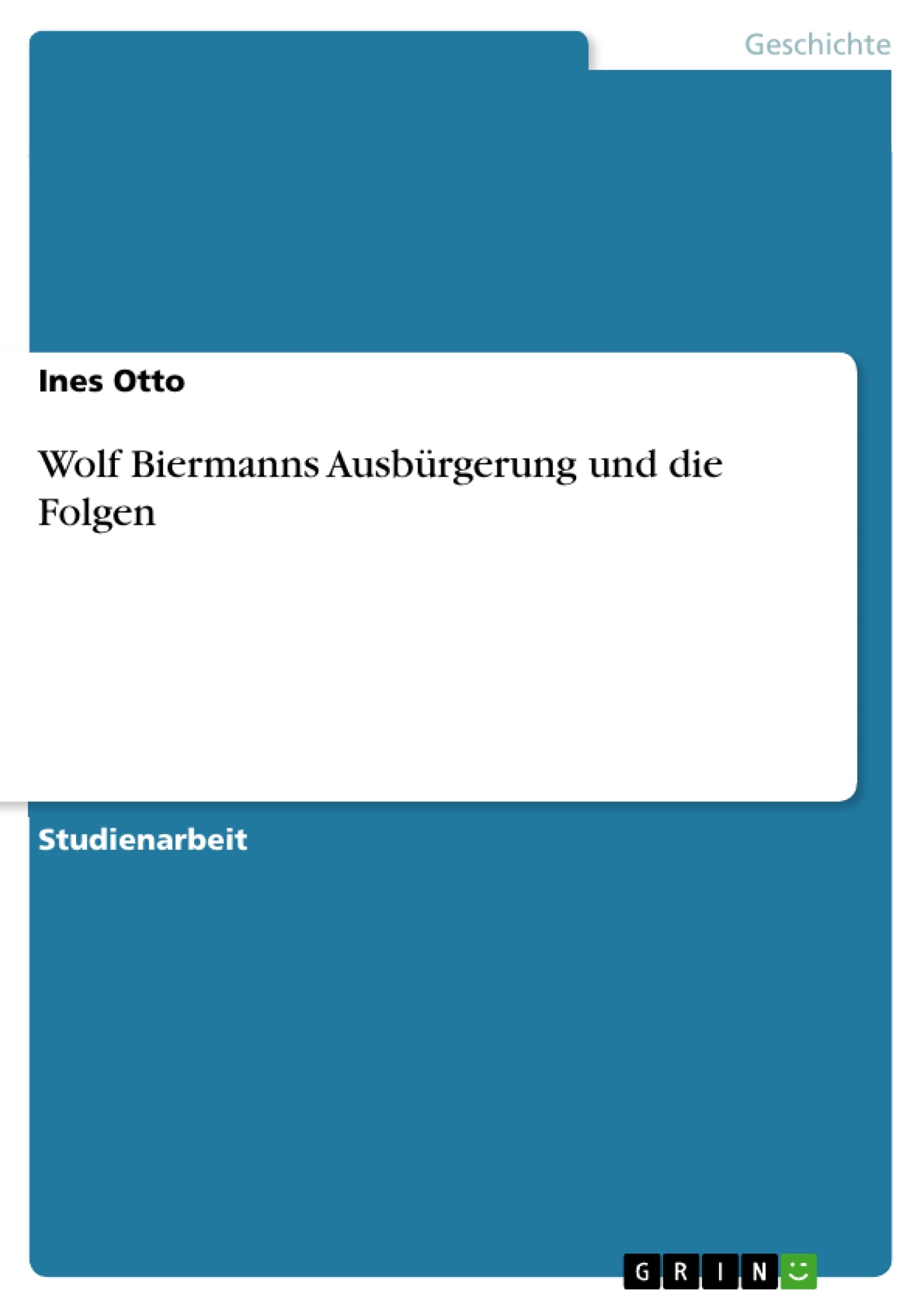Was geschieht, wenn ein Staat seine Künstler verliert? Tauchen Sie ein in die brillante und zugleich erschütternde Geschichte von Wolf Biermann, einem Liedermacher, der mit seiner kritischen Stimme das Fundament der DDR ins Wanken brachte. Diese fesselnde Analyse beleuchtet die Hintergründe seiner Ausbürgerung im Jahr 1976 – ein Wendepunkt, der nicht nur Biermanns Leben, sondern auch die kulturelle und politische Landschaft beider deutschen Staaten für immer veränderte. Erfahren Sie, wie Biermanns unbequeme Kunst, seine provokanten Texte und seine unerschrockene Haltung zum Politikum wurden und die DDR-Führung zu einer folgenschweren Entscheidung trieben. Entdecken Sie die Zerrissenheit zwischen künstlerischem Ausdruck und politischer Doktrin, die das Leben vieler DDR-Künstler prägte, und die Reaktionen auf Biermanns Exilierung – von der Künstlerpetition, die das System herausforderte, bis zum Exodus zahlreicher Intellektueller in den Westen. Dieses Buch ist eine fesselnde Reise in die Welt der DDR-Kulturpolitik, der Ost-West-Beziehungen und des Kalten Krieges, die anhand des Schicksals eines mutigen Künstlers die Frage nach Freiheit, Widerstand und der Rolle der Kunst in einer totalitären Gesellschaft aufwirft. Es ist eine Geschichte von Repression und Rebellion, von Anpassung und Aufbegehren, die bis heute relevant ist und zum Nachdenken über die Bedeutung von Meinungsfreiheit und kultureller Vielfalt anregt. Verfolgen Sie die komplexen Verflechtungen zwischen Ost und West, die Rolle der Stasi und die Mechanismen der Zensur, die Biermanns Schaffen zu unterdrücken versuchten. Analysiert werden die Auswirkungen der Biermann-Ausbürgerung auf die Kulturszene der DDR, die Proteste der Künstler und Intellektuellen, sowie die Reaktionen in der Bundesrepublik. Ein essentielles Werk für alle, die sich für deutsche Geschichte, DDR-Kultur, Liedermacher, Zensur, Meinungsfreiheit und die Mechanismen politischer Repression interessieren. Dieses Buch enthüllt die wahren Kosten der Unterdrückung künstlerischer Stimmen und zeichnet ein bewegendes Porträt eines Mannes, der sich weigerte, sich dem Diktat der Macht zu beugen. Es ist ein fesselndes Zeugnis einer Zeit, in der Kunst und Politik untrennbar miteinander verbunden waren, und eine inspirierende Erinnerung daran, dass die Stimme der Freiheit niemals zum Schweigen gebracht werden kann. Tauchen Sie ein in die turbulente Welt der DDR-Kultur, in der jeder Ton, jedes Wort und jede Geste eine politische Bedeutung hatte.
„Ich kämpfte naiv ohne Visier, und ich redete immer, auch in Reimen, Klartext. Die Folgen blieben nicht aus (...). Inzwischen ist die DDR krepiert und wird ohne Pomp beerdigt (...). Die Musen kann man eben nicht zwingen.“[1]
1. Einleitung
Für die einen ist er ein bedeutender Lyriker, eine Symbolfigur für den Widerstand gegen die Einengung künstlerischen Schaffens. Für die anderen ist er ein unbequemer Zeitge- nosse, der Unordnung in gewohnte Denkschemata bringt. Was macht Wolf Biermann eigentlich zu einer so umstrittenen Persönlichkeit? Welche Bedeutung hatte sein Wirken in der DDR einerseits für die Künstler, andererseits für die DDR-Führung? In meiner Arbeit möchte ich am Beispiel Wolf Biermann der Frage nachgehen, was mit einem Staat passiert, der viele seiner Künstler verliert, nachdem ihr Schaffen auf sehr unter- schiedliche aber doch häufig existentielle Weise eingeengt wurde. Ist nicht die staatliche Tolerierung und Auseinandersetzung mit Kunst ein Zeichen für die innere Stärke der Politik eines Landes? Oder anders ausgedrückt: Zeigt die Ausbürgerung Wolf Bier- manns im November 1976 und die damit verbundene Unfähigkeit, sich innerhalb der DDR öffentlich und konstruktiv mit Kritik am System auseinanderzusetzen, nicht schon die Anfänge eines staatlichen Zerfalls? Nach einer kurzen Beschreibung zu Biermanns Anfängen in der DDR werde ich versuchen, den Zwiespalt zwischen künstlerischem Ausdrucksbedürfnis und behaupteter politisch-gesellschaftlicher Möglichkeit innerhalb der DDR zu beleuchten. Es soll in der vorliegenden Arbeit eine Antwort auf die Frage gefunden werden, warum es zu der Ausbürgerung Biermanns kommen konnte. Neben den Folgen der Ausweisung innerhalb der DDR werde ich auch darauf eingehen, welche Reaktionen es in der Bundesrepublik auf die Zwangsexilierung Biermanns gab. Im Zu- sammenhang mit den politischen Absichten des Liedermachers wird es wichtig sein, die Beziehungen zwischen Ost- und Westdeutschland zu beschreiben. Nicht näher bearbei- ten werde ich die außenpolitischen Reaktionen anderer westeuropäischer Länder, weil das den Rahmen meiner Hausarbeit sprengen würde. Es geht mir um eine Bearbeitung der kulturpolitischen Hintergründe des gescheiterten DDR-Systems anhand der Ausbür- gerung Wolf Biermanns.
2. Herkunft, Bildungsweg und Werk
Wolf Biermann stammt aus einer Familie aktiver Kommunisten. Seine Eltern beteiligen sich am Widerstand gegen die Nationalsozialisten, sein Vater wird inhaftiert und stirbt 1943 in Auschwitz. Die Entwicklung des jungen Wolf Biermann nach dem 2. Weltkrieg scheint vorgegeben zu sein. Zunächst tritt er einer Pioniergruppe bei, besucht 1950 das Weltjugendtreffen in Ost-Berlin und zieht 1953 schließlich von Hamburg in die DDR um. Von hier aus möchte er seinen Beitrag zum Aufbau des Sozialismus leisten. Die ersten Jahre als Bürger der DDR verlaufen für Biermann in relativer Reibungslosigkeit. An der Berliner Humboldt-Universität studiert er zunächst politische Ökonomie. 1957, ein Jahr nach Brechts Tod, unterbricht der Student seine Ausbildung, um als Regieassis- tent in dem von Brecht und Helene Weigel gegründeten Berliner Ensemble zu arbeiten. In dieser Zeit lernt Biermann Hanns Eisler kennen, der ihn unterstützt und fördert. Trotz der Unterstützung des bekannten Komponisten gibt Biermann seine Theaterarbeit auf und beginnt ein neues Studium. 1959 belegt er bis 1963 die Fächer Philosophie und Mathematik. Der Mauerbau 1961 läßt den 25 jährigen Biermann erstmals am ‘Realso- zialismus’ zweifeln; seine bis dahin eher ‘blauäugige’ Solidarität verwandelt sich in eine kritische. 1961/62 baut er mit Freunden in einem alten Hinterhofkino das Berliner Ar- beiter- und Studententheater (b.a.t.) auf, das jedoch nicht eröffnet werden darf. Bis Juni 1963 währt ein erstes Auftrittsverbot. Der Konflikt zwischen dem Liedermacher Wolf Biermann und der DDR-Regierung spitzt sich zu, als Biermann aus der SED aus- geschlossen wird. Seine in dieser Zeit entstandenen Werke wie z. B. Antrittsrede des Sängers konturieren das Bild, das der ‘Geschmähte’ von seinen ‘Richtern’ hat:
„Antrittsrede des Sängers
Die einst vor Maschinengewehren mutig bestanden / fürchten sich vor meiner Gitarre. / Panik / breitet sich aus, wenn ich den Rachen öffne und / Angstschweiß tritt den Büroelephanten auf den Rüssel / wenn ich mit Liedern den Saal heimsuche, wahrlich / Ein Ungeheuer, eine Pest, das muß ich sein, wahrlich / Ein Dinosaurier tanzt auf dem Marx- Engels -Platz / Ein Rohrkrepierer, fester Kloß im feisten Hals / der Ve r- antwortlichen, die nichts so fürchten wie / Verantwortung. / Also / hackt ihr den Fuß euch lieber ab / als daß ihr ihn wascht?! (...)“[2]
In dem kurzen kulturpolitischen Frühling der Jahre 1964/65 lösen sich vorübergehend die Spannungen zwischen der SED und ihrem früheren Mitglied: Biermann darf in dem Ostberliner Kabarett Die Distel auftreten, und er unternimmt zudem eine Konzertreise in die BRD. 1965 kommt es auf der Abschlußkundgebung des Ostermarsches in Frank- furt sogar zu einem gemeinsamen Auftritt mit Wolfgang Neuss. Dieses Treffen wird im gleichen Jahr auf Schallplatte veröffentlicht. Es erscheint außerdem im Wagenbach- Verlag in West-Berlin seine Sammlung Die Drahtharfe. Balladen Gedichte Lieder, eine Publikation, die bald zu den auflagenstärksten Lyrikbändern der deutschen Nach- kriegsliteratur zählt. Durch die Aufnahme des Treffens mit Wolfgang Neuss auf Schall- platte und der Publikation seines Gedichtbandes gewinnt Wolf Biermann viel an Öffent- lichkeit. Gleichzeitig mit den bedeutenden Erfolgen geht aber ein Auftrittsverbot einher, daß ihm von den DDR Behörden auferlegt wird und ganze elf Jahre währen soll. Im 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965 will man „schädliche (...) Tendenzen“ in allen Bereichen der Kultur feststellen, die durch „Darstellung angeblicher Fehler Skeptizismus und Unmoral verbreiten“[3]. Die SED-Führung, die durch die Kritik von Künstlern ihren Anspruch auf Hegemonie in Kultur und Gesellschaft bedroht sieht, beschließt im 11. Plenum des ZK unter anderem ein uneingeschränktes Auftritts-, 11. Plenum des ZK unter anderem ein uneingeschränktes Auftritts-, Publikations- und Reiseverbot für Wolf Biermann.
3. Die Jahre vor der Ausbürgerung
3.1. Der Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker
1971 tritt Ulbricht auf Druck der Parteiführung und der UdSSR seine Macht an Hone- cker ab. Durch den Machtwechsel wird auch in der Kulturpolitik der DDR eine neue Phase eingeleitet. Honeckers Ausspruch: “Wenn man von der festen Position des Sozia- lismus ausgeht, kann es meines Erachtens auf dem Gebiet von Kunst und Literatur keine Tabus geben.“[4] ist von großer Bedeutung für die Kulturschaffenden der DDR. Das erste mal verzichtet ein SED-Parteichef auf eine genaue Definition ästhetischer Richtlinien. Der Widerspruch zwischen künstlerischen Bedürfnissen und deren Ausdrucksmöglichkeiten im eigenen Land scheint sich aufzulösen. Bei den Künstlern und Intellektuellen der DDR wächst die Hoffnung auf eine Lockerung der Zensur für die Kunst. Allerdings kann diese Hoffnung nicht in dem Maße erfüllt werden, wie es von den Kulturschaffenden im Ostteil des Landes erwartet wird. Die SED beginnt sich zwar nach einigem Zögern auf einen Ost-West-Dialog einzulassen, innenpolitisch beschränkt sie sich jedoch auf die nüchter- ne Verkündung der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“. Politische Tabus blei- ben weiterhin unangetastet.
3.2. Die außenpolitische Situation der DDR und die Ost-West-Beziehungen
Im Zuge einer internationalen Entspannungspolitik nimmt Bundeskanzler Willy Brandt 1970 Verhandlungen mit der DDR auf. Mit dem Konzept „Wandel durch Annäherung“[5] führen diese Verhandlungen zu einem ‘geregelten Nebeneinander’. Trotz der Anfänge eines Dialoges zwischen Ost und West Anfang der 70er Jahre besteht das Grundmuster der beiden deutschen Staaten darin, die Lage im eigenen Land möglichst zu entspannen und beim Nachbarn zuzuspitzen. Es werden sowohl im Westen wie auch im Osten Deutschlands keine innenpolitischen Schritte unternommen, ohne auf die Reaktion des Nachbarn zu achten. Dieser Aspekt ist wichtig, will man die Ausbürgerung Wolf Bier- manns und die damit verbundenen höchst unterschiedlichen Reaktionen in Ost- und Westdeutschland verstehen. Unter Honeckers Parteiführung tritt zwar eine gewisse Konsolidierung der Beziehungen der beiden deutschen Staaten ein, dennoch betreibt die DDR eine Politik strikter Abgrenzung gegenüber der Bundesrepublik, um bei der DDR- Bevölkerung keine Hoffnung auf Wiedervereinigung aufkommen zu lassen. Die außen- politische Situation verändert sich 1975 zudem auch durch die KSZE-Gipfelkonferenz in Helsinki. Sie ist der Höhepunkt und Abschluß der europäischen Entspannungspolitik, die mit der Unterzeichnung der Schlußakte endet. Honeckers Anwesenheit auf der Konferenz empfindet man in der DDR als endgültige Anerkennung des zweiten deut- schen Staates. Für die gleichberechtigte Aufnahme in die Reihen europäischer Länder räumt die DDR formal individuelle Grundrechte ein - darunter auch die Reisefreiheit. Dieses Versprechen kann sie jedoch nicht halten. Politbüromitglied Hermann Axen er- klärt einige Zeit nach der Konferenz in Helsinki, daß die Festlegungen der KSZE- Schlußakte in der DDR nur „im Rahmen ihrer Gesetze durchgesetzt“[6] werden könnten. Innerhalb der DDR-Bevölkerung verstärkt sich der Wunsch, sich die Welt außerhalb Osteuropas anschauen zu können, um sich ein eigenes Bild davon machen zu können; allerdings nicht mit der Konsequenz, dem eigenen Land den Rücken zu kehren. Dies wird aber von der Parteiführung nicht erkannt, was zur Folge hat, daß sich die Fronten zwischen der DDR-Führung und der ostdeutschen Bevölkerung bis zum Mauerfall im Herbst 1989 mit stetigem Anstieg verhärten.
3.3. Das Kulturplenum
1972 findet das 6. Plenum des ZK der SED statt, das sogenannte Kulturplenum. Hier wird ein geistiger Ansatz gefunden, der bis dahin ungeahnte Chancen bietet, ein neues Verhältnis zwischen Politik und Kunst zu schaffen. Es entwickelt sich im Verlauf der Sitzung eine Perspektive, zu einer völlig neuen Kulturauffassung zu gelangen - die Mög- lichkeit, Kultur nunmehr als Herausforderung auf dem Weg zu einer neuen Gesell- schaftskonzeption sehen zu können und nicht mehr nur als einen engen, von wenigen gestalteten Raum. Die Umsetzung eines neuen Umganges mit Kunst und Kultur bleibt allerdings aus, da die Voraussetzungen für eine so tiefgreifende Richtungsänderung denkbar schlecht sind. Die Änderung der Kulturpolitik würde natürlich eine qualitative Veränderung der Gesamtpolitik mit einschließen, wozu man in den Führungsreihen der SED nicht bereit ist. Neue inhaltliche Ansätze und Schaffensmethoden werden entweder abgelehnt, oder zu Formen der Repräsentationskunst für den Staat umfunktioniert.
3.4. Die politische Atmosphäre innerhalb der DDR
Die politische Entwicklung der DDR von 1970 bis zur Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 erweckt bei vielen ostdeutschen Bürgern Hoffnungen und Erwartungen, die aber von der SED-Führung nicht - oder nur in geringem Maße erfüllt werden. Viele DDR- Bürger möchten keine Verluste mehr in ihren demokratischen Bewegungsmöglichkeiten hinnehmen. Durch die Wirtschaftspolitik der vergangenen fünf Jahre ist der Eindruck entstanden, daß es deutlich aufwärts ginge. Besonders durch den Machtwechsel 1971, das Kulturplenum 1972 und die KSZE-Gipfelkonferenz 1975 entsteht bei vielen Bür- gern der DDR der Eindruck, daß der demokratischen Mitgestaltung eine wesentlich größere Rolle in der Alltagspolitik zukommen werde. Das Klima der frühen 70er Jahre läßt Ermutigungen aufkommen, den politischen Zwiespalt innerhalb der DDR zumindest zur Diskussion zu stellen. Die Jahre vor der Ausbürgerung des Liedermachers lassen darauf hoffen, daß mit kritischen Künstlern und Intellektuellen der DDR, wie Stefan Heym, Robert Havemann und Wolf Biermann toleranter umgegangen wird. In diesen Jahren gibt es eine Mehrheit der DDR-Bevölkerung, die mit der Überzeugung lebt, daß ihre DDR als die gesellschaftliche Alternative zum anderen Teil Deutschlands dem Ver- gleich standhält. Das Fatale der Situation besteht darin, daß die SED-Führung unter den DDR-Bürgern einerseits viele neue Hoffnungen erweckt, in eine, wenn auch vorsichtige aber konstruktive Diskussion über Demokratisierungsmöglichkeiten des staatlichen Sys- tems einzusteigen. Da diese Versprechungen aber nicht eingehalten werden, setzt ande- rerseits durch die eigentliche Unfähigkeit zur Auseinandersetzung innerhalb der politi- schen Führung eine Entmündigung der Bürger in neuen Qualitäten ein.
4. Wolf Biermann in der ersten Hälfte der 70er Jahre bis zu seiner Ausbürgerung 1976
Auch Wolf Biermann gegenüber gibt es bescheidene Anzeichen toleranter Haltung der Partei- und Staatsführung. Auftritte im westdeutschen Fernsehen im Juni 1972, längere Interviews wie mit dem Spiegel im Oktober 1973 und eine Schallplattenproduktion mit dem amerikanischen Plattenkonzern CBS werden zur Kenntnis genommen, ohne daß daraus Repressalien erwachsen. Dennoch entwickelt die Staatssicherheit schon Anfang der 70er Jahre eine Strategie für eine mögliche Ausbürgerung Biermanns. Als er 1974 zu seiner Großmutter nach Hamburg reisen darf, wird der Gedanke der Ausbürgerung ernsthaft in Erwägung gezogen. Das Strategiepapier der Staatssicherheit von 1973 macht den Ernst der Lage deutlich:
„Mit dem Ziel der Aberkennung der Staatsbürgerschaft, die gemäß § 13 Staatsbürgerschaftsgesetz voraussetzt, daß BIERMANN während sei- nes Aufenthaltes im nichtsozialistischen Ausland in grober Weise die staatsbürgerlichen Pflichten verletzt (...), soll die Beantragung einer Reise durch BIERMANN in dringenden Familienangelegenheiten zu seiner Großmutter nach Hamburg erreicht werden.“[7]
Für diese Maßnahme erweist sich der Anlaß der Reise für die Regierung der DDR al- lerdings als äußerst ungünstig und bietet auch zu wenig Legitimationsraum. Die SED entscheidet sich 1974 im Zusammenhang mit Wolf Biermanns Reise zu seiner totkran- ken Großmutter somit gegen eine Ausbürgerung des Liedermachers. Im September 1976 tritt Wolf Biermann seit dem Verbot 1965 erstmals wieder in der DDR auf. Die evangelische Kirchengemeinde der Nikolaikirche in Prenzlau (Uckermark) lädt den Lie- dermacher ein, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Die Veranstaltung wird weder ge- nehmigt noch verboten. Zum einen liegt es wohl daran, daß Wolf Biermann hier im Rahmen eines Gottesdienstes auftritt und deshalb keine polizeiliche Anmeldepflicht von nöten ist. Zum andern erscheint es rückblickend, als hätten die führenden Parteimitglie- der das Treffen in der Nikolaikirche vor allem deshalb erlaubt, um bei Biermann die Hoffnung auf eine günstige Wende in der Behandlung seines Falles zu erwecken.
5. Die Ausbürgerung
5.1. Das Konzert und die Maßnahme gegen Wolf Biermann
Kurz nach dem Auftritt in der Prenzlauer Nikolaikirche wird Wolf Biermann im Rahmen einer Jugendwoche der IG Metall für verschiedene Veranstaltungen nach Westdeutsch- land eingeladen. In Köln soll das erste Konzert stattfinden. Die Reise wird dem Lieder- macher innerhalb kurzer Zeit nach der Antragstellung vom Minister für Kultur der DDR ohne den üblichen bürokratischen Aufwand genehmigt. Am 13. November 1976 tritt Wolf Biermann in der Kölner Sporthalle auf. Der WDR 2 sendet das Konzert life in der „Radiothek“, die ARD zeichnet es auf und sendet es einen Tag später. Beide Sender können sowohl im Westen wie auch im Osten Deutschlands empfangen werden. Auf seinem vierstündigen Konzert läßt es sich Wolf Biermann nicht nehmen, den Sozialismus in der DDR scharf zu kritisieren, ihn aber auch vehement zu verteidigen. Als er sein Lied singt: So soll es sein, so oder so, die Erde wird rot, sagt er dazu:
„Ich dachte (...), als ich dieses Lied schrieb, an den guten Satz von Marx, der sagte, daß die Menschheit entweder einen Weg zum Sozialismus, zu einer kommunistischen Gesellschaft finden würde, oder sie wird in die Barbarei versinken.“[8]
Und an anderer Stelle sagt er:
„(...) noch dazu [hat die DDR] einen Sozialismus serviert gekriegt von der Roten Armee, der eben, wie es in meinem ‘Wintermärchen’ heißt, ‘halb Menschenbild, halb Tier’ war (...). Aber nun muß man ja nicht immer wieder die alten Fehler machen. Vielleicht können die Fehler in der DDR, die Erfahrungen, vornehmer ausgedrückt, auch etwas nützen. Aber natürlich nur, wenn man zur Kenntnis nimmt, wenn man die Gn a- de hat, sie zur Kenntnis zu nehmen (...).“[9]
Als Wolf Biermann nach elf Jahren Berufsverbot sein erstes großes Konzert vor 6500 Menschen gibt, wird in Wandlitz seine Ausbürgerung beschlossen. Während des Konzertes singt Wolf Biermann auch sein neues Lied: Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier. Danach sagt Biermann: „diese beiden Zeilen (...) drücken sehr genau den politischen Gemütszustand vieler junger Menschen in der DDR aus (...).“[10] Vier Tage nach dem Kölner Konzert, am 17. November 1976 wird über den ADN (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst) bekanntgegeben:
„Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann (...) das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Re- publik entzogen. (...) Mit seinem feindseligen Auftreten gegenüber der
Deutschen Demokratischen Republik hat er sich selbst den Boden für die weitere Gewährung der Staatsbürgerschaft entzogen. (...)“[11]
Das „feindselige[ ] Auftreten“ wird von der SED-Regierung unter anderem mit einer Äußerung Wolf Biermanns gerechtfertigt, die in keiner Weise als Diffamierung der DDR gedacht ist, von der Regierung aber als solche benutzt wird: Die auf seinem Konzert gemachte Aussage Biermanns „(...) ich bin zu jeder Schandtat bereit.“[12] bezieht sich auf den Zwischenruf eines Zuhörers, eine Zugabe zu geben, und nicht etwa darauf, daß Biermann zu jeder Schandtat gegen die DDR bereit wäre. Schon allein an diesem Bei- spiel läßt sich das engstirnige und unkooperative Vorgehen der DDR-Führung im Kon- flikt mit Wolf Biermann erkennen.
5.2. Das Verhältnis zwischen DDR-Staat und Wolf Biermann
Wolf Biermann ist schon lange vor seiner Ausweisung äußerst ‘ungemütlich’ für die SED-Führung gewesen. Er ist für die DDR-Regierung so etwas wie eine ständige Erin- nerung an die Divergenz, die zwischen dem politischen Anspruch und seiner Realität besteht. In seinem Gedicht Warte nicht auf beßre Zeiten wird der Zwiespalt der DDR zwischen ihren behaupteten sozialistischen Zielen und dem real existierenden Sozialismus besonders deutlich:
„(...) Und das beste Mittel gegen / Sozialismus (sag ich laut) / ist, daß ihr den Sozialismus / AUFBAUT!!! Aufbaut! (aufbaut)“[13]
Immer wieder spielt Biermann der in ihrer Politik erstarrten DDR-Führung ihre eigene Melodie vor und ist doch überzeugt davon, daß die DDR der bessere der beiden deut- schen Staaten ist. Die Irritation, die er bei der Regierung der DDR auslöst, besteht dar- in, daß er ihr nicht als Klassenfeind gegenübersteht, sondern in den eigenen Reihen ver- sucht, Kritik zu üben. Er kritisiert die Politoberen des Staates mit ihren eigenen Argu- menten und verliert dennoch sein Vertrauen in die Idee des Kommunismus nicht. Was Wolf Biermann für viele Hörer neben seinen provokanten Texten interessant macht, ist die Tatsache, daß er sich einmischt, ohne auf Sinnlichkeit zu verzichten: Er singt seine Lieder nicht nur, er weint, stöhnt, jauchzt und seufzt sie auch. Seine Stimme setzt der Liedermacher also völlig anders ein, als es die bürgerlichen Vorstellungen vom Belcanto erwarten lassen. Schöne Metaphern und ungeschminkte Direktheit stoßen in ein und dem selben Lied hart aufeinander, so daß seine Lieder und Gedichte eine bis dahin nicht gekannte Qualität erreichen. Diese Leitlinien einer Kunstlosigkeit laufen durch das ge- samte Werk Biermanns. In den frühen 70ern ist man in den Führungsriegen des Politbü- ros der SED noch in sehr prüden Denkschemata gefangen, so daß die genußfreudige und gefühlsbetonte Interpretationsweise seiner Lieder Wolf Biermann auch den Ruf ein- bringt, er sei ein kulturloser Mensch. Sicher wirken viele seiner Texte schockierend auf die DDR-Regierung. Dennoch gäbe es die Chance einer konstruktiven Auseinanderset- zung mit Biermann im eigenen Land. Die staatlichen und politischen Gremien unterneh- men aber nie ernsthaft den Versuch, sich mit den politischen und künstlerischen Absich- ten des Liedermachers auseinanderzusetzen. Im Gegenteil: Geradezu panisch reagiert die SED-Führung auf Wolf Biermann. Dies illustrieren einige Punkte eines Maßnahme- kataloges der Staatssicherheit. Da heißt es unter anderem:
„(...) - Zerstörung seines Persönlichkeitsbildes durch negative Beeinflussung seiner Lebensgewohnheiten, (...) - Liebesverhältnisse, die bestehen, zerstören - falsche ärztliche Betreuung (...)“[14]
Wolf Biermann muß also von der SED-Führung auf der Seite des Klassenfeindes als ein Gegner der DDR charakterisiert werden, mit dem nicht mehr zu reden ist, damit die Legitimation für die Ausbürgerung plausibel erscheint. Es darf nicht der Eindruck entste- hen, die DDR-Regierung wäre nicht fähig, Kritik differenziert aufzunehmen. Das Kon- zert in Köln im November 1976 scheint genug Gründe zu liefern, Wolf Biermann als großen DDR-Feind zu titulieren und ihn endlich ‘loszuwerden’. Daß die SED aber mit der Ausbürgerung Biermanns das genaue Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich beabsichtigt: nämlich nicht nur ihn, sondern auch seine Botschaften und Sticheleien aus dem real existierenden Sozialismus zu verbannen, erscheint rückblickend nur logisch. Vom Machtwechsel 1971 über das Kulturplenum 1972, und schließlich durch die KSZE-Gipfelkonferenz 1975 bis zu Biermanns Ausweisung hat sich die SED-Regierung ein Gerüst aus angeblichen politischen Neuerungen aufgebaut, das auf wackligem Boden steht. Es wurden Versprechungen - nicht nur im Kulturbereich - für konstruktive Ver- änderungen und mehr Demokratie im Alltag gemacht, die nicht eingehalten wurden. Ge- nau an diese Schwäche erinnert Wolf Biermann die SED-Funktionäre immer wieder ohne Unterlaß mit seinen Liedern und Gedichten. Und noch dazu tut er das über den Umweg durch den Westen - also mit Hilfe des Klassenfeindes, da ihm im Ostteil des Landes keine Publikationsmöglichkeit gegeben ist. Durch das über ihn verhängte Be- rufsverbot und seine dennoch nicht tot zu kriegende lautstarke Kritik am DDR-System erhält Wolf Biermann eine besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Schon 1972 entsteht ein Gedicht von ihm, das deutlich macht, was eigentlich erst im November 1976 durch die Ausbürgerung geschieht, vorher aber schon latent zu spüren ist:
„Das macht mich populär
(...) Drum machten sie das Angebot / Ich dürft nach Westen gehn / (Ick hör dir trapsen, Nachtigall!) / Ach, wär das für die schön! / (...) Ihr löscht das Feuer mit Benzin / Ihr löscht den Brand nicht mehr / Ihr macht, was ihr verhindern wollt: / Ihr macht mich populär / (...) Wenn ihr mich wirklich schaffen wollt / Ihr Herren hoch da droben / Dann müßt ihr mich ganz öffentlich / Nur LOBEN LOBEN LOBEN / (...)“[15]
Wolf Biermann gewinnt an politischer Öffentlichkeit und Berühmtheit, die er ohne die Ausbürgerung mit Sicherheit nicht in dem Maße erfahren hätte, und welche die DDR- Regierung gerade mit der Ausbürgerung verhindern will. Der ehemalige Minister für Kul- tur der DDR Hans-Joachim Hoffmann beschreibt im Mai 1991 ganz treffend die Para- doxie, die hinter dieser Tatsache steht, wenn er sagt:“ (...) Wie nach bekannter feudaler Sitte glaubte man, eine schlechte Nachricht aus der Welt zu schaffen, wenn man seinen Überbringer beseitigte.“[16] Was die SED-Führung aber nicht bedenkt, ist die Tatsache, daß erst nach der Zwangsexilierung viele Menschen durch den Medienrummel um Wolf Biermann von dem Liedermacher und den Intentionen in seinen Texten erfahren. Die Gedanken in seinen Liedern überschneiden sich mit den Meinungen vieler DDR-Bürger, die zwar gedacht aber bis dahin nicht laut geäußert werden. Es kommt Unruhe auf.
6. Die Folgen
6.1. Die Künstler und die Biermann-Petition
Nach der Nachricht über die Ausbürgerung Wolf Biermanns kommt es in den nächsten Tagen zu Reaktionen in der DDR, in der BRD und in ganz Europa. Es erhebt sich nach dem 17. November 1976 eine Protestwelle in der DDR, wie sie dieser Staat noch nicht erlebt hat. Der wirkungsvollste und auch folgenreichste Protest kommt von den Künst- lern. Bereits einen Tag nach der Ausbürgerung veröffentlichen 12 der anerkanntesten Schriftsteller der DDR, wie u. a. Sarah Kirsch, Christa Wolf und Stefan Heym eine Pro- testerklärung, in der es heißt:
„Wolf Biermann war und ist ein unbequemer Dichter (...). Unser sozia- listischer Staat, (...), müßte eine solche Unbequemlichkeit gelassen nachdenkend ertragen können. Wir identifizieren uns nicht mit jedem Wort und jeder Handlung Biermanns und distanzieren uns von dem Versuch, die Vorgänge um Biermann gegen die DDR zu mißbrauchen. Biermann (...) hat nie, (...),Zweifel daran gelassen, für welchen der bei- den deutschen Staaten er bei aller Kritik eintritt. Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossene Maßnahme zu überdenken.“[17]
Die Protesterklärung geht am Tage der Bekanntgabe der Ausbürgerung - am 17. No- vember 1976 um 14.30 Uhr an die Pressestelle des Neuen Deutschland. Bei ADN läuft die Erklärung gegen 18 Uhr über die westdeutsche Nachrichtenagentur DPA ein. In den bundesdeutschen Nachrichten wird sie um 19 Uhr als Spitzenmeldung verbreitet. Danach erst erhält das zuständige Politbüromitglied Kurt Hager den Text der Erklärung vom Chefredakteur des Neuen Deutschland. Die Meldung über die Petition wird also nicht über die Medien in der DDR, sondern über die Westmedien veröffentlicht. Dies wird ein wichtiger Aspekt im Verlauf der weiteren Entwicklung mit der Auseinanderset- zung der Protesterklärung sein und die DDR-Künstler in zwei Lager spalten. Die beiden deutschen Staaten stehen sich immer in strenger Beobachtung gegenüber - und die westlichen Nachrichtenagenturen begreifen sehr schnell, daß sich aus der Protesterklä- rung mehr machen läßt, wenn weltweit bekannte Künstler dahinterstehen. Die DDR wäre damit international diskreditiert, und zwar durch ihre eigenen Intellektuellen und Kulturschaffenden. Die DDR-Regierung nutzt nicht die Chance, eine öffentliche Diskus- sion über die Maßnahme gegen Wolf Biermann im eigenen Land zu ermöglichen, so daß den Unterzeichnern der Petition nichts anderes übrig bleibt, als sich an die Westmedien zu richten, wenn sie ihren Protest öffentlich machen wollen. In den nächsten Tagen er- klären sich über hundert Schriftsteller und Künstler mit der Petition solidarisch, es unter- schreiben bekannte Persönlichkeiten wie Manfred Krug, Ulrich Plenzdorf, Angelica Domröse, Armin Müller-Stahl und Bettina Wegner. Auch wenn nicht alle Künstler der DDR uneingeschränkt hinter den Texten der Lieder und Gedichte Wolf Biermanns ste- hen, ist er bis zum November 1976 für sie immer eine Orientierungshilfe gewesen, wenn es darum ging, die Toleranzgrenze der SED-Führung zu erkennen. Die Ausbürgerung Biermanns wird daher auch als radikale Maßnahme „gegen den schöpferischen und kritischen Teil der Gesellschaft gesehen, (...), der die wenigen, mehr zugestandenen als erkämpften Freiräume in der Kunst bedroht“[18] sieht. Der Aufruf hat aber trotz des Soli- darisierungseffektes unter den Künstlern und des Tempos der Verbreitung eher eine diplomatische Note. Man protestiert zwar gegen die Ausbürgerung, aber auch gegen die (S. 10).
Versuche, „die Vorgänge um Biermann gegen die DDR zu mißbrauchen.“ Die perma- nenten Spannungen zwischen Ost- und Westdeutschland lassen die Künstler der DDR ihren Protest in einer Weise verhalten erscheinen, in dem das Feindbild Bundesrepublik erhalten bleibt, und die Politik der DDR selbst nicht existentiell in Frage gestellt wird. Dennoch ist die Biermann-Petition eine in dem Maße noch nie dagewesene öffentliche Kritik an einer Entscheidung des höchsten Parteigremiums. Empörung wird vor allem auch im Zusammenhang mit der Art des Vorgehens gegen Biermann laut. Besonders die Künstler, die unter der Nazidiktatur gelitten haben, werfen der SED-Regierung vor, daß sie mit der Zwangsexilierung des Liedermachers an die Tradition des deutschen Fa- schismus im Umgang mit Andersdenkenden anknüpft. Zumindest weist die Vorgehens- weise Parallelen auf. Stefan Heym sagt in diesem Zusammenhang wenige Tage nach der Ausbürgerung in einem Gespräch zwischen einigen Petenten und dem Chef der Abtei- lung Agitation und Propaganda Werner Lamberz zur Maßnahme gegen Biermann: „(...) daß die Terminologie dieses Artikels wörtlich entnommen ist den Ausbürgerungsdoku- menten des nationalsozialistischen Staats (...). Die Ausbürgerung ist eine Nazipraxis.“[19] In jedem Fall ist die Ausbürgerung Wolf Biermanns das Ende jeglicher Illusionen über mehr künstlerische Freiheit. Mit der Ausweisung erfährt die DDR eine historische Zäsur in ihrer kulturellen Entwicklung. In den nächsten Jahren erlebt sie den größten Exodus aus den Reihen ihrer Künstler und Intellektuellen.
6.2. Die Reaktion des Staates auf die Proteste
Neu ist die kollektive Qualität, die hinter dem Protest steht. Kritik einzelner an der Poli- tik der DDR gab es schon vorher, daß aber nun eine ganze Gruppe widerspricht, zudem auch noch bekannte und beliebte Künstler und Schriftsteller der DDR, ist gefährlich für die SED-Führung. Da sie Kunst und Kultur eher als Fortsetzung der Agitation und Pro- paganda für ihren Staat ansieht, droht eine wichtige Seite ihrer Politik wegzubrechen.
Die DDR-Regierung will sich einerseits nicht ernsthaft geistig - und schon gar nicht poli- tisch mit den Künsten auseinandersetzen, braucht aber dennoch die Kultur für die Rep- räsentation ihrer Politik. Die Partei-oberen lassen die Künstler ihr engstirniges Verständ- nis von Kunst, welche vor allem der Politik zu dienen habe und als Waffe im ideologi- schen Klassenkampf eingesetzt werden müsse, auf unterschiedliche Weise spüren. Aus diesem Grund besteht in der DDR schon vor der Ausbürgerung Biermanns ein latenter - und nach der Ausbürgerung immer deutlicher sichtbar werdender unüberwindbarer Ge- gensatz zwischen dem schöpferischen Ausdruckswunsch der Künstler und den politi- schen Absichten der Regierung. Die SED-Führung versucht, Künstler und Schriftsteller dazu zu bewegen, ihre Unterschrift unter der Protesterklärung zurückzuziehen - was ihr auch bei einigen gelingt. Der Umstand, daß die Petition über die Westmedien - also durch den Klassenfeind - veröffentlicht wurde, wird hier von der DDR-Regierung ge- schickt genutzt, um die Künstler zu spalten. Gleichzeitig werden Erklärungen für die Ausbürgerung und gegen die Biermann-Petition von Künstlern eingeholt und schon am 20. November 1976 in großer Aufmachung im Neuen Deutschland und anderen Ta- geszeitungen, die in der DDR publizieren, veröffentlicht. Von der einfachen Rüge bis zum Parteiausschluß wendet die DDR-Regierung im Laufe der nächsten Monate eine Palette von unterschiedlichen Maßnahmen gegen die Petenten an. Dies sorgt für Unruhe und Uneinigkeit in den Reihen der Kulturschaffenden und unterminiert die aufkeimende Solidarität. Die SED-Regierung ist sich einer Verödung der Kulturlandschaft in der DDR sehr wohl bewußt und vollzieht deshalb eine sehr differenzierte Behandlung unter den Künstlern und Intellektuellen ihres Landes. Die Palette der Repressionen gegen die Unterzeichner der Petition reicht von zensurierenden Eingriffen in Texte über das Verbot von Büchern und Theaterstücken, Ausschlüssen von Künstlern aus der Partei bis zu Stasi-Überwachungen, strafrechtlichen Sanktionen und direkt oder indirekt erzwunge- nen Ausbürgerungen. Ein Höhepunkt dieser Maßnahmen ist 1979 erreicht, als unter der Leitung des neuen Präsidenten Herrmann Kant acht Kollegen - darunter auch Stefan Heym - aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen werden. Die Schriftsteller hatten in westdeutschen Medien einen offenen Brief an Honecker abdrucken lassen, in dem sie ihre Sorge darüber zum Ausdruck brachten, daß die Staatsorgane immer häufiger engagierte und kritische Künstler diffamierten und zu kriminalisieren versuchten. Die Künstler und Intellektuellen werden für die Politbürokratie zu einem permanenten Unsicherheitsfaktor, weil sie versuchen, die Grundpositionen des 6. Plenum des ZK der SED von 1972 zu verteidigen. Die Ausbürgerung Biermanns ist der Beginn der Aufgabe dieser Grundpositionen und damit auch des Parteiprogramms der SED. An ihre Stelle tritt die Konzeption eines devianten Sicherheitsdenkens.
6.3. Der Exodus
Bis zum November 1976 kann immerhin die Illusion aufrechterhalten werden, es gäbe den vorsichtigen Versuch, den Sozialismus in der DDR demokratischer zu gestalten und andere politische Meinungen neben der der SED gelten zu lassen. Nun ist aber der E- xodus aus den Reihen der Kulturschaffenden nicht mehr aufzuhalten. Die Integrations- kraft der SED gegenüber den Künstlern ihres Landes schwindet nach der Ausbürgerung mehr und mehr. Bekannte Persönlichkeiten wie Jurek Becker, Manfred Krug, Sarah Kirsch, Günter Kunert und Reiner Kunze verlassen enttäuscht das Land. Nach dem 17. November 1976 reißt die Kette der Antragsteller auf Ausreise in die BRD nicht mehr ab - auch viele DDR-Bürger, die nicht im kulturellen Bereich tätig sind, bemühen sich um eine Ausreise. Für viele Künstler der DDR ist Wolf Biermann bis zu seiner Ausbür- gerung - trotz Berufsverbot im eigenen Land - ein Symbol für die Tolerierung von ab- weichenden politischen Meinungen im real existierenden Sozialismus gewesen. Mit den reprimierenden Maßnahmen gegen die Unterzeichner der Biermann-Petition überwirft sich die SED mit jenen, die das Gesellschaftssystem der DDR grundsätzlich akzeptieren, aber mit ihrer Kritik an politischen Entscheidungen nicht zurückhalten. Auch wenn der Ton der Biermann-Petition ein vorsichtiger und DDR-treuer ist, ebbt spätestens mit der ignoranten Reaktion auf den Protest die Überzeugung unter den Künstlern ab, ihr Staat hätte eine weitaus größere Legitimation, als die Bundesrepublik. Der Schauspieler Man- fred Krug sagt wenige Tage nach der Ausbürgerung während des Gespräches mit Wer- ner Lamberz (siehe oben): “(...) wenn einer von drüben gesagt hat: Polizeistaat - habe ich gesagt: Gönnt ihr euch erst mal einen, der bei euch so loslegt wie Biermann bei uns, und der bei euch nicht im Knast sitzt. Was sag ich denn jetzt?“[20]
7. Die Reaktionen in der Bundesrepublik
Man befindet sich in beiden deutschen Staaten in ständiger Konkurrenz zueinander, deshalb können die Diskussionen um Biermann und seine Ausbürgerung nur im Zusam- menhang mit den angespannten Beziehungen zwischen Ost und West verstanden wer- den. In der Bundesrepublik reagiert man in Bezug auf die Ausweisung Biermanns und auf den darauf folgenden westdeutschen Medienrummel auf höchst unterschiedliche Weise. Einerseits paßt der Medienkrieg gegen die DDR, mit Ausnahme der DKP, allen Parteien ins Konzept, andererseits sehen aber auch viele Politiker eine Gefahr darin, daß Wolf Biermann nun seine politischen Absichten im Westen kundtut. Der Liedermacher übt ja nicht nur harte Kritik am Sozialismus der DDR, sondern vertritt auch die Visionen desselben. Neben positiven Reaktionen, gibt es in den politischen Reihen der Bundesre- publik auch abgeneigte Reaktionen auf Wolf Biermann. In einer Presseerklärung des damaligen stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Heinrich Windelen heißt es:
„(...) Biermann ist in unserer Gesellschaft sicher ein extremer Außenseiter. Wenn die Behandlung seines Falles Schule macht, wird demnächst vermutlich ein abgeschobener Faschist im ARD-Programm zu hören sein, denn mit welchem Recht (Kurt Schumacher - SPD - : Kommunisten sind rotlackierte Nazis) will die ARD ihm verweigern, was sie dem Kommunisten Biermann zugestand?“[21]
Die Bundesrepublik muß sich zudem auch mit eigenen innenpolitische Spannungen aus- einandersetzen, die sich zur Zeit der Ausbürgerung auf einem gesellschaftlichen Höhe- punkt befinden. Der Antikommunismus erreicht in der Bundesrepublik in den Jahren 1976 und `77 - nicht zuletzt durch die Ereignisse um die RAF - eine Hochphase. Es kommt Angst auf, daß Überlegungen zum Sozialismus, wie sie Biermann in seinen Lie- dern vertritt, um sich greifen könnten und die Linken in der BRD stärken könnten. Auch in der Bundesrepublik kann man die Intentionen des Liedermachers Wolf Biermann nur schwer einer eindeutigen politischen Richtung zuordnen. Das Mitglied der SPD- Bundestagsfraktion Dieter Lattmann beschreibt in einer Erklärung an den SPD- Pressedienst sehr passend, daß es unter den o. g. Bedingungen sowohl für den Westen wie auch für den Osten Deutschlands sehr schwierig ist, Wolf Biermann in ein eindeuti- ges Schema zu pressen:
„In der DDR bezeichnet ihn die offizielle Medienpolitik inzwischen als Rechten. Bei uns kann er vorläufig nur weit links von der SPD stehen (...). Biermann ist zu einer Symbolfigur geworden für ein geistiges Grenzgängertum, das sich nirgendwo binden läßt. (...)“[22]
8. Fazit
Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Drei Wochen später findet das erste öffentliche Konzert Wolf Biermanns in der DDR nach einem Vierteljahrhundert in Leipzig statt. Dreizehn Jahre nach der Ausbürgerung des Liedermachers entschuldigt sich die DDRRegierung offiziell für die Maßnahmen gegen Wolf Biermann.
Im ständigen Konflikt zwischen politischer Bevormundung und Einengung künstlerischer Freiheiten auf der einen und einer aus unterschiedlichen Gründen gewachsenen inneren Verbundenheit mit der DDR auf der anderen Seite haben viele Künstler nicht ohne schmerzhafte Enttäuschung ihr Land verlassen. Zehn Jahre nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns waren aus dem Kulturbereich mehr als 350 Künstler auf legalem oder illega- lem Weg aus der DDR in den Westen übergesiedelt. 200 davon aus dem Bereich Mu- sik und Theater, fast 70 Unterhaltungskünstler, 20 Mitglieder des Schriftstellerverbandes und 15 Mitglieder des Verbandes Bildender Künstler. Neben den Kulturschaffenden, die ihr Land verließen, gab es unter denen, die blieben unterschiedliche Umgangsformen mit der Einengung künstlerischer Freiheit. Genauso wie die SED-Regierung auf sehr unterschiedliche Weise auf die Proteste ihrer Kulturschaffenden reagierte, verhielten sich die Künstler ihrerseits sehr verschieden in Bezug auf die Repressalien, die man ihnen auferlegte. Es standen sich nicht einfach auf der einen Seite die Künstler und auf der anderen Seite die Partei als Feinde gegenüber. Der Zwiespalt zwischen Kunst und Poli- tik war komplizierter und muß differenzierter betrachtet werden. Einige Künstler gingen in die innere Emigration, andere wiederum sahen im Beantragen eines mehrjährigen Ar- beitsvisums für das westliche Ausland eine Zwischenlösung. Da die DDR durch die Abwanderung ihrer Künstler im Kulturbereich immer mehr an Substanz verlor, gab es für die in der Heimat verbliebene künstlerische Intelligenz Mittel, Zugeständnisse politi- scher und künstlerischer Art von der Regierung zu erpressen, und sie machte davon auch immer häufiger Gebrauch. Diese Situa-tion wurde auch von der SED und den Be- hörden zugunsten ihrer Interessen genutzt. Der Kampf zwischen Agitation und Kultur wurde immer härter und gleichzeitig subtiler. Der erste Ministerpräsident der DDR Otto Grotewohl hatte im August 1951 bei der Konstituierung der „Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten“ gesagt:
„Literatur und bildende Künste sind der Politik untergeordnet, aber es ist klar, daß sie einen starken Einfluß auf die Politik ausüben. Die Idee in der Kunst muß der Marschrichtung des politischen Kampfes folgen. Denn nur in der Politik können die Bedürfnisse der werktätigen Men- schen richtig erkannt und erfüllt werden. Was sich in der Politik als richtig erweist, ist es auch unbedingt in der Kunst.“[23]
Mit dieser Fehleinschätzung der Aufgabe von Literatur und Kunst war die ständige Aus- einandersetzung mit der künstlerischen Intelligenz vorprogrammiert. Kritische Literatur und Kunst hatte - wenn überhaupt - dann nur eine geringe historischen Chance in der Ines Otto, Wolf Biermann HA, SS 98 21
Geschichte der DDR. Wolf Biermann war vielleicht der wirksamste Kritiker der DDR. Zwischen ihm und der SED stießen nicht nur abweichende Meinungen aufeinander, son- dern unterschiedliche Haltungen, Verkehrsformen und Ziele. Der Liedermacher kehrte sich von all jenen Dogmen und Autoritäten der DDR ab, die er nicht nur als Beiwerk des sozialistischen Staates begriff, sondern als Strukturmerkmal. Trotz - oder gerade wegen der politischen Intention in seinen Texten sang er seine Lieder nie getrennt von Emotionen. Da er seine Kritik laut und öffentlich und mit enorm kunstlosem Kunstvers- tand vortrug, wurde er zu solch einem großen Ärgernis für die Parteiführung. Wolf Biermann, für den Kritik und Ungehorsam lebensnotwendig sind, hätte nur eine Chance gehabt, wenn er diesen Anspruch aufgegeben hätte, aber was wäre dann noch vom Liedermacher Wolf Biermann geblieben?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] Wolf Biermann: Die Zeit , 1990, zitiert in: Jay Rossellini: Wolf Biermann, Verlag C. H. Beck München 1992 (S. 10).
[2] Wolf Biermann: Die Drahtharfe. Balladen Gedichte Lieder, Klaus Wagenbach Verlag Berlin 1965 (S. 53).
[3] zitiert in: Wolfgang Kenntemich, Manfred Durniok, Thomas Karlauf (Hrsg.): Das war die DDR. Eine Geschichte des anderen Deutschland, Rowohlt Berlin 1993 (S.147).
[4] zitiert in: Siehe Anm. 3, (S.149).
[5] zitiert in: Dietmar Keller, Matthias Kirchner (Hrsg.): Biermann und kein Ende. Eine Dokumentation zur DDRKulturpolitik, Dietz Verlag Berlin 1991 (S. 89).
[6] zitiert in: Siehe Anm. 3, (S. 199).
[7] Horst Domdey: Der Anfang vom Ende. 1976, Wolf Biermanns Ausbürgerung (S. 175-191) in: Bernd Wilczek (Hrsg.): Berlin - Hauptstadt der DDR 1949-1989, Elster Verlag Baden-Baden 1995.
[8] zitiert in: Siehe Anm. 5, (S. 98).
[9] zitiert in: Siehe Anm. 5, (S.105, 106).
[10] zitiert in: Siehe Anm. 5, (S. 103).
[11] Siehe Anm. 5, (S.127,128).
[12] Siehe Anm. 7, (S.100).
[13] Siehe Anm. 2, (S. 66).
[14] zitiert in: Siehe Anm. 7, (S. 182-183).
[15] Wolf Biermann: Für meine Genossen. Hetzlieder, Gedichte, Balladen, Wagenbach Verlag Berlin 1972 (S. 47-50).
[16] zitiert in: Siehe Anm. 5, (S. 131).
[17] zitiert in: Dissidenten? Texte und Dokumente zur DDR-„Exil“-Literatur, Volk und Wissen Verlag 1991
[18] Bernd Wagner zitiert in: Hermann Glaser: Deutsche Kultur 1945-2000, Carl Hanser Verlag 1997 (S. 356).
[19] Manfred Krug: Abgehauen. Ein Mitschnitt und ein Tagebuch, Econ Taschenbuch Verlag, Düsseldorf und München 1996 (S. 42).
[20] Siehe Anm. 19, (S. 111).
[21] zitiert in: Siehe Anm. 5, (S. 150).
[22] zitiert in: Siehe Anm. 5, (S. 153).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text analysiert am Beispiel Wolf Biermann, was mit einem Staat passiert, der viele seiner Künstler verliert, nachdem deren Schaffen eingeengt wurde. Es wird untersucht, ob die staatliche Tolerierung von Kunst ein Zeichen für die innere Stärke eines Landes ist und ob die Ausbürgerung Biermanns im November 1976 die Anfänge eines staatlichen Zerfalls aufzeigt.
Wer ist Wolf Biermann?
Wolf Biermann ist ein Liedermacher und Lyriker, der in der DDR lebte und aufgrund seiner kritischen Texte und Auftritte ausgebürgert wurde. Er stammte aus einer kommunistischen Familie und zog 1953 von Hamburg in die DDR.
Warum wurde Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert?
Die Ausbürgerung erfolgte im November 1976, nachdem Biermann in Köln ein Konzert gab, in dem er den Sozialismus in der DDR scharf kritisierte. Die DDR-Regierung warf ihm "feindseliges Auftreten" vor und entzog ihm das Recht auf weiteren Aufenthalt.
Welche Rolle spielte die Kulturpolitik in der DDR bei der Ausbürgerung?
Die DDR-Führung sah in Kunst und Kultur vor allem ein Mittel zur Agitation und Propaganda für ihren Staat. Kritische Künstler wie Biermann wurden als Bedrohung wahrgenommen, da sie den Anspruch der SED auf Hegemonie in Kultur und Gesellschaft in Frage stellten. Das Kulturplenum von 1972 versprach zwar eine neue Kulturauffassung, wurde aber nicht umgesetzt.
Wie reagierten die Künstler und Intellektuellen der DDR auf die Ausbürgerung Biermanns?
Viele Künstler und Schriftsteller protestierten gegen die Ausbürgerung Biermanns. 12 anerkannte Schriftsteller veröffentlichten eine Protesterklärung. Über hundert weitere Künstler schlossen sich an. Dies führte zu Repressionen durch die DDR-Regierung, bis hin zum Ausschluss aus dem Schriftstellerverband und zur erzwungenen Ausbürgerung.
Welche Folgen hatte die Ausbürgerung Biermanns für die DDR?
Die Ausbürgerung führte zu einem Exodus von Künstlern und Intellektuellen aus der DDR. Viele verließen enttäuscht das Land, während andere in die innere Emigration gingen. Die Integrationskraft der SED gegenüber den Künstlern schwand.
Wie wurde die Ausbürgerung Biermanns in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen?
In der Bundesrepublik gab es unterschiedliche Reaktionen. Einerseits passte der Medienrummel gegen die DDR vielen Parteien ins Konzept, andererseits sahen einige Politiker eine Gefahr darin, dass Biermann nun seine politischen Absichten im Westen kundtat. Es gab Angst, dass seine sozialistischen Ideen die Linken in der BRD stärken könnten.
Was war die Biermann-Petition?
Die Biermann-Petition war eine Protesterklärung von Künstlern und Schriftstellern gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Sie wurde am 17. November 1976 veröffentlicht und von vielen bekannten Persönlichkeiten unterzeichnet. Ziel war es, die beschlossene Maßnahme zu überdenken.
Welche Maßnahmen ergriff die DDR-Regierung gegen die Unterzeichner der Biermann-Petition?
Die DDR-Regierung wendete eine Palette von Maßnahmen gegen die Petenten an, von Zensur und Verboten bis hin zu Parteiausschlüssen, Stasi-Überwachungen und erzwungenen Ausbürgerungen. Ziel war es, die Künstler zu spalten und die Solidarität zu unterminieren.
Was geschah nach dem Fall der Mauer mit Wolf Biermann?
Drei Wochen nach dem Fall der Mauer gab Wolf Biermann sein erstes öffentliches Konzert in der DDR nach einem Vierteljahrhundert. Die DDR-Regierung entschuldigte sich offiziell für die Maßnahmen gegen ihn.
- Quote paper
- Ines Otto (Author), 1998, Wolf Biermanns Ausbürgerung und die Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95731