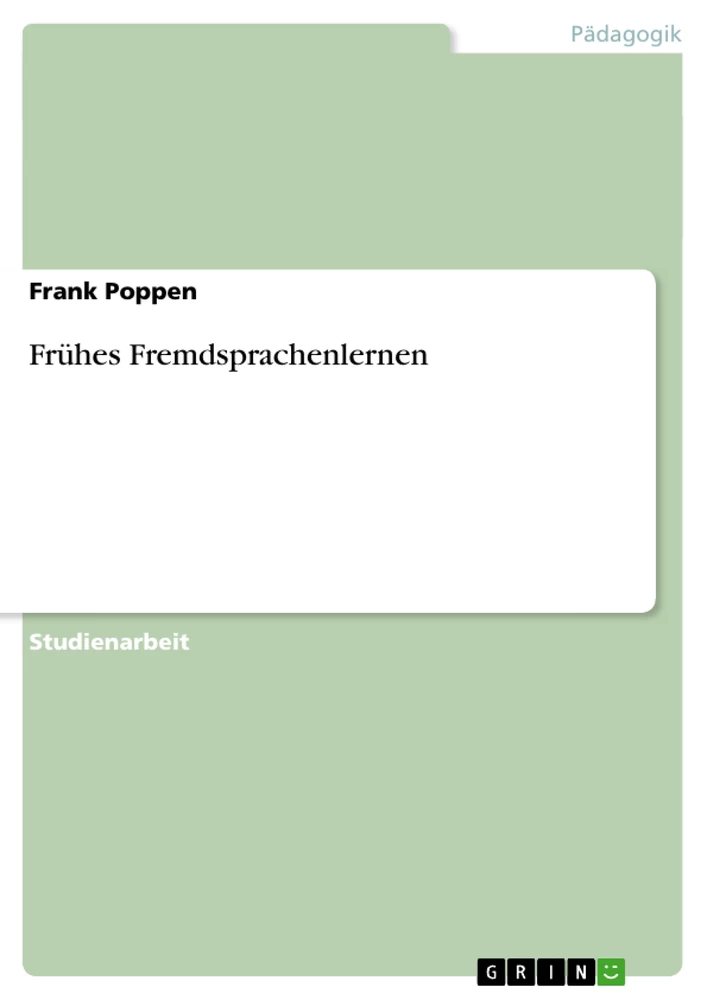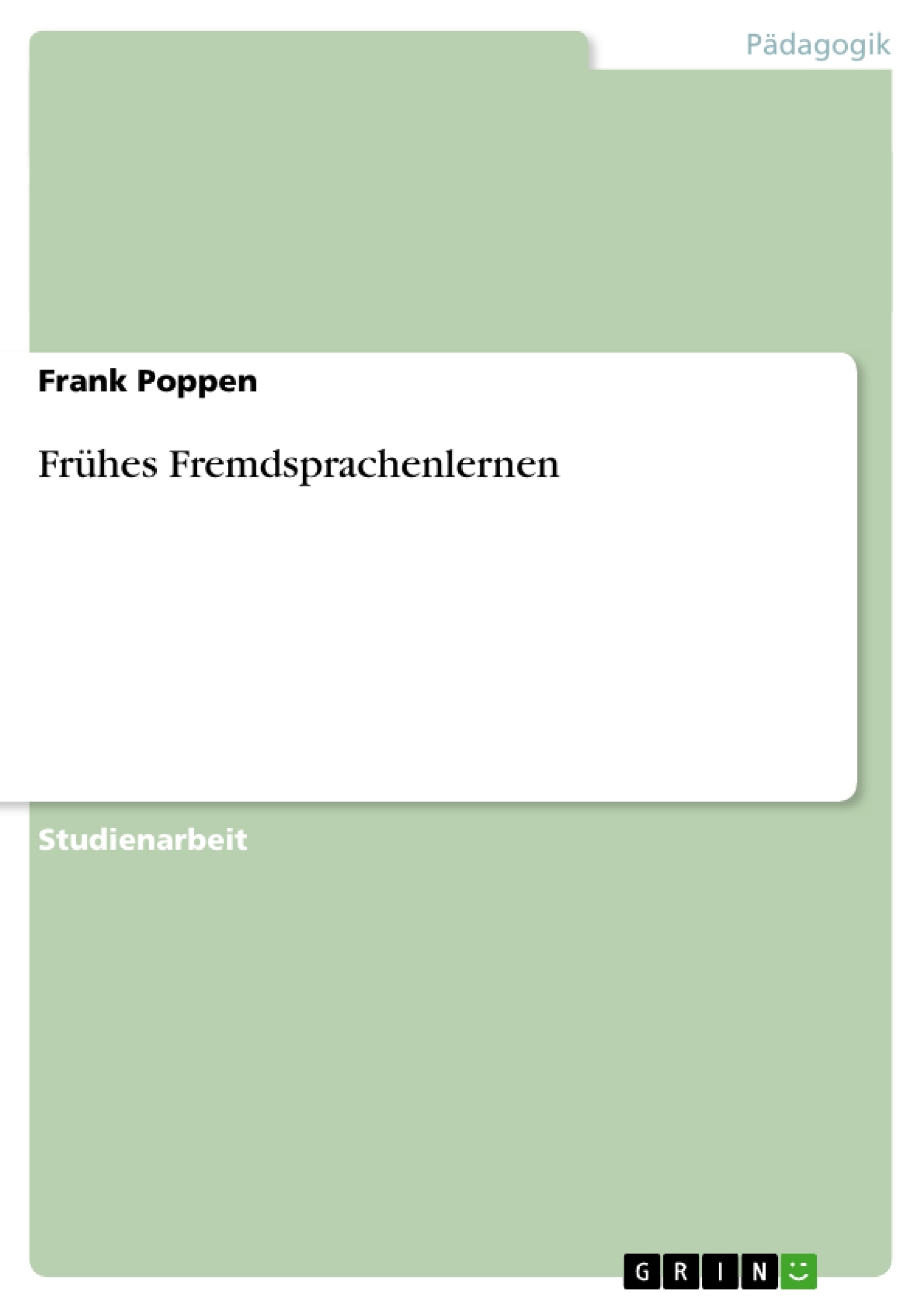Inhaltsverzeichnis
Teil 1: Theoretische Begründung des frühen Fremdsprachenlernens
1. Einleitung
2. Psycholinguistik
3. Psychologische, physiologische und pädagogische Begründungen
4. Sprachbewußtheit
5. Der kulturelle Aspekt
6. Welche Sprache?
7. Systematischer Fremdsprachenunterricht
8. Begegnung mit Sprachen
Teil 2: Analyse der Rahmenrichtlinien Sachunterricht
1. Einleitung
2. Aufgaben und Ziele
3. Analyse der Lernfelder
3.1 ,,Zusammenleben der Menschen"
3.2 ,,Menschen und heimatlicher Lebensraum"
3.3 ,,Sicherung menschlichen Lebens"
3.4 ,,Mensch und Natur / Mensch und Technik"
4. Ideen für den Unterricht
4.1 Spiele zum Thema
4.2 Erkundung
Frühes Fremdsprachenlernen
Diese Arbeit zum frühen Fremdsprachenlernen besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil soll aus einer theoretischen Grundlegung bestehen. Im zweiten Teil soll dann eine Analyse der Rahmenrichtlinien des Sachunterrichts bezüglich der Anknüpfungspunkte zum Fremdsprachenunterricht vorgenommen werden.
Teil 1: Theoretische Begründung des frühen Fremdsprachenlernens
1. Einleitung
In diesem Teil der Arbeit möchte ich einen Überblick über verschiedene Begründungen des frühen Fremdsprachenlernens geben. Dabei soll nach der Beschreibung der Erkenntnisse aus der Psycholinguistik und der Psychologie auch eine Betrachtung der sog. Sprachbewußtheit erfolgen. Weiterhin soll aufgezeigt werden, welche Bedeutung kulturelle Aspekte für den Anfangsunterricht in einer Fremdsprache haben, und im Anschluß daran sollen Überlegungen über die Wahl der Fremdsprache und die Bedeutung des Englischen für Grundschüler dargestellt werden. Am Ende dieses Teils werden die Konzeptionen, die sich bisher aus den Forschungen ergeben haben, kurz dargestellt und ihre Vor- und Nachteile erläutert.
2. Psycholinguistik
Die Psycholinguistik weist auf eine Grundausstattung des Menschen zum Erlernen von Sprache. Bleyhl (1996) stellte Überlegungen über die Wahrnehmung und Bedeutung dieser Grundausstattung für den Fremdsprachenunterricht an. Dabei bezieht er sich auf die Grundlagen der Psycholinguistik von Hörmann (1981). Eine der Fähigkeiten, die in diesem Kontext beachtet werden muß, ist die Fähigkeit die nichtsprachlichen und sprachlichen Akte zeitlich zu strukturieren. Dieses zeigt sich beispielsweise schon bei Säuglingen, die nämlich schon imstande sind, ihre Körperbewegungen mit der Zeitgestalt der an sie gerichteten Sprache zu synchronisieren (vgl. Bleyhl 1996, S. 23). D. h. die Aufnahme sprachlicher Äußerungen und ihre Verarbeitung sind auch mit körperlicher Aktivität im Sinne von Bewegung direkt verbunden. Bleyhl sieht diese Fähigkeit, die sich im natürlichen Erstsprachenerwerb sehr deutlich zeigt, im schulischen Fremdsprachenunterricht als zu wenig in Anspruch genommen (vgl. ebd. S. 25). Es ergibt sich hieraus ein Argument für das frühe(re) Fremdsprachenlernen: Grundschulkinder sind bewegungsfreudig und aktiv. Sie lassen sich auf einen Unterricht ein, der Sprache mit Musik und Bewegung verbindet und folgen somit einer natürlichen Fähigkeit, die sich beim Erlernen einer Fremdsprache besonders positiv auswirkt, weil sie dem Erstsprachenerwerb sehr ähnlich ist. Jedoch nicht nur die Aufnahme von Sprache ist hier von Bedeutung , sondern ebenso ihre Produktion. Körperliche Bewegung ist also auch mit dem aktiven Sprechen zu verbinden.
Mit Bewegung zu beginnen entspricht auch der von Bruner (1974) entwickelten Stufung Enaktiv, Ikonisch, Symbolisch: Erst nachdem Sprache und Welt ,,in der physischen Bewegung, im interaktiven Handeln" (enaktiv) erlebt wurde, bezieht sie sich auf eine abstraktere Ebene (das Bild = ikonisch) (Bleyhl 1996, S. 27). Nach Durchlaufen dieser ersten beiden Stufen ,,ist eine gewisse intersubjektive Sicherheit über die Bedeutung einer gewissen Anzahl sprachlicher Zeichen erreicht", die dann als Symbol-Zeichen genutzt werden können (ebd.). Für das frühe Fremdsprachenlernen sind somit in erster Linie die ersten beiden Stufen relevant. Vor diesem Hintergrund ist der weitgehende Verzicht auf Lesen und Schreiben im fremdsprachlichen Anfangsunterricht leicht nachvollziehbar.
Spracherwerb ist ein Prozeß innerer Regelbildung, der in Stufen abläuft. Dabei wirkt ein Apparat, der die Regeln bildet, indem vom Lernenden fortlaufend Hypothesen gebildet werden, die an dem ihn umgebenden Sprachgebrauch kontrolliert werden (vgl. Helwig, 1995, 27). Es entsteht so nach und nach eine immer bessere Beherrschung der zu erlernenden Sprache. Dabei helfen verschiedene Strategien: z.B. die Verwendung von Formeln (um etwas bitten, jemanden begrüßen...), die Vereinfachung der Struktur der Zielsprache (z.B. Sprechen im Infinitiv) und die Übertragung von Wissen auf den Erstsprachenerwerb (vgl. ebd.). Bei Grundschülern liegt der Erstsprachenerwerb noch nicht lange zurück. Daher spricht einiges dafür, den Unterricht möglichst ,,natürlich" zu gestalten, indem man früh damit beginnt.
3. Psychologische, physiologische und pädagogische Begründungen
Bei der Suche nach dem optimalen Alter für den Beginn des Fremdsprachenlernens spielte anfangs die Entwicklungspsychologie eine wichtige Rolle. Man glaubte, daß Kinder unter zehn Jahren fremde Sprachen schnell und ohne Mühe lernen. Einige Psychologen betonten schon in den 50er Jahren die emotionale Bereitschaft der Kinder, sich verbal auszudrücken und beschrieben die enormen intellektuellen Fähigkeiten, wie z.B. die starke Imitationsfähigkeit desKindes (vgl. Doyé 1993, S. 50). Für die Verfechter des frühen Fremdsprachenlernens in den 60er und 70er Jahren bildeten diese Forschungsgrundlagen eine gute Basis für ihre Argumentation. Zu diesen Verfechtern zählt auch Anderson mit seiner Annahme, daß Sprachenlernen vor dem zehnten Lebensjahr durch Konditionierung geschieht, bevor es anschließend mehr und mehr strukturierenden Charakter bekommt (vgl. ebd.). Die neuere Entwicklungspsychologie zeigt jedoch einige Einschränkungen in dieser Argumentation. Heute geht man nicht mehr von einem Durchlaufen aller Menschen durch die gleichen, zeitlich feststehenden Entwicklungsphasen aus und sieht in der früheren Forschung eine Überschätzung des Anteils an der Reifung, die durch Anlagen bedingt ist (vgl. ebd., S. 51).
Die Physiologie erforschte die Anpassungsfähigkeit des Gehirns in den verschiedenen Lebensaltern. Auch hierbei kam man auf Ergebnisse, die für einen frühen Beginn beim Erlernen von Sprache sprechen. Und auch hier wird gerade die Imitationsfähigkeit des Kindes unter neun Jahren als besonders hilfreich herausgestellt. Doyé kritisiert hieran die einseitig positive Darstellung des Anteils imitativen Lernens (vgl. ebd., S. 53). Ältere Menschen verwenden andere Strategien beim Lernen, die eher strukturierenden Charakter und planerisches Vorgehen betonen, so daß sie beim Spracherwerb nur einen anderen Weg gehen, der ihrem Alter entspricht und sie letztendlich zu vergleichbaren Ergebnissen bringen kann. Früh mit dem Lernen der Fremdsprache zu beginnen hat jedoch den Vorteil, daß die Sprachaneignung auf spielerische Weise ohne großen Druck von außen erfolgen kann. Die ,,imitative Phase" ist so gesehen eine Grundlage, die sich positiv auf das weitere Lernen auswirkt, weil sie in der Regel eine positive Einstellung des Kindes gegenüber der Sprache schafft.
Weiterhin führt Doyé eine pädagogische Begründung für den frühen Umgang mit einer Fremdsprache an. Kinder begegnen in ihrer heutigen Lebenswelt einer Vielzahl von Kulturen und Sprachen. Durch den gestiegenen Anteil ausländischer Mitschüler haben die meisten Kinder heute direkten Kontakt zu fremden Sprachen. Doch nicht nur in der Schule, sondern auch im Freizeitbereich finden sich durch die Zunahme des Medienkonsums und die steigende Zahl von Fernreisen entsprechende Konfrontation mit verschiedenen Sprachen. So haben Computer den Einzug in die Kinderzimmer erreicht, und durch die Internationalisierung der Wirtschaft haben auch Spielzeuge immer öfter englische Bezeichnungen. Die traditionelle Grundschule mit ihrer engen Bindung zum Heimatort und ihrer alleinigen Konzentration auf die Muttersprache entspricht in dieser Hinsicht nicht mehr der tatsächlichen Lebenswelt der Kinder.
Denn der Horizont eines Kindes von heute reicht in bezug auf Begegnungen mit fremden Sprachen aufgrund politischer und gesellschaftlicher Veränderungen um einiges weiter als noch vor 20 Jahren.
Die Fremdsprache, die sich am meisten in der Welt der Kinder findet, ist natürlich Englisch. Das Leben in grenznahen Gebieten und das Zusammenleben mit ausländischen Kindern sehr unterschiedlicher Herkunft läßt jedoch auch den Blick auf andere Sprachen offen. So plädieren einige Autoren (z.B. Bleyhl 1995) für andere Sprachen als Englisch für den Grundschulunterricht.
Auf jeden Fall bleibt festzuhalten, daß die bisherige Praxis, erst im 5. Schuljahr mit dem Fremdsprachenunterricht zu beginnen, lediglich auf der Tatsache beruht, daß früher die Fremdsprachen ein Teil der höheren Bildung waren und somit der Beginn zeitgleich mit dem Eintritt in das Gymnasium oder der Realschule stattfand (vgl. Doyé 1993, S. 49).
4. Sprachbewußtheit
Das von Hawkins 1985 für Großbritannien entworfene Sprachbildungsprogramm ,,language awareness" fand bei der Diskussion um Konzepte für einen frühen Beginn des Fremdsprachenunterrichts auch in Deutschland bedeutende Aufmerksamkeit. Besonders die Befürworter des Begegnungssprachenkonzepts sehen sich durch die Betonung von Sprachbewußtheit und Sprachsensibilität bestätigt.
Bei diesem Programm geht es um die Auseinandersetzung der Schüler mit mehreren Sprachen und Kulturen. Dabei wird die eigene Sprache kontrastiv mit einbezogen. Zentrale Anliegen sind dabei die Schaffung von Motivation für den Umgang mit Sprache, die Erziehung zur sprachlichen Toleranz und die Sensibilisierung für Sprache (vgl. Helwig, 1995, S. 28). Beim Sprachlernprozeß spielt die Bildung von Hypothesen und ihre Prüfung durch Ausprobieren oder Nachfragen eine wichtige Rolle. Indem Kinder über sprachliche Phänomene Auskunft verlangen und diese Erscheinungen reflektieren, zeigt sich schon bei ihnen ein bewußter Umgang mit Sprache. Sprachbewußtheit ist somit ein wichtiger Punkt beim Erlernen von Sprache(n). Aus diesem Grund müssen Kinder lernen, ,,sich sprachliche Phänomene bewußt zu machen, um Sprache lernen zu können" (Wolff, 1993, S. 511). Die bewußte Herangehensweise ergibt sich beim Auftauchen von Schwierigkeiten während des Erstsprachenerwerbs scheinbar ganz natürlich. Im Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe wird dagegen versucht, Sprachbewußtheit durch den Grammatikunterricht zu fördern (vgl. ebd., S. 516).
Wolff betont das ausgeprägte Vorhandensein von Sprachbewußtheit besonders beim bilingualen Kind. Bilinguale Kinder sind von Anfang an zwei Sprachen ausgesetzt und somit zur Trennung der beiden Sprachen gezwungen, wobei ihnen die Sprachbewußtheit eine entscheidende Unterstützung bietet. Dieses mag folgendes Beispiel verdeutlichen: ,,Johanna (Alter 4,1): Daddy, Du sprichst Deutsch und Englisch. Du sagst englische Worte, wenn es kein deutsches Wort gibt. Du sagst Shampoo" (Wolff 1993, S. 519). Das Kind ist sich hier bereits darüber im klaren, daß zwei unterschiedliche Sprachen auch über unterschiedliche Strukturen verfügen. Es verfügt somit bereits über ein hohes metasprachliches Wissen und über die Fähigkeit, eigenständig Sprache zu analysieren. Die Strategie, die bei bilingualen Kindern vorhanden ist, zeigt sich durch ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Form von Sprache, um die beiden Systeme auseinanderhalten zu können.
Beim Fremdsprachenerwerb in der Grundschule sind die Voraussetzungen durch das höhere Alter der Kinder jedoch anders. Die kognitive Entwicklung ist hier bereits weiter fortgeschritten. Sie können auf einen umfangreichen Wissenshintergrund bei der Interpretation von Äußerungen zurückgreifen, bewußter Problemlösungsstrategien beim Lernen einsetzen und beim Fremdsprachenerwerb ihre Erstsprachenkenntnisse gezielt ausnutzen (vgl. Hermann-Brennecke, 1993, S. 106).
Somit kann sich frühes Fremdsprachenlernen nicht allein auf die Nachahmung der natürlichen Situation des bilingualen Kindes beschränken. Die Lernstrategien von Grundschulkindern sind vielfältig und unterschiedlich, und der Unterricht muß diesen unterschiedlichen Strategien gerecht werden. Weiterhin wollen Kinder nicht nur über Sprache sprechen. Sie sind am Erwerb von Kompetenzen interessiert und haben Freude daran, sich (wenn auch anfangs in sehr beschränktem Maße) in einer fremden Sprache auch auszudrücken und mit ihr aktiv zu werden. Diese Motivation sollte man auch nutzen. "Language is ... not intended to be, but to do" (Lewis 1993, zitiert nach Bach 1996, S. 210).
5. Der kulturelle Aspekt
Direkt nach der Geburt ist ein Kind noch offen für ein Aufwachsen in allen denkbaren Kulturen. Es kann jede Sprache und jede Form des Zusammenlebens erlernen. Nun wird es aber in einer bestimmten Nation und Sprachgemeinschaft hinein geboren und ist somit gezwungen, eine bestimmte Sozialisation zu durchlaufen. Diese für das Kind notwendige Fixierung auf gesellschaftliche Normen geht auf Kosten der Offenheit für alle Gruppen, die andere Lebensgewohnheiten pflegen, und somit ist das Kind in der Regel bereits nach wenigen Jahren ein ,,monolingualer und monukultureller Mensch" (Doyé, 1993, S. 54). Je weniger sich Kontakte mit anderen Kulturen und Sprachen im weiteren Leben ergeben, desto mehr erfolgt eine Festlegung auf die eigenen Erfahrungen und Gewohnheiten.
Ethnographische Studien zeigten im kulturübergreifenden Vergleich, daß es im Spracherwerb keine kulturunabhängige, allgemein gültige Abfolge gibt und daß die sprachliche Eingabe nicht das Hauptanliegen der Bezugspersonen darstellt (vgl Buttjes, 1996, 85). Vielmehr gilt für den Spracherwerb, daß sprachliches und kulturelles Wissen immer zusammen gesehen werden müssen. Diese enge Verbindung ist in der ,,normalen" Unterrichtssituation nicht vorhanden. Man konzentriert sich weitgehend auf die Vermittlung entweder von sprachlichen Elementen oder von kulturellen Anteilen.
Phänomene wie die Globalisierung der Märkte und grenzüberschreitende Bedrohungen zwingen immer mehr zu internationaler Zusammenarbeit. Dazu müssen die Grenzen zwischen den Kulturen überschritten und die Kompetenz erworben werden, sich in die Situation des anderen mit seinem spezifischen Umfeld hinein zu versetzen. Diese Kompetenz zielt somit auch gleichzeitig auf eine höhere Toleranz gegenüber dem ,,Fremden". Neben den Forderungen aus Wirtschaft und Politik sollte man aber auch sehen, daß der Blick auf verschiedene Kulturen den einzelnen bereichert und seinen Horizont erweitert.
,,Wenn es nun aber aus persönlichen Gründen (Bereicherung des Individuums) wünschenswert und aus politischen Gründen (Leben in einer multikulturellen Welt) notwendig ist, die Festlegung in Grenzen zu halten oder gar zu reduzieren, dann gebietet es die Logik, dies zu einem Zeitpunkt zu versuchen, zu dem die Festlegung noch nicht so weit fortgeschritten ist, daß alternative Lebensformen neben den primär internalisierten noch eine Chance haben, akzeptiert zu werden" (Doyé, 1993, S. 54).
Durch die oben beschriebene enge Verknüpfung von Kultur und Sprache ergibt sich hiermit ein weiteres Argument für das frühe Fremdsprachenlernen. Die Grundschule ist ein Ort, in dem sich viele Sichtweisen noch nicht gefestigt haben und deshalb die Aufgeschlossenheit gegenüber dem ,,Fremden" noch vorhanden ist. Viele Grundschulklassen sind heute aufgrund ihrer Zusammensetzung multikulturell. Die Kinder wachsen deshalb bereits in einer Umgebung auf, die durch verschiedene kulturelle Einflüsse mit verschiedenen Sichtweisen geprägt ist. Somit sollte die Gleichwertigkeit der Sprachen sowie auch ihre enge Verbindung mit Gefühlen und Klischeevorstellungen thematisiert werden. Bei der Betrachtung des ,,Fremden" spielt jedoch die Beachtung des Vertrauten auch eine wichtige Rolle. Interkultuelle Handlungskompetenz zeigt sich erst, wenn eigene und fremde Gewohnheiten erkannt und gemeinsam behandelt werden (vgl. Buttjes 1996, S. 73).
Die bedeutende Rolle des Fremdsprachenunterrichts zeigt sich dabei durch die Auflösung der sonst festen Beziehung zwischen Sprache und Weltwissen (vgl. ebd., S. 78). Dieses wird durch den verfremdenden Effekt, den die neue Sprache mit sich bringt, erreicht.
6. Welche Sprache?
Zur Zeit der Entspannungspolitik innerhalb Europas in den 70er Jahren forderte man die Förderung des Fremdsprachenunterrichts zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Völkern, zum Kennenlernen anderer Kulturen und zur Erweiterung der internationalen Zusammenarbeit (vgl. Helwig 1995, S. 22).
Diese Tendenz setzte sich dann durch den Beschluß zur Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes 1992/93 weiter fort. Diese Voraussetzung und die gleichzeitigen Grenzöffnungen östlicher Länder, die bedeutende Migrationsströme in Richtung Westen zur Folge hatten, sorgen für eine neue Diskussion um den Fremdsprachenunterricht. So herrschte auch bald Einigkeit darüber, mit dem Fremdsprachenunterricht bereits in der Grundschule zu beginnen. Dabei entstanden naturgemäß z.T. konträre Meinungen und Konzepte über die Art der Verwirklichung des Unterrichts. Betonen einige Konzepte besonders einen Einstieg in den Erwerb kommunikativer Kompetenzen, treten andere dagegen für eine grundlegende Sprachsensibilisierung ein.
Ebenso unterschiedlich sind die Auffassungen über die Anzahl der Sprachen, die Einzug in den Grundschulunterricht haben sollen, sowie über die Frage, ob sich bestimmte Sprachen besonders für die Grundschule eignen.
So ist beim Konzept ,,Begegnung mit Sprachen" in Nordrhein-Westfalen neben Englisch auch der Einbezug von Nachbarsprachen wie Französisch, Niederländisch und Dänisch von Bedeutung. Dabei soll zusätzlich auf die Sprachen kultureller Minoritäten eingegangen werden. Entscheidend bei diesem Konzept ist die Eignung der Sprache für eine wirkliche Begegnung (vgl. Bebermeier 1994, S. 40). D.h. der unmittelbare Kontakt zu Sprechern dieser Sprache muß organisatorisch möglich sein, um eine lebensnahe und realistische Situation herzustellen, in der die Schüler der Sprache wirklich begegnen.
Konzepte mit Lehrgangscharakter dagegen legen sich auf eine Sprache fest, in der dann kommunikative Ziele im Vordergrund stehen. Es handelt sich dabei somit um eine Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts, wobei dieser den spezifischen Lernbedingungen in der Grundschule angepaßt wird.
Bleyhl (1995) spricht sich gegen das Englische als Unterrichtsfach an Grundschulen aus.
Dabei sieht er die Motivation für Englisch als so ausgeprägt, daß ein Frühbeginn für ihn nicht notwendig erscheint (vgl. ebd., S. 220). Weiterhin sieht er Englisch vorwiegend als weltweites Kommunikationsmittel, das aufgrund seiner Verbreitung und ständigen Gegenwart im alltäglichen Leben am wenigsten kulturbezogen und somit in dieser Hinsicht zu neutral ist (vgl. ebd., S. 221). Englisch sei deswegen eine untypische Fremdsprache und ,,mit ihr lernt man am wenigsten, daß Fremdsprachenlernen ein weiterer Sozialisationsprozeß, ein weiterer Akkulturationsprozeß ist, daß es beim Gebrauch einer anderen Sprache nicht nur um den Austausch von Worthülsen geht, sondern daß man sich bei interkultureller Kommunikation auch auf eine andere Denkweise einstellen muß" (ebd., S. 221). Somit kommt er zu dem Schluß, daß sich das Französische aufgrund seiner Andersartigkeit (andere Satzmelodie, andere Stellung des Adjektivs) für den Unterricht an Grundschulen besser eignet als Englisch. Man mag Englisch aufgrund seiner Verbreitung als relativ kulturneutral bezeichnen können. Es kommt aber m. E. darauf an, ob und wie weit der Lehrer die Kultur Großbritanniens in seinen Unterricht als Mittel zur Kontrastierung der Kulturen einbringt und sich nicht nur auf das Englische im Alltag bezieht.
7. Systematischer Fremdsprachenunterricht
Die Versuche zum frühen Fremdsprachenlernen in den 60er und 70er Jahren, neuere Experimente sowie die beschriebenen Erkenntnisse aus der Forschung bilden die Grundlage für z.T. sehr unterschiedliche Konzepte, bei denen sich auch die Zielsetzungen unterscheiden. Eines dieser Konzepte ist der systematische Fremdspachenunterricht, der u.a. auf den früheren Versuchen zur Vorverlegung des Fremsprachenunterrichts basiert. Folglich zielt dieser Unterricht auf den Erwerb einer grundlegenden fremdsprachlichen Kompetenz. Wesentliche Grundlage bei diesem Konzept ist daher auch ein systematisches Lernen mit Progression und definierten Lernzielen in einem organisierten Lernprozeß (vgl. Sauer 1993, S. 89). Dabei wird dieser Lehrgang den Bedingungen in der Grundschule angepaßt. D. h. es findet keine unreflektierte reine Vorverlegung des Beginns in der Sekundarstufe statt, sondern man versucht, den Anfangsunterricht durch spielerische und musische Elemente grundschulgemäß zu gestalten.
Hierbei sind für den Fremdsprachenunterricht eigene Unterrichtsstunden vorgesehen, die von einem Fremdsprachenlehrer mit entsprechender Ausbildung erteilt werden. Der Unterricht orientiert sich an einem Lehrwerk, und die Vermittlung ist vorwiegend mündlich- kommunikativ, eher imitativ und nicht kognitiv angelegt (vgl. ebd., S. 88). Die Sprache, die bei diesem Konzept vorwiegend gelehrt wird, ist Englisch. Die Befürworter des Konzepts begründen dies mit der Bedeutung der englischen Sprache im Alltagsleben, die auch schon bei Kindern vorhanden ist sowie mit der Bedeutung dieser Sprache für das spätere (Berufs- )Leben. Eine besonders ergebnis- und leistungsorientierte Variante dieses Konzepts ist in einigen Teilen der ehemaligen DDR zu finden. Bezug nehmend auf den frühen Russischunterricht zu DDR-Zeiten sind hier ausgewählte, besonders leistungsfähige Kinder für den frühen Beginn ausgewählt. Dabei ist der Unterricht fest im Gesamtlehrgang der Fremdsprache eingebunden. ,,Im Unterricht erfolgt ein ständiges Bewerten und Einschätzen der Leistungen sowie nach kurzer Zeit am Anfang auch Benoten... Aber indem wie in anderen Fächern Noten erteilt werden, wird die Integration in den gesamten Unterricht betont, der vorverlegte Fremdsprachenunterricht hat in diesen Klassen keine Sonderstellung" (Bahls, 1991, 81).
Helwig vertritt eine völlig andere Variante dieses Konzepts, welches das bei ihm ,,Fremdsprachenunterricht als Spielen und Lernen" heißt. Dabei setzt er zwar auch auf Ergebnisorientierung, versucht allerdings durch die Kombination von Spielen und Lernen das Aufkommen von Leistungsdruck auszuschließen. Er steht somit für einen Mittelweg zwischen Leistungsbetonung (wie beim Unterricht in der ehemaligen DDR) und einem rein spielerischen Unterricht.
Kritiker des systematischen Fremdsprachenunterrichts monieren das Ausbleiben von Vergleichen zwischen unterschiedlichen Sprachen als Mittel zur Sensibilisierung und zur Einführung in unterschiedliche Kulturen. Weiterhin kritisieren sie die Zentrierung der Lernziele auf den späteren Nutzen (z. B. für den Beruf) im Gegensatz zu einem Nutzen der Fremdsprache in der Welt der Kinder und das Fehlen einer Integration in andere Lernbereiche (vgl. Helwig 1994, S. 9).
8. Begegnung mit Sprachen
Das Konzept ,,Begegnung mit Sprachen" zielt auf eine Betonung der Behandlung von Sprachen, mit denen die Kinder im Alltag tatsächlich konfrontiert werden. In der heutigen Zeit begegnen den Kindern in und außerhalb der Schule eine Vielzahl von Sprachen. Diese Sprachen stellen im Alltag eine Ganzheit her, die nicht didaktisch aufbereitet ist. Somit bezieht man sich bei diesem Konzept neben der Bedeutung der Sprachen für die Zukunft des Kindes auch auf die gegenwärtigen Interessen des Kindes und dann auf einen unmittelbaren Nutzen der Sprache. Im Stundenplan stehen deswegen keine eigenen Stunden für den Fremdsprachenunterricht, sondern der Sprachunterricht besteht aus integrativen Phasen und aus direkten Begegnungen mit Sprechern anderer Sprachen. Ziel der Begegnungsphasen ist dabei u. a. unterschiedliche Sichtweisen und Standpunkte aufzudecken, zu verdeutlichen und zu überwinden. Der Wert der direkten Begegnung dabei ist, ,,daß der einzelne sich seiner
Eigenheiten und Besonderheiten bewußt wird, diese für ihn erfahrbar und handhabbar werden - als ein Stück Normalität des anderen, aus der Sicht der Teilnehmer/Partner" (Bebermeier, 1994, S. 40).
Jede Begegnung mit einer fremden Sprache - innerhalb und außerhalb der Schule - soll somit schulisch genutzt werden. Die Möglichkeiten der Begegnung sind deshalb sehr vielfältig: sprachliche Äußerungen von Schülern mit ausländischer Herkunft, Fragen von Schülern und Anlässe, die sich aus dem laufenden Unterricht ergeben, ermöglichen ein häufiges Einfließen von Begegnungssituationen. Genutzt werden sollen die Nachbarsprachen in grenznahen Gebieten ebenso wie die Kontaktsprachen Italienisch und Türkisch. Aber auch das Englische soll aufgrund seiner großen Bedeutung im Leben der Kinder mit einbezogen werden. Kritiker dieser Konzeption beanstanden, daß dieser Unterricht auf den Erwerb spezieller fremdsprachlicher Kompetenz verzichtet und daß die Vielzahl von Sprachen, die im Unterricht auftauchen, kaum zu bewältigen sind (vgl. Helwig 1995).
Teil 2: Analyse der Rahmenrichtlinien Sachunterricht
1. Einleitung
Im folgenden Teil der Arbeit sollen die niedersächsischen Rahmenrichtlinien des Sachunterrichts als Bezugspunkt für ein integratives Konzept zum frühen Fremdsprachenlernen analysiert werden. Dabei dienen die Didaktisch-methodischen Empfehlungen für das Fremdsprachenlernen an Grundschulen des niedersächsischen Kultusministeriums als Basis für Anknüpfungspunkte bezüglich der Ziele und Inhalte. Die Reihenfolge dabei ergibt sich durch die in den Rahmenrichtlinien genannten Lernfelder, wobei hier aufgrund des Beginns mit dem Fremdsprachenunterricht ab der 3. Klasse auch nur auf die Themen ab dieser Klassenstufe eingegangen wird.
Grundsätzlich ist die Integration des Fremdsprachenunterrichts in den Sachunterricht von der Begründung her relativ unproblematisch. Die Orientierung an der Lebenswirklichkeit der Kinder und die Betonung des spielerischen und entdeckenden Lernens finden sich in den Didaktisch-methodischen Empfehlungen für das Fremdsprachenlernen ebenso wie in den Rahmenrichtlinien des Sachunterrichts. So wird z. B. ausdrücklich betont, daß der Sachunterricht kein Buchunterricht sein soll (vgl. Nds. Kultusministerium, 1982, S. 15). Das Buch hat beim frühen Fremdsprachenlernen dadurch das Lesen und Schreiben nicht im Vordergrund stehen, ebenso nur unterstützenden Charakter.
Des weiteren wird der Sachunterricht u. a. beschrieben als ,,Gelegenheitsunterricht zum Aufgreifen von aktuellen Lernanlässen" und ist somit als relativ offen zu sehen (ebd., S. 14). Wie nun die Auswahl der Themen und die Empfehlungen für den Sachunterricht zu den Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenunterricht passen, soll nun untersucht werden.
2. Aufgaben und Ziele
In den Rahmenrichtlinien werden zu Beginn die allgemeinen Aufgaben und Ziele des Sachunterrichts beschrieben. Dort heißt es: ,,Der Sachunterricht hat die Aufgabe, dem Schüler Ausschnitte der Lebenswirklichkeit zu erschließen, soweit sie für ihn bedeutsam und zugänglich sind" (ebd., S. 5). Betrachtet man die Entwicklung der Lebenswirklichkeit von Grundschulkindern in den letzen Jahren, so findet man in dieser aus unterschiedlichen Gründen einen vermehrten Kontakt zu fremden Sprachen und Kulturen. Durch den gestiegenen Anteil von Kindern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, ergibt sich für die Schüler ein unmittelbarer Kontakt zu fremden Kulturen und somit der Einzug von neuen Einflüssen in die Lebenswelt der Schüler. Ebenso ist die Erfahrungswelt der Kinder heute besonders von der englischen Sprache geprägt. Durch Computer, Musik, Werbung und Fernsehen ist Englisch ein nicht mehr unbedeutender Teil in der Welt der Kinder. Wenn der Sachunterricht nun gerade auf die Lebenswirklichkeit der Kinder eingehen soll, ist hier für die heutige Zeit ein zentraler Anknüpfungspunkt für den Einbezug der Fremdsprache gefunden. Als besonderes Ziel wird die Entfaltung des Spiels als kindgemäße Lebensform beschrieben, die zur Erschließung der Welt genutzt werden soll (vgl. ebd.). Somit ist auch der Platz für das spielerische Lernen für einen ganzheitlichen Umgang mit der Fremdsprache gewährleistet. Auch auf die Verknüpfung des Sachunterrichts mit anderen Fächern wird explizit hingewiesen. ,,Vorrang hat die Verbindung zum Deutschunterricht, weil die Lebenswirklichkeit vor allem mit Hilfe der Sprache bewußt und dauerhaft zu erfassen ist. Sie stützt die Wahrnehmung und trägt entscheidend zur denkenden Durchdringung der Sachverhalte bei" (ebd.). Da die Rahmenrichtlinien für den Sachunterricht aus dem Jahre 1982 stammen, bezieht man sich hier beim Wort ,,Sprache" automatisch auf den Deutschunterricht. Dieses ist der Fall, weil das Thema ,,Fremdsprachen an Grundschulen" zu dieser Zeit in der bildungspolitischen Diskussion wieder in den Hintergrund gerückt war. Heute dagegen würde man wohl neben der Verbindung zum Deutschunterricht auch die Integration des Fremdsprachenunterrichts betonen können. Denn die Erfassung der Lebenswelt kann - wenn auch nicht unbedingt auf gleich hohem Niveau - ebenso über eine andere Sprache erfolgen bzw. diese als Objekt der Lebenswelt haben. So plädiert man in der modernen Fremdsprachendidaktik ja ebenso für eine sinnvolle Kommunikation mit authentischen Inhalten. D. h. das Lernen von Sprache und Sachinhalten sollte immer in Verbindung miteinander gesehen werden. Die hier vorgenommene alleinige Fixierung auf den Deutschunterricht ist somit als veraltet anzusehen und wäre aufgrund der veränderten Situation allgemein auf ,,Sprachunterricht" zu erweitern.
Laut Rahmenrichtlinien soll der Sachunterricht ,,propädeutisch im Sinne von grundlegend und motivierend", nicht aber im Sinne einer Vorverlegung von Zielen und Inhalten des späteren Unterrichts sein (ebd.). Dieses gilt grundsätzlich auch für den frühen Fremdsprachenunterricht. Die Empfehlungen des Kultusministeriums betonen jedoch auch die Vermittlung von grundlegenden fremdsprachlichen Kompetenzen, wie z.B. die Sprechakte zur Kontaktpflege, zum Ausdruck von Gefühlen und zur Darstellung von Sachverhalten (vgl. Nds. Kultusministerium, 1995, S. 9 f.). Durch den Kontakt, den die Kinder mit der Sprache haben, ergibt sich zwangsläufig eine (Teil-)Vorverlegung von Zielen und Inhalten. Die Abstimmung des frühen Fremdsprachenlernens mit dem Fremdsprachenunterricht in der Sekundarstufe ist deshalb unerläßlich.
Bei den allgemeinen Aufgaben und Zielen der Rahmenrichtlinien fehlt bisher die Beachtung der veränderten Situation durch die europäische Einigung und die damit verbundenen Kontakte zu anderen Kulturen und Sprachen. Durch die Betonung der Wichtigkeit von Lebenswirklichkeit der Kinder läßt sich der Fremdsprachenunterricht allerdings für den Sachunterricht der späten 90er Jahre durchaus ausreichend begründen.
3. Analyse der Lernfelder
3.1 ,,Zusammenleben der Menschen"
Das Lernfeld ,,Zusammenleben der Menschen" soll den Schülern die vielfältigen sozialen Verhaltensweisen und Einstellungen von Menschen aufzeigen. Dabei soll ihnen ihr eigenes Sozialverhalten allmählich bewußt werden, wobei die Grundlage des Lernens die eigenen mitmenschlichen Beziehungen sein sollen (vgl. Nds. Kultusministerium, 1982, S. 7). Ein allgemeiner Anknüpfungspunkt zum Fremdsprachenlernen findet sich durch die Tatsache, daß im Zusammenleben der Menschen die Sprache eine besondere Rolle spielt. So findet sich in den grundlegenden Erkenntnisverfahren des Lernfeldes der Punkt ,,anderen helfen, die Hilfe anderen anbieten" und bei den Einstellungen und Verhaltensweisen die Punkte ,,Gefühle äußern, die Gefühle anderer verstehen" und ,,zur Verständigung bereit und fähig sein" (ebd. S. 8). Das Themenfeld enthält somit auch die grundlegenden Fähigkeiten zur Kommunikation, wie sie in den Empfehlungen zum Fremdsprachenlernen als Sprechakte in der Fremdsprache gefordert werden.
Es stellt sich nun jedoch die Frage, inwieweit sich das Fremdsprachenlernen konkret in die verbindlichen Themen des Sachunterrichts sinnvoll integrieren läßt. So fordern die Rahmenrichtlinien eine Auswahl der Lerninhalte nach den Kriterien ,,Bedeutsamkeit" (u. a. für das gegenwärtige und zukünftige Leben der Kinder), ,,Zugänglichkeit" (Lerninhalte müssen den Kindern Zugang bieten) und ,,Ergiebigkeit" (Es werden die Lerninhalte vorgezogen, die der Absicht der Lernziele am ehesten entsprechen) (ebd. S. 6).
Das Thema ,,In der Schule" hat ein zunehmend selbständiges und verantwortungsbewußtes Handeln zum Ziel (vgl. ebd., S. 47). Die Hinweise für den Unterricht zeigen, daß bei diesem Thema organisatorische Aufgaben, wie ,,Verhaltensformen begründen" und ,,aktuelle Anlässe situativ begründen" im Vordergrund stehen. Daß diese Aufgaben oft organisatorische Aufgaben darstellen, die nebenher laufen und schwierig vorhersehbar sind, schließt eine Verknüpfung mit dem Fremdsprachenlernen jedoch nicht aus. Denn gerade das Schulleben bietet authentische Anlässe zum Reden. Hinter den Äußerungen stehen Ziele, die einen wirklichen und direkten Nutzen haben. Ein weiteres Lernziel, für das ich bei diesem Thema Verwertung für den Fremdsprachenunterricht finde, ist das Lernziel ,,anderen Menschen Wünsche und Erwartungen in angemessener Form mitteilen". Dieses ist sogar eines der wichtigsten Anliegen überhaupt. Denn der frühe Fremdsprachenunterricht betont besonders eine grundlegende sprachliche Kompetenz, die hier z. B. in Form von Rollenspielen geübt werden kann.
Das Thema ,,Post und öffentliche Verkehrsmittel verbinden die Menschen miteinander" bietet mehrere Anknüpfungspunkte. So bieten sich dabei eine Menge Spielsituationen aber auch die Erkundung der Institutionen an. Bei einer Erkundung des Bahnhofs könnte z. B. eine Teilaufgabe sein, nach englischen Bezeichnungen (z. B. Schilder wie ,,Intercity" oder Titel englischer Zeitungen am Kiosk) zu suchen. Ebenso ließen sich beim Thema ,,Telefon" Gespräche mit englischsprachigen Stars simulieren. Auch die Bewußtmachung englischer Begriffe aus dem Alltag (handy, internet, computer...) läßt sich in dieses Thema einfügen. Weiterhin enthält das Lernfeld ,,Zusammenleben der Menschen" u. a. die Themen ,,Wir informieren uns" und ,,Unser Wohnort heute und früher". Das erste Thema gibt viele Anknüpfungspunkte her. So bietet beispielsweise die englischsprachige Werbung Möglichkeiten zur Analyse und auch die grundlegenden Sprechakte zum Beschaffen und Weitergeben von Informationen können hier geübt werden. Die Beschreibung des Themas ,,Unser Wohnort früher und heute" ist in den Rahmenrichtlinien sehr auf den eigenen Ort und auf ortsgeschichtliche Gegebenheiten fixiert.
Die Beispiele für das Fremdsprachenlernen in den Empfehlungen des Kultusministeriums zu dem Thema ,,Home town/ Home village" betonen u. a. den Austausch mit fremden Orten (z.B. mit einer eventuellen Partnerklasse in England), so daß hier eine Bereicherung durch Vergleiche stattfinden kann.
3.2 ,,Menschen und heimatlicher Lebensraum"
Die Intention dieses zweiten Lernfeldes ist die Erschließung des heimatlichen Lebensraumes mit seinen typischen Merkmalen (vgl. ebd., S.8). So beinhaltet es primär die Ziele des traditionellen Heimatkunde-Unterrichts und somit die schwerpunktmäßige Behandlung des Nahraums. Durch diese Beschränkung lassen sich auf den ersten Blick sehr wenig Anknüpfungspunkte zum Fremdsprachenlernen finden, die interkulturelles Lernen ermöglichen. Jedoch wird diese Beschränkung durch den Einbezug von Schülererfahrungen, durch Medien und Reisen in ferne Gebiete wieder aufgehoben. Es sollen also auch diese Erfahrungen geklärt und dabei auch Verständnis für andere Lebensweisen und Kulturen geweckt werden (vgl. ebd., S.9). Deshalb ist eine Anknüpfung an die in den Didaktisch- methodischen Empfehlungen bezüglich der Forderungen nach Interesse und Neugier gegenüber Andersartigem und nach einer ,,offenen und aufgeschlossenen Haltung gegenüber anderen Sprach- und Kulturgemeinschaften" möglich (Nds. Kultusmin. 1995, S.9). Durch den Vergleich des eigenen (zugänglichen) Lebensraumes mit fernen Orten sollen diese Ziele erreicht werden. Der Frage, inwieweit die Rahmenrichtlinien für solche Vergleiche geöffnet sind, muß jedoch anhand der einzelnen Themen des Lernfeldes untersucht werden. Das Thema ,,Unser Wohnort und seine nähere Umgebung" zielt in erster Linie auf die Erkundung des Ortes durch Rundgänge, Kartenarbeit und Betrachtung der Wandlung des Ortes. Die Vorschläge sind sehr auf den eigenen Ort fixiert und enthalten keine näheren Hinweise auf den Einbezug fremder Länder und Kulturen. Es geht in erster Linie um die unmittelbare Erfahrung mit dem Wohnort und seinen Institutionen sowie um deren Funktion. Somit sind hier bei strenger Betrachtung des Lehrziels in den Rahmenrichtlinien - abgesehen von punktuellen und zufälligen Begegnungen mit der Fremdsprache während der Erkundungen - relativ wenig konkrete Verbindungen zum Fremdsprachenunterricht zu beschreiben, die den Vergleich mit anderen Orten erlauben.
Aber natürlich ist ein solcher Vergleich nicht die Voraussetzung dafür, die Fremdsprache einzusetzen. Grundlegende Dinge (Institutionen, Gewohnheiten...) finden sich in jedem Land und können auch bei der Betrachtung des eigenen Ortes in den Fremdsprachenunterricht einfließen. Möglichkeiten hierzu gibt es genügend. Durch Geschichten, Ausstellungen, Videoproduktionen, Collagen, Rollenspiele läßt sich der eigene Ort auf die verschiedensten Arten auch in einer Fremdsprache vorstellen.
Viele Möglichkeiten für Spiele und Geschichten bietet das Thema ,,Das Bild des Bauernhofes wandelt sich". In den Didaktisch-methodischen Empfehlungen befinden sich zum Thema ,,Farm" verschiedene Vorschläge für solche Spiele und Schüleraktivitäten. Beim Thema ,,Freizeiteinrichtungen" können Kontakte zu anderen Ländern und Sprachen direkt thematisiert werden. Die Vorschläge in den Rahmenrichtlinien beinhalten z. B. die Begriffe ,,Urlaub", ,,Reisebüro" und ,,Prospekt". Somit ist es naheliegend, Gespräche über den Urlaub zu führen und eigene Prospekte zu entwerfen. Denkbar ist auch der Einbezug der Fremdsprache bei der Planung von Klassenreisen oder Erkundungen (z. B. eine Liste mit Dingen aufstellen, die mitgebracht werden sollen).
Das Zusatzthema ,,Warenangebot und Einkauf auf dem Wochenmarkt" gibt die Möglichkeit, die Bedeutung von Sprachen in der Wirtschaft zu thematisieren. Hier bieten sich besonders Rollenspiele an, in denen über den Verkauf einer Ware verhandelt wird. Aber auch die Herkunftsländer der Waren und ihre englischen Bezeichnungen bieten viele Möglichkeiten für eine Behandlung im integrierten Fremdsprachenunterricht.
3.3 ,,Sicherung menschlichen Lebens"
Das Lernfeld ,,Sicherung menschlichen Lebens" zielt auf eine umfassende Gesundheit durch entsprechende Lebensführung. Es soll das Bewußtsein für eine gesunde Lebensweise geschaffen werden, wobei auch das Thema ,,Sicherheit" eine bedeutende Rolle spielt (vgl. ebd., S. 10).
Beim Thema ,,Gesunde Ernährung" läßt sich beispielsweise eine englisches Frühstück durchführen. Die englischen Begriffe für Nahrungsmittel und Nahrungsaufnahme können somit handelnd erfaßt werden. Außerdem lassen sich die typischen Eßgewohnheiten in England thematisieren. Das Thema liefert viele grundlegende Vokabeln, wie z. B. die einzelnen Obst- und Gemüsesorten und andere Nahrungsmittel.
Eine enge Querverbindung besteht hier zum Thema ,,Wir schmecken und riechen", wobei z. B. ein Spiel, bei dem Nahrungsmittel allein durch Riechen oder Schmecken erkannt werden sollen, ebenso eine gute Möglichkeit für den Unterricht darstellt, sich Vokabeln handelnd über mehrere ,,Eingangskanäle" zu erschließen.
In diesem Lernfeld nimmt auch der Verkehrsunterricht einen bedeutenden Teil ein. Hier finden sich für viele Bereiche, wie z. B. die Beschreibung der einzelnen Fahrradteile und die Bedeutung von Verkehrsschildern, Anknüpfungspunkte. Es bleibt jedoch zu bedenken, daß man grundsätzlich von den deutschen Zeichen und Regeln auszugehen hat. So sollte zur Vermeidung von Mißverständnissen der englische Linksverkehr nicht parallel mit den deutschen Regeln angesprochen werden. Vorrang hat hier die Sicherheit. Deshalb sollte der Einbezug der Fremdsprache vorher genau überlegt sein bzw. nach dem fremdsprachlichen Unterricht sollten sicherheitsrelevante Aspekte in deutscher Sprache wiederholt werden.
3.4 ,,Mensch und Natur / Mensch und Technik"
Auch dieses Lernfeld soll die direkt erlebte Umwelt als Ausgang haben, wobei ,,Tiere, Pflanzen und Erscheinungen" im Mittelpunkt stehen (ebd., S. 12). Die Vorschläge zum Rahmenthema ,,Umgang mit Pflanzen und Tieren" sind z. B. durch die Haltung und Pflege von eigenen Pflanzen und Tieren sehr praxisorientiert und geprägt von wissenschaftlichen Beobachtungen. Durch den Einbezug echter Tiere und Pflanzen hat das Thema eine gewisse Ernsthaftigkeit an sich, denn die Kinder sollen erfahren, daß Lebewesen keine Spielzeuge sind, sondern Eigenleben haben, das geachtet werden muß (vgl. ebd., S. 64). Somit tauchen bei den Vorschlägen zu diesem Thema spielerische Elemente nicht auf. Der Einbezug eines spielerischen Fremdsprachenunterrichts könnte hier deshalb für Abwechslung sorgen und diesen Unterricht bereichern bzw. seine Perspektiven erweitern.
Die naturwissenschaftlich-technischen Themen ,,Luft hat Kraft" und ,,Richtiger Umgang mit elektrischem Strom" sind nach den Vorschlägen in den Rahmenrichtlinien sehr auf Erfahrungen durch Beobachtungen und Experimente angelegt. D. h. die Kinder sollen anfangs in erster Linie Phänomene unabhängig von wissenschaftlichen Begriffen und langen sprachlichen Erklärungen selbst entdecken können. Deshalb eignet sich auch hier die Fremdsprache eher für die ästhetischen Zugangsweisen (z. B. Geschichten über Luft), denn die Sprache kann die handelnden Entdeckungen der Kinder nicht ersetzen. Die ästhetischen Bereiche fehlen bei den Vorschlägen zu den naturwissenschaftlich-technischen Themen in den Rahmenrichtlinien jedoch noch völlig.
4. Ideen für den Unterricht
Nun sollen exemplarisch am Thema ,,Wir informieren uns" einige Unterrichtsbeispiele für den integrativen Englischunterricht an der Grundschule vorgestellt werden, die sich an den Rahmenrichtlinien des Sachunterrichts und ebenso an den Empfehlungen des Kultusministeriums zum Fremdsprachenlernen an Grundschulen orientieren werden. Für den Sachunterricht ist dieses Thema für das 4. Schuljahr vorgesehen und soll die Kinder befähigen, sich Informationen zu beschaffen und bewußter mit Informationen umzugehen.
4.1 Spiele zum Thema
Kinder sind heute eine bedeutende Zielgruppe der Werbung. Durch die gezielte Vermischung von Werbung und Unterhaltung werden bei ihnen Bedürfnisse geweckt. Deshalb wird die Thematisierung des manipulativen Charakters von Informationen immer wichtiger. Eine gute Möglichkeit für einen spielerischen Zugang zu diesem Thema in englischer Sprache könnte das Nachspielen von Werbespots aus dem Fernsehen und das Erfinden von neuen Werbespots sein.
4.1.1 Nachspielen von Werbespots
Hierbei bieten sich Werbespots an, die entweder ganz auf Englisch sind oder auch solche, die nur einzelne englische Wörter oder Sätze beinhalten. Nach mehrmaligem Anschauen der Spots und nach Auswahl der ,,Schauspieler" sowie der Schaffung einer passenden Kulisse kann das Nachspielen erfolgen. Dabei können auch inhaltliche Änderungen vorgenommen werden, und durch entsprechende Aussprache und Gesten kann das Anpreisen des Produkts ,,ins Lächerliche gezogen" und so der manipulative Charakter von Werbung aufgezeigt werden. Zusätzlich bietet sich die Aufzeichnung der Spots auf Video an, um eine ,,Studio- Atmosphäre" zu schaffen.
4.1.2 Erfindung von Werbespots
Reizvoll ist auch die Erfindung neuer Werbespots zu bekannten Produkten oder zu solchen, die ebenfalls erfunden sind.
Wortschatz: television, video, studio
the best, the biggest...
new
product, commercial
4.1.3 Spielen der ,,News"
Weiterhin lassen sich z. B. die Nachrichtensendungen des Fernsehens spielerisch nachstellen. Dabei können die unterschiedlichsten Themen präsentiert werden: organisatorische Belange der Klasse und der Schule, Nachrichten aus dem Ort oder aus der näheren Umgebung oder auch das Wetter.
Eine solche Nachrichtensendung könnte folgendermaßen aussehen: Der Lehrer spielt den Nachrichtensprecher und berichtet über die einzelnen Ereignisse, die sich vorwiegend auf vorher behandelte Geschichten und Themen des integrativen Fremdsprachenunterrichts beziehen. So kann er u. a. auf ,,action" Bezug nehmen, bei denen die Kinder bei bestimmten Begriffen Bewegungen ausführen. Auch sonst sollten die Äußerungen durch Handlungen unterstützt werden. Beim Wetterbericht könnte bei ,,rain" ein Schüler mit Hilfe einer Gießkanne Wasserplätschern erzeugen oder bei ,,wind" den Ventilator einschalten oder das Fenster öffnen. Nach und nach ist auch die Übernahme der Sprecherfunktion durch eine Gruppe von Schülern denkbar.
Eine solche Nachrichtensendung ist auch als kurzes regelmäßiges Ritual (z. B. wöchentlich) am Anfang oder am Ende einer Fremdsprachensequenz vorstellbar.
Wortschatz: news
reporter, speaker
weather / weather forecast, cold, windy, warm, cloudy, nice, sun
4.2 Erkundung
Eine Erkundung zum Thema ,,Wir informieren uns" ist auch mit dem Schwerpunkt Englisch gut durchführbar. Die Kinder könnten die Aufgabe erhalten, alle möglichen Informationen, die ihnen in englischer Sprache begegnen, zu sammeln, um anschließend darüber zu berichten. Die meisten Informationen werden ihnen dabei wahrscheinlich in Form von Werbung begegnen. So bieten z. B. Werbeplakate, Jeansläden oder ,,Mc Donalds" eine Menge von Möglichkeiten zum Entdecken von fremdsprachlichen Begriffen, die die Kinder selbst schon oft unbewußt benutzen.
Bei der Nachbereitung der Erkundung ist somit die Besprechung der Tatsache, daß so viele Werbeinformationen in englischer Sprache verfaßt sind, naheliegend.
Das Thema bietet weiterhin die Möglichkeit, zu ersten Versuchen selbst Informationen in der Fremdsprache zu beschaffen. Dieses könnte beispielsweise in einer Gruppenarbeit passieren, bei der die Gruppen verschiedene einfache Interviews vorbereiten und anschließend durchführen. Als Anlaufpunkt ist z. B. ein Hotel geeignet. An Hotelrezeptionen finden sich bedingt durch den internationalen Publikumsverkehr fast immer Englisch sprechende Portiers. Hier wären erste einfache Dialoge möglich. Mögliche Fragen: Are the guests friendly ? Do you like your job ? Do you have english breakfast ?
Eine weitere Institution, die für einen solchen Zweck geeignet ist, wäre z. B. die Touristik- Information. Ein solcher erster Gebrauch der Fremdsprache wirkt auf die Kinder motivierend und kann bei fehlenden Gelegenheiten für Begegnungen als Ersatz für Fremdsprachenbegegnungen mit native speakers betrachtet werden. Wortschatz: information advertising
hotel product
question interview
[...]
Häufig gestellte Fragen zu "Frühes Fremdsprachenlernen"
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit?
Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, das frühe Fremdsprachenlernen sowohl theoretisch zu begründen als auch die Anknüpfungspunkte zum Fremdsprachenunterricht in den Rahmenrichtlinien des Sachunterrichts zu analysieren.
Welche Themen werden im ersten Teil der Arbeit behandelt?
Der erste Teil der Arbeit behandelt die theoretische Begründung des frühen Fremdsprachenlernens. Dazu gehören Einleitungen, Psycholinguistik, psychologische, physiologische und pädagogische Begründungen, Sprachbewußtheit, kulturelle Aspekte, die Wahl der Sprache sowie systematischer Fremdsprachenunterricht und die Begegnung mit Sprachen.
Was sind die psycholinguistischen Argumente für das frühe Fremdsprachenlernen?
Die Psycholinguistik betont die angeborene Fähigkeit des Menschen zum Spracherwerb. Kinder im Grundschulalter sind bewegungsfreudig und können Sprache in Verbindung mit Musik und Bewegung leichter lernen, was dem Erstsprachenerwerb ähnelt.
Welche Rolle spielt die Sprachbewußtheit beim Fremdsprachenlernen?
Sprachbewußtheit, die Auseinandersetzung mit mehreren Sprachen und Kulturen, ist wichtig, um die Motivation für den Umgang mit Sprache zu fördern, zur sprachlichen Toleranz zu erziehen und die Sensibilität für Sprache zu erhöhen. Bilinguale Kinder zeigen oft eine hohe Sprachbewußtheit.
Warum ist der kulturelle Aspekt im frühen Fremdsprachenunterricht wichtig?
Kinder sind nach der Geburt offen für alle Kulturen. Der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule kann dazu beitragen, diese Offenheit zu bewahren, Toleranz gegenüber anderen Kulturen zu fördern und den Horizont der Kinder zu erweitern.
Welche Argumente gibt es für und gegen Englisch als erste Fremdsprache in der Grundschule?
Einige argumentieren, dass Englisch aufgrund seiner weiten Verbreitung und der starken Motivation der Kinder dafür geeignet ist. Andere sind der Meinung, dass Sprachen wie Französisch aufgrund ihrer Andersartigkeit und stärkeren Kulturbezogenheit besser geeignet sind, um das Verständnis für andere Denkweisen zu fördern.
Was sind die wesentlichen Merkmale des systematischen Fremdsprachenunterrichts?
Der systematische Fremdsprachenunterricht basiert auf einem organisierten Lernprozess mit Progression und definierten Lernzielen. Er wird oft von ausgebildeten Fremdsprachenlehrern erteilt und ist mündlich-kommunikativ ausgerichtet.
Was beinhaltet das Konzept "Begegnung mit Sprachen"?
Das Konzept "Begegnung mit Sprachen" zielt darauf ab, Sprachen zu behandeln, mit denen Kinder im Alltag konfrontiert werden. Es beinhaltet integrative Phasen und direkte Begegnungen mit Sprechern anderer Sprachen, um unterschiedliche Sichtweisen aufzudecken und zu überwinden.
Welche Lernfelder des Sachunterrichts werden im zweiten Teil der Arbeit analysiert?
Im zweiten Teil der Arbeit werden die Lernfelder "Zusammenleben der Menschen", "Menschen und heimatlicher Lebensraum", "Sicherung menschlichen Lebens" und "Mensch und Natur / Mensch und Technik" aus den Rahmenrichtlinien des Sachunterrichts analysiert.
Wie kann der Fremdsprachenunterricht in das Lernfeld "Zusammenleben der Menschen" integriert werden?
Der Fremdsprachenunterricht kann in dieses Lernfeld integriert werden, indem grundlegende Fähigkeiten zur Kommunikation, wie sie in den Empfehlungen zum Fremdsprachenlernen als Sprechakte in der Fremdsprache gefordert werden, geübt werden. Themen wie "In der Schule" und "Post und öffentliche Verkehrsmittel" bieten konkrete Anknüpfungspunkte.
Welche Möglichkeiten bietet das Lernfeld "Menschen und heimatlicher Lebensraum" für den Fremdsprachenunterricht?
Obwohl dieses Lernfeld primär den Nahraum behandelt, können Schülererfahrungen, Medien und Reisen in ferne Gebiete einbezogen werden, um Verständnis für andere Lebensweisen und Kulturen zu wecken. Der Vergleich des eigenen Lebensraumes mit fernen Orten und die Einbeziehung englischer Begriffe aus dem Alltag sind möglich.
Wie lässt sich das Lernfeld "Sicherung menschlichen Lebens" mit dem Fremdsprachenunterricht verbinden?
Themen wie "Gesunde Ernährung" und "Verkehrsunterricht" bieten Anknüpfungspunkte. Ein englisches Frühstück kann durchgeführt werden, und die englischen Begriffe für Nahrungsmittel können handelnd erfasst werden. Im Verkehrsunterricht sollte jedoch die Sicherheit Vorrang haben.
Welche Ideen für den Unterricht werden exemplarisch vorgestellt?
Exemplarisch werden Unterrichtsbeispiele zum Thema "Wir informieren uns" vorgestellt, die sich an den Rahmenrichtlinien des Sachunterrichts und den Empfehlungen des Kultusministeriums zum Fremdsprachenlernen orientieren. Dazu gehören Spiele wie das Nachspielen von Werbespots, die Erfindung von Werbespots und das Spielen der "News" sowie Erkundungen zum Thema Informationen.
- Quote paper
- Frank Poppen (Author), 1998, Frühes Fremdsprachenlernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95782