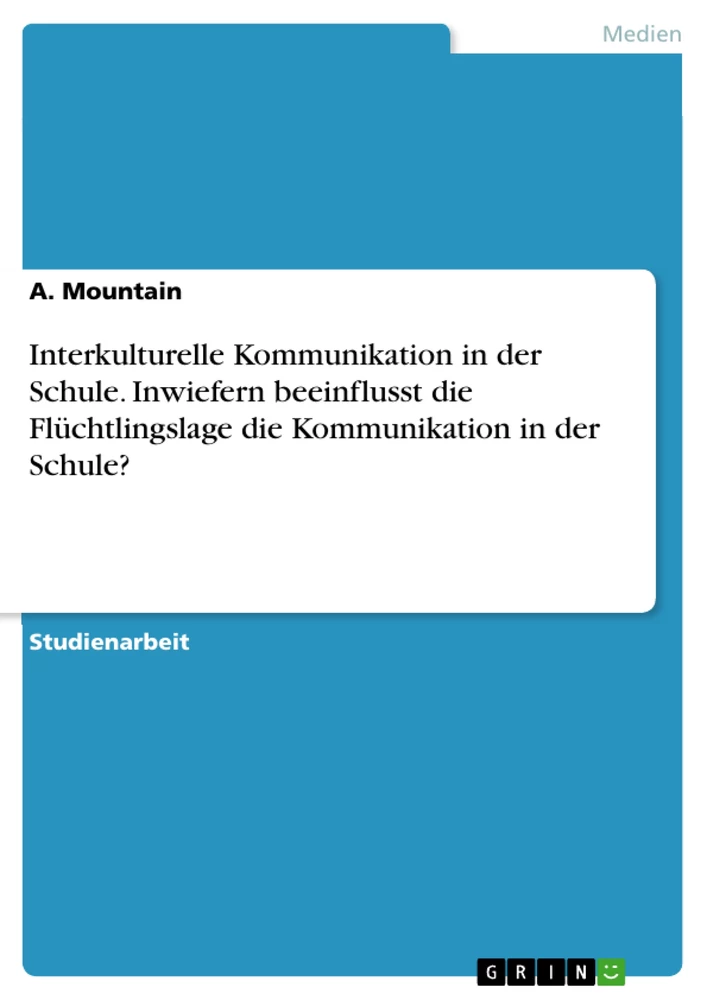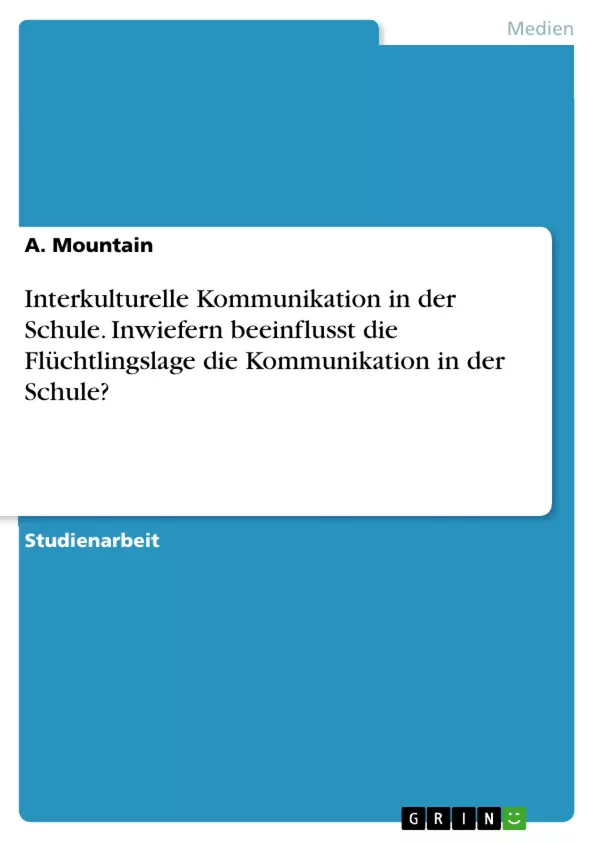In dieser Hausarbeit soll der Einfluss der aktuellen Flüchtlingslage auf die Kommunikation in der Schule herausgearbeitet werden. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten geflüchteten Menschen aus den Ländern Syrien, Irak und Nigeria einwandern, werden in der folgenden Arbeit, interkulturelle Differenzen im Hinblick auf die Kommunikation anhand dieser Herkunftsländer untersucht.
Seit 2015 besteht weltweit eine verstärkte Flüchtlingsmigration. Besonders in Deutschland suchen geflüchtete Menschen Zuflucht. Seit 2015 sind rund 1,5 Mio. Menschen nach Deutschland geflohen. Es gilt diese Menschen bestmöglich in unsere Kultur und unsere Gesellschaft zu integrieren. Dazu gehört ebenfalls die Integration der Kinder und Jugendliche in unser Schulsystem. Das Aufeinandertreffen von Menschen birgt immer Kommunikationsprobleme. Allerdings entstehen besonders häufig Missverständnisse in der interkulturellen Kommunikation. Insbesondere in der Institution Schule treffen viele Menschen unterschiedlicher Kulturen aufeinander und kommunizieren. Demnach stellt sich die Frage, inwieweit die "neue" Interkulturalität die Kommunikation in der Schule beeinflusst, welche Missverständnisse folglich auftreten können, und welche Folgerungen für Lehrerinnen und Lehrer daraus resultieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problem und Ziel
- Struktur
- Definitionen
- Kultur
- Kommunikation
- Nonverbale Kommunikation
- Interkulturelle Kommunikation
- Interkulturelle Kompetenz
- Eingliederung neu zugewanderter Schülerinnen & Schüler in das deutsche Schulsystem
- Theoretische Grundlagen
- Interkulturelle Kommunikation nach Heringer
- Das Sender-Empfänger-Modell
- Hotspots
- Kulturelle Differenzen
- Religiöser Einfluss auf die Kommunikation
- Kulturdimensionen nach Hofstede
- Vergleich der Kulturdimensionen nach Hofstede
- Interkulturelle Kommunikation nach Heringer
- Inwiefern beeinflusst die Flüchtlingslage die Kommunikation in der Schule?
- Umgang mit interkulturellen Differenzen im schulischen Kontext
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der aktuellen Flüchtlingslage auf die Kommunikation in der Schule. Sie beschäftigt sich mit dem Problem der Integration von Flüchtlingskindern in das deutsche Schulsystem und analysiert die dabei entstehenden interkulturellen Missverständnisse.
- Definition von Kultur und Kommunikation im interkulturellen Kontext
- Analyse der Herausforderungen bei der Integration von Flüchtlingskindern in die deutsche Schule
- Theoretische Grundlagen der interkulturellen Kommunikation nach Heringer und Hofstede
- Die Rolle von Religion und Kulturdimensionen in der Kommunikation
- Praktische Implikationen für den Umgang mit interkulturellen Differenzen im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Problem der verstärkten Flüchtlingsmigration seit 2015 und die damit verbundenen Herausforderungen für die Integration von Flüchtlingskindern in das deutsche Schulsystem dar. Die Studie zielt darauf ab, den Einfluss der „neuen“ Interkulturalität auf die Kommunikation in der Schule zu untersuchen.
- Definitionen: Die Arbeit definiert wichtige Begriffe wie Kultur, Kommunikation, nonverbale Kommunikation, interkulturelle Kommunikation und interkulturelle Kompetenz. Dabei wird insbesondere die Definition von Kultur nach Heringer hervorgehoben, die Kultur als ein unbewusstes und automatisches soziales Gebilde beschreibt, das erst im Vergleich mit anderen Kulturen bewusst wird.
- Eingliederung neu zugewanderter Schülerinnen & Schüler in das deutsche Schulsystem: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Prozess der Eingliederung von Flüchtlingskindern in das deutsche Schulsystem und den damit verbundenen Herausforderungen.
- Theoretische Grundlagen: Hier werden die theoretischen Grundlagen der interkulturellen Kommunikation nach Heringer und Hofstede vorgestellt. Dazu gehören das Sender-Empfänger-Modell, Hotspots, kulturelle Differenzen und Kulturdimensionen.
- Religiöser Einfluss auf die Kommunikation: Dieser Abschnitt analysiert den Einfluss religiöser Faktoren auf die Kommunikation und beschreibt, wie religiöse Unterschiede die interkulturelle Kommunikation beeinflussen können.
- Kulturdimensionen nach Hofstede: Die Arbeit stellt Hofstedes Konzept der Kulturdimensionen vor und vergleicht die Kulturdimensionen von Deutschland, Syrien, Irak und Nigeria. Dieser Vergleich soll Aufschluss über kulturelle Unterschiede geben, die zu Missverständnissen in der Kommunikation führen können.
- Inwiefern beeinflusst die Flüchtlingslage die Kommunikation in der Schule?: In diesem Kapitel werden die Einflüsse auf die Kommunikation in der Schule anhand der vorgestellten theoretischen Grundlagen, der religiösen Spezifika und kulturellen Differenzen nach Hofstede erläutert.
- Umgang mit interkulturellen Differenzen im schulischen Kontext: Dieser Abschnitt gibt konkrete Handlungsempfehlungen für den Umgang mit interkulturellen Differenzen im schulischen Kontext.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete der Arbeit umfassen: Interkulturelle Kommunikation, Flüchtlingsmigration, Integration, Schule, Missverständnisse, Kulturdimensionen, Sender-Empfänger-Modell, Hofstede, Heringer, Nonverbale Kommunikation, religiöse Einflüsse.
- Quote paper
- A. Mountain (Author), 2018, Interkulturelle Kommunikation in der Schule. Inwiefern beeinflusst die Flüchtlingslage die Kommunikation in der Schule?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957850