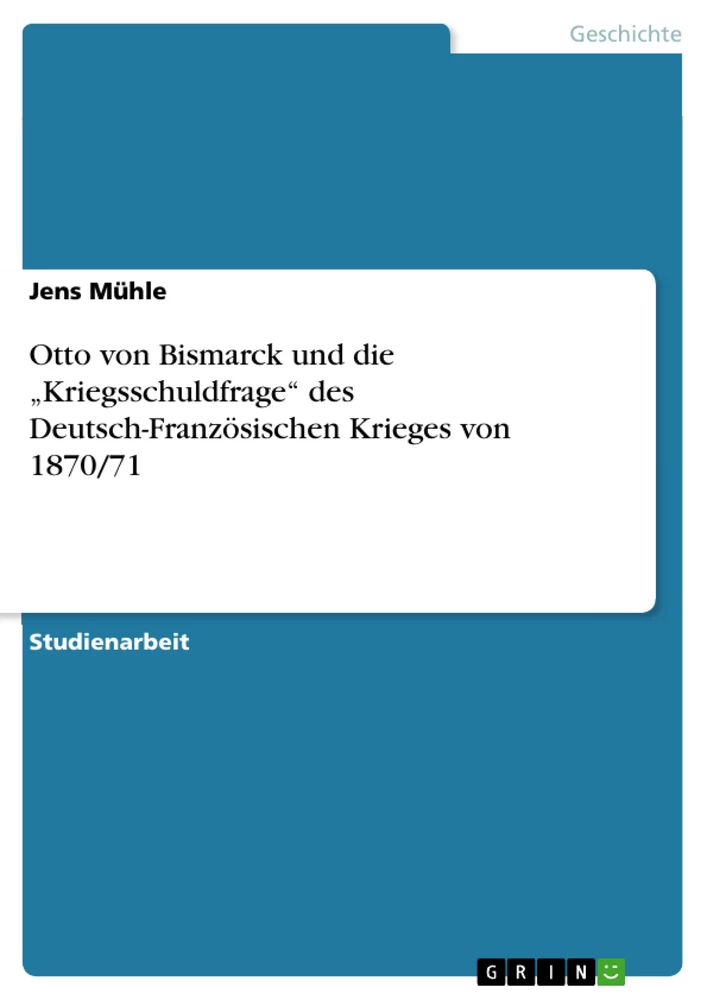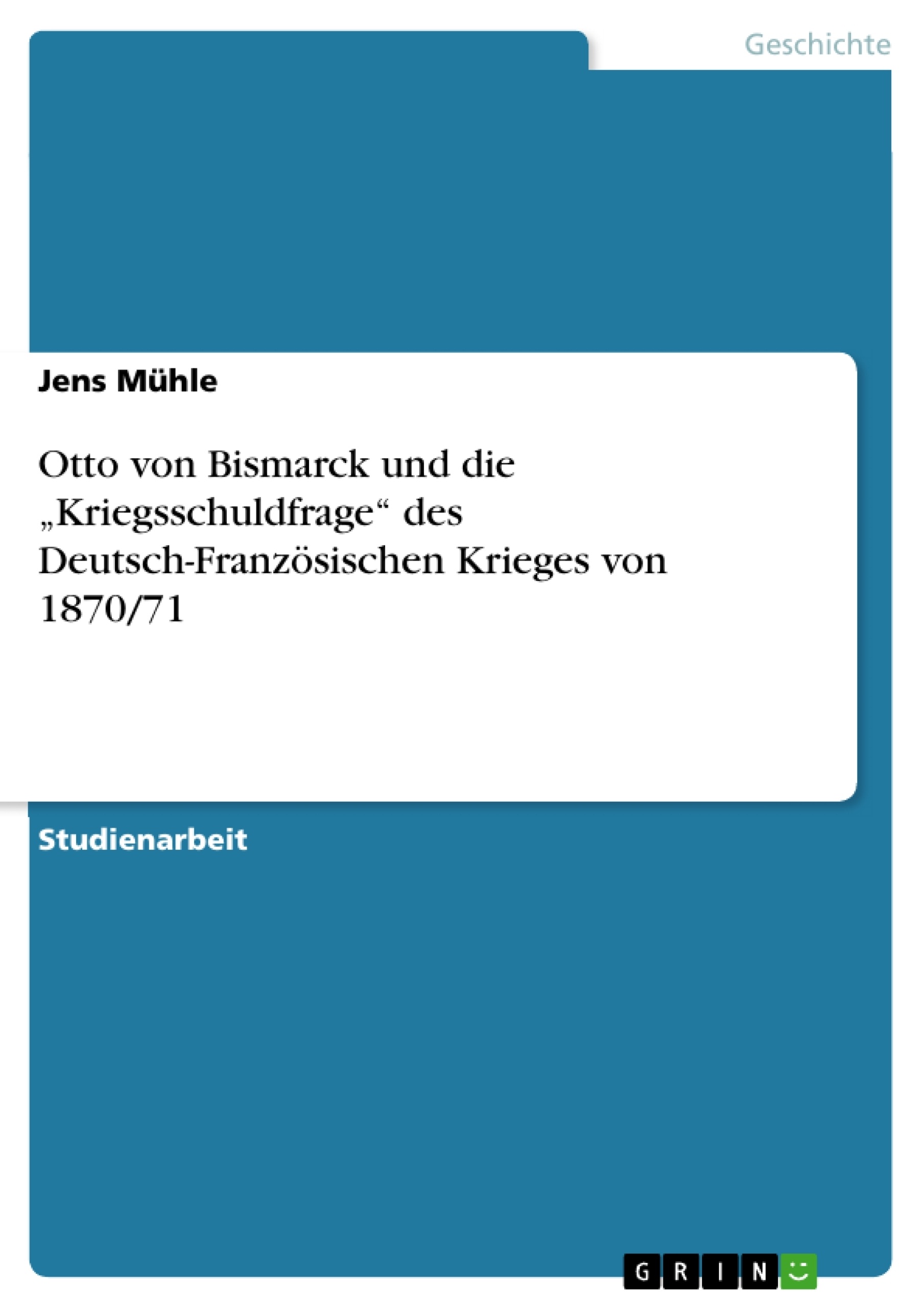Die Arbeit befasst sich mit der „Kriegsschuldfrage“ des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 und der Person des preußischen Ministerpräsidenten und späteren deutschen Reichskanzlers: Otto von Bismarck. Hatte Bismarck diesen Krieg gewollt, vielleicht sogar willkürlich herbeigeführt? Oder hatten vielmehr Napoleon III. und seine Regierung den Krieg gesucht, etwa als „Rache für Sadowa“? Dabei wird nicht zuletzt zu untersuchen sein, ob man überhaupt von einer „Kriegsschuld“ im engeren Sinne sprechen kann.
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Diskussion der Kriegsschuldfrage seit 1870. Wer hat wann und warum diese Frage wie beantwortet und welche Gründe und Beweise sah man dafür? Anschließend werden mögliche Absichten Bismarcks bei der Aufnahme der „Hohenzollernschen Kandidatur“ für den spanischen Thron herausgearbeitet, jenem Ereignis, an dem sich der deutsch-französische Konflikt bekanntlich entzünden sollte. Es folgt eine Analyse der sogenannten „Julikrise“ 1870. Dabei wird die Rolle Bismarcks ebenso analysiert wie die seiner französischen Gegenspieler. Abschließend werden die Gründe und Ursachen für die „Emser Depesche“ untersucht, jenes Dokument, das allgemein als Anlass des Kriegs von 1870/1871 gilt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Diskussion der „Kriegsschuldfrage“ von 1870
- Die Aufnahme der Hohenzollernschen Thronkandidatur
- Die,,Julikrise\" 1870
- Die „Emser Depesche“ und der Ausbruch des Krieges
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die "Kriegsschuldfrage" des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 und die Rolle Otto von Bismarcks in diesem Konflikt. Sie befasst sich mit der Frage, ob Bismarck den Krieg gewollt oder sogar herbeigeführt hat, oder ob Napoleon III. und seine Regierung den Krieg gesucht haben. Dabei werden die möglichen Absichten Bismarcks bei der Hohenzollernschen Kandidatur für den spanischen Thron untersucht, sowie die Ereignisse der "Julikrise" 1870 analysiert. Die Arbeit beleuchtet auch die "Emser Depesche", die allgemein als Auslöser des Krieges gilt.
- Die "Kriegsschuldfrage" des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71
- Die Rolle Otto von Bismarcks in der "Kriegsschuldfrage"
- Die Hohenzollernsche Kandidatur für den spanischen Thron
- Die "Julikrise" 1870
- Die "Emser Depesche" und ihre Rolle beim Kriegsausbruch
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit untersucht die umstrittene Frage nach der Schuld am Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71. Sie beleuchtet unterschiedliche Interpretationen der Kriegsschuldfrage, die sowohl von deutschen als auch französischen Historikern vertreten werden. Die Arbeit konzentriert sich dabei insbesondere auf die Rolle Otto von Bismarcks.
Zur Diskussion der „Kriegsschuldfrage“ von 1870
Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der Interpretationen der Kriegsschuldfrage von 1870/71. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven, die nach dem Krieg in Frankreich und Deutschland vertreten wurden. Das Kapitel geht auch auf die Enthüllungen über Bismarcks Politik während der Julikrise ein, die zu einer Neuinterpretation der Kriegsschuldfrage führten.
Die Aufnahme der Hohenzollernschen Thronkandidatur
Dieses Kapitel untersucht die Hohenzollernsche Kandidatur für den spanischen Thron und ihre Rolle im Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich. Es analysiert die möglichen Absichten Bismarcks bei der Aufnahme der Kandidatur und die Reaktion Frankreichs auf dieses Ereignis.
Die,,Julikrise\" 1870
Das Kapitel analysiert die "Julikrise" 1870 und die Rolle Bismarcks und seiner französischen Gegenspieler in dieser Krise. Es befasst sich mit den diplomatischen Verhandlungsprozessen und den Spannungen, die zum Kriegsausbruch führten.
Die „Emser Depesche“ und der Ausbruch des Krieges
Dieses Kapitel befasst sich mit der "Emser Depesche", die als Auslöser des Deutsch-Französischen Krieges gilt. Es untersucht die Gründe und Ursachen für die Entstehung dieses Dokuments und seine Rolle beim Kriegsausbruch.
Schlüsselwörter
Deutsch-Französischer Krieg, Kriegsschuldfrage, Otto von Bismarck, Hohenzollernsche Kandidatur, Julikrise, Emser Depesche, Napoleon III., Frankreich, Preußen, Geschichte, Diplomatie, Politik.
Häufig gestellte Fragen
Wollte Otto von Bismarck den Krieg gegen Frankreich 1870?
Dies ist eine zentrale Frage der Geschichtsforschung. Bismarck nutzte die Spannungen strategisch aus, um die deutsche Einigung voranzutreiben, aber die alleinige „Kriegsschuld“ ist umstritten.
Was war die Hohenzollernsche Thronkandidatur?
Es war das Bestreben, einen Hohenzollern-Prinzen auf den spanischen Thron zu setzen, was Frankreich als Bedrohung und Provokation empfand und den Konflikt entzündete.
Was ist die „Emser Depesche“?
Ein Telegramm über ein Gespräch zwischen König Wilhelm I. und dem französischen Botschafter, das von Bismarck so gekürzt wurde, dass es für beide Seiten beleidigend wirkte und zum Kriegsausbruch führte.
Welche Rolle spielte Napoleon III. in der Julikrise?
Napoleon III. und seine Regierung suchten nach der Niederlage Österreichs gegen Preußen („Rache für Sadowa“) eine Gelegenheit, Preußens Machtzuwachs in Europa zu stoppen.
Kann man historisch von einer eindeutigen „Kriegsschuld“ sprechen?
Die Arbeit zeigt auf, dass die Frage komplex ist und die Schuld oft in einer Eskalationsspirale beider Mächte sowie in innenpolitischen Zwängen beider Länder lag.
- Quote paper
- Jens Mühle (Author), 2014, Otto von Bismarck und die „Kriegsschuldfrage“ des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957902