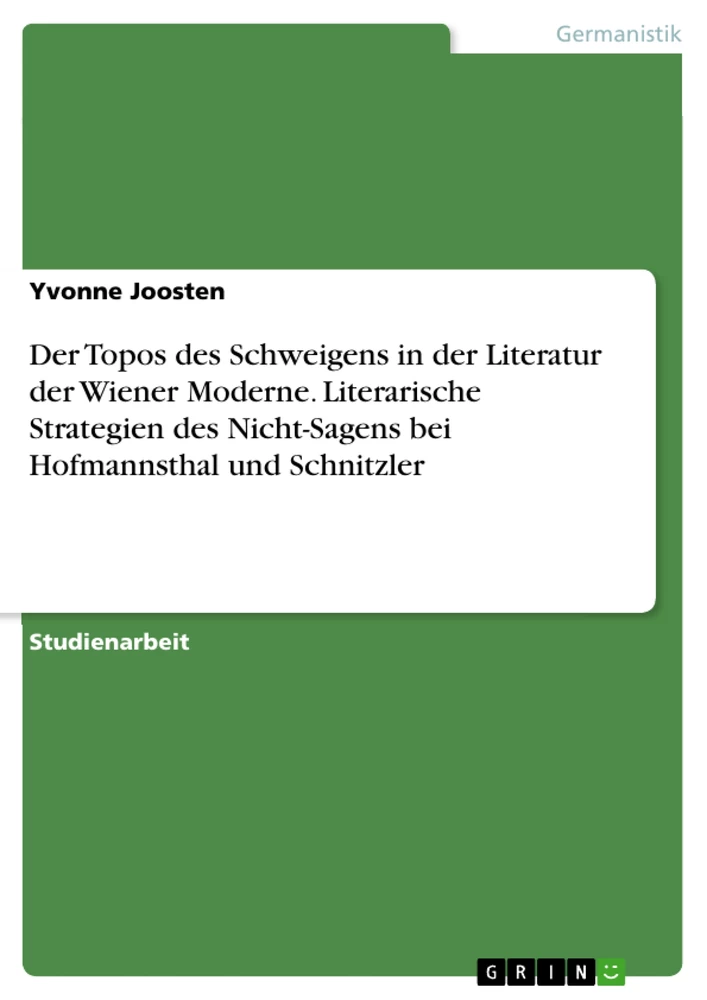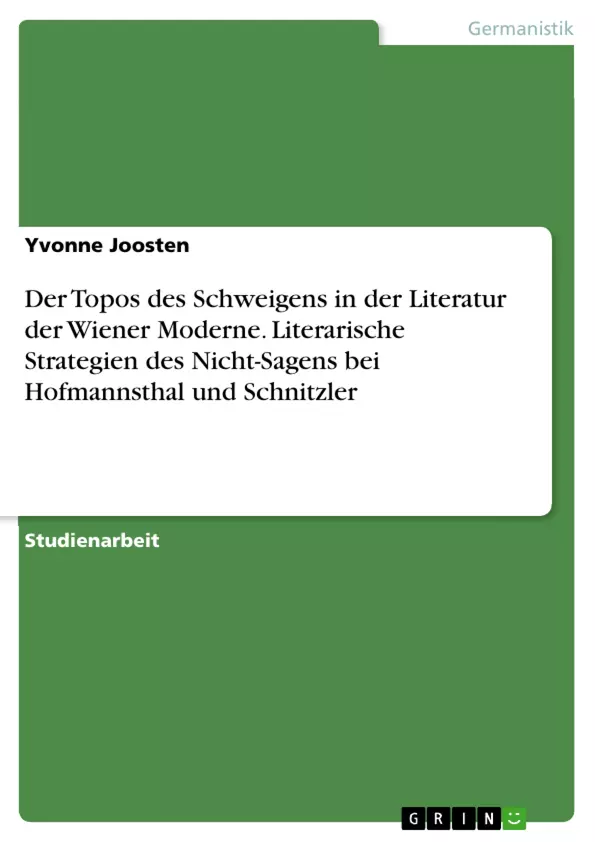Die Auseinandersetzung mit dem Schweigen gilt als charakteristisch für die Literatur der Wiener Moderne. Über das Schweigen wird unter anderem Protest, Rückzug und Individuation ausgedrückt, aber auch die Suche nach einer Erneuerung der Sprache kenntlich gemacht. Die Gründe dafür sind vielfältig, und auch die Umsetzung des Schweigens in der Literatur geschieht auf höchst unterschiedliche Weise.
Die Arbeit geht deshalb zuerst auf die Ursachen dieser Entwicklung ein, um anschließend die expliziten und impliziten Manifestationen des literarischen Schweigens dieser Zeit zu betrachten. Anhand des Chandos-Briefes und des Lustspiels „Der Schwierige“ von Hugo von Hofmannsthal sowie des Romans „Therese“ von Arthur Schnitzler wird die Bedeutung des Schweigens in der Literatur der Wiener Moderne untersucht. Dabei wird versucht darzustellen, worin sich die darin zeigenden Schweigeformen unterscheiden und was sie in der erzählten Welt bewirken, indem unter anderem folgende Fragen an den Text gestellt werden: Welche Figuren schweigen, und wer wird mit dem Schweigen konfrontiert? Um welche Schweigeform handelt es sich, und welche Auswirkungen hat sie auf den Verlauf der Handlung? Darüber hinaus wird auf das Schweigen als sprachliche Erscheinung eingegangen, also erörtert, mit welchen Markierern die Schweigestellen verdeutlicht werden und wie sich ihre sprachlichen Aussagen erschließen lassen.
Um den Terminus des literarischen Schweigens näher zu definieren und seine Charakteristika wie Grenzen aufzuzeigen, sind dem Hauptteil die Kapitel „Schweigen und Sprache“ sowie „Schweigen in der Literatur“ vorangestellt. Im ersten Kapitel werden kurz die kommunikativen Aspekte des „Nicht-Redens“ umrissen, im zweiten die Manifestationsformen und Bedeutungsspektren des literarischen Schweigens behandelt. Beide Kapitel bilden zusammen mit der Darstellung der kulturell-politischen Einflüsse auf die Dichter der Wiener Moderne die Grundlage für die Analysen, in denen der Versuch unternommen wird, diejenigen der vielfältigen Erscheinungsweisen des literarischen Schweigens, die programmatisch für die Wiener Moderne sind, aufzuzeigen und ihre textstrategische Funktion zu beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Topos des Schweigens in seiner rhetorischen Beschaffenheit und poetischen Funktion
- Sprechen und Schweigen
- Literarisches Schweigen
- Das Schweigen in der Literatur der Wiener Moderne
- Literarische Strategien des Schweigens bei Hofmannsthal und Schnitzler
- Hofmannsthal: Ein Brief
- Hofmannsthal: Der Schwierige. Lustspiel in drei Akten
- Schnitzler: Therese. Chronik eines Frauenlebens
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung des Schweigens in der Literatur der Wiener Moderne, insbesondere bei Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie das Schweigen als literarische Strategie eingesetzt wird, um individuelle und gesellschaftliche Konflikte, sowie die Suche nach Erneuerung der Sprache auszudrücken.
- Das Schweigen als Ausdruck von Protest, Rückzug und Individuation
- Die literarischen Strategien des Schweigens bei Hofmannsthal und Schnitzler
- Die unterschiedlichen Schweigeformen und ihre Auswirkungen auf die erzählte Welt
- Die sprachliche Verdeutlichung von Schweigestellen und ihre Interpretation
- Der Einfluss des Schweigens auf die Entwicklung der Sprache in der Wiener Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „Schweigen in der Literatur der Wiener Moderne“ ein und erläutert die Relevanz der Thematik, die Forschungslücken und die Fragestellungen der Arbeit.
- Der Topos des Schweigens in seiner rhetorischen Beschaffenheit und poetischen Funktion: Dieses Kapitel beleuchtet die kommunikativen Aspekte des „Nicht-Redens“ und diskutiert die Manifestationsformen und Bedeutungsspektren des literarischen Schweigens.
- Das Schweigen in der Literatur der Wiener Moderne: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Bedeutung des Schweigens in der Literatur der Wiener Moderne und die Gründe für seine Präsenz.
- Literarische Strategien des Schweigens bei Hofmannsthal und Schnitzler: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung des Schweigens in den Werken von Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler. Es untersucht die verschiedenen Schweigeformen, ihre Auswirkungen auf die Handlung und die Figuren, sowie die sprachliche Darstellung des Schweigens.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Wiener Moderne, dem Schweigen als literarische Strategie, der Sprachkritik und den Werken von Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind dabei: Schweigen, Sprechen, Kommunikation, Literatur, Wiener Moderne, Hofmannsthal, Schnitzler, Sprachkritik, Rhetorik, Poetik, Textanalyse.
- Quote paper
- Yvonne Joosten (Author), 2015, Der Topos des Schweigens in der Literatur der Wiener Moderne. Literarische Strategien des Nicht-Sagens bei Hofmannsthal und Schnitzler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957926