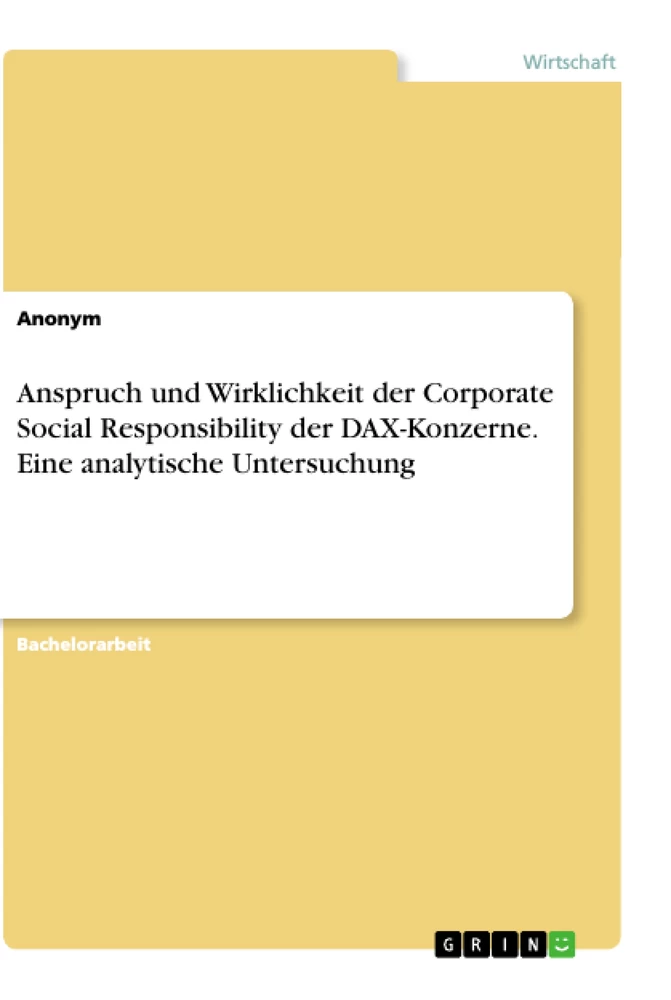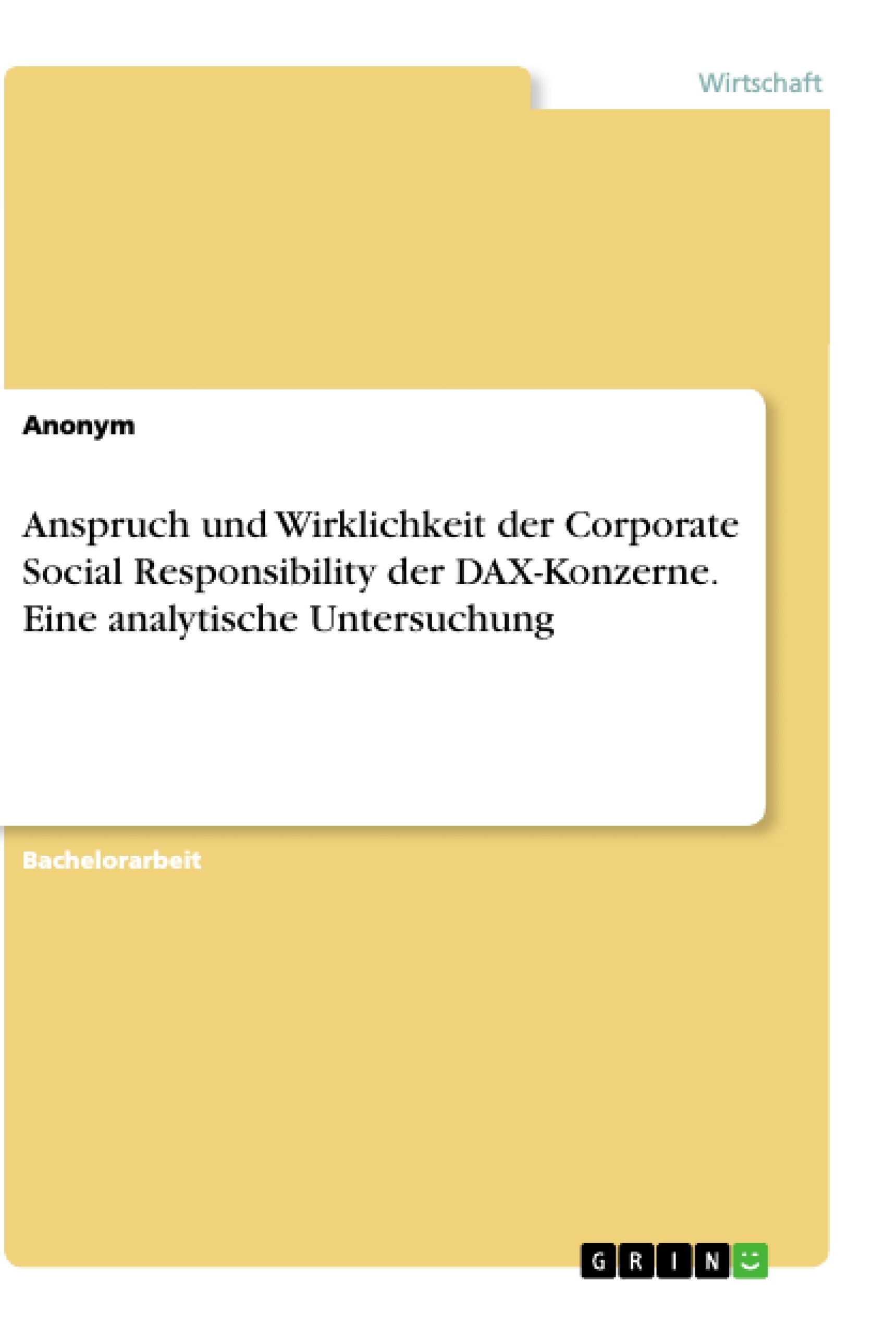Ob sich durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung, als CSR-Instrument und Anspruch der EU und des deutschen Gesetzgebers eine der Realität entsprechende und systematische Auseinandersetzung mit der Corporate Social Responsibility in den DAX-30 etabliert hat oder das CSR-Engagement als ein Mittel zur Imagepflege zu verstehen ist, ist das zentrale Thema dieser Arbeit.
Um dem Ziel näherzukommen, wird im Folgenden ein Einblick in das CSR-Engagements der DAX-Konzerne, anhand ihrer im Nachhaltigkeitsbericht präsentierten Selbstdarstellung vermittelt.
Hierbei soll dem Leser in dem ersten Teil der Arbeit ein Zugang zu dem CSR-Konzept und seinen Gütekriterien ermöglicht werden. Die wichtigsten CSR-Rahmenwerke, die Stakeholderorientierung und die Multidimensionalität der CSR stehen dabei im Vordergrund. Es folgt eine rechtliche Einordnung des Themas, anhand der CSR-Richtlinie und des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes. Damit wird eine Einführung in das CSR-Instrument, der Nachhaltigkeitsberichterstattung, vermittelt und zugleich ein Verständnis für die Wichtigkeit derselben entwickelt.
Der zweite Teil der Arbeit ist darauf konzentriert, einen Einblick in die Praxis zu vermitteln. Die zwei wichtigsten Rahmenwerke zu der Nachhaltigkeitsberichterstattung werden erläutert, um den Vergleich und die Analyse der Berichterstattungen der DAX-30 verständlich zu machen. Das CSR-Instrument, Nachhaltigkeitsberichterstattung, ist besonders gut dafür geeignet, die Ansprüche und die Realität der CSR-Tätigkeiten der DAX-30 herauszustellen. Die geprüften Kriterien werden dabei als Ansprüche an die Nachhaltigkeitsberichte, und damit übertragend auch an die CSR-Tätigkeiten eines Unternehmens verstanden. Die aus der Analyse hervorgehenden Ergebnisse stellen folglich einen Einblick in die Realität des CSR-Engagements der DAX-30 dar. Gute und schlechte Beispiele werden hierbei, anhand von drei Beispielvergleichen des Best- und Worst-In-Class hervorgehoben, um dem Leser ein praxisnahes Bild vermitteln zu können. Zuletzt ist eine kritische Stellungnahme erforderlich, um sowohl eine eigene als auch die Meinung von Dritten in der Betrachtung, wie realitätsnah das Bild der DAX-Konzerne ist, zu würdigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas
- 1.2 Ziel und Gang der Arbeit
- 1.3 Begriffserläuterungen
- 2. CSR-Grundlagen
- 2.1 Grundsätze und Leitlinien als Maßstab für CSR in Deutschland
- 2.2 Das stakeholderorientierte Konzept der CSR
- 2.3 CSR als multidimensionales Gebilde
- 3. Die CSR-Richtlinie und das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz - CSR-Engagement wird zu einer Pflicht
- 3.1 Die Corporate Social Responsibility Richtlinie - Richtlinie 2014/95/EU
- 3.2 Umsetzung der CSR-Richtlinie 2014/95/EU in deutsches Recht
- 3.3 Umsetzung der nichtfinanziellen Berichterstattung gem. CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz in die Praxis - Erste empirische Befunde
- 4. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung als Instrument der CSR-Kommunikation
- 5. Analyse und Ranking der Nachhaltigkeitsberichterstattung der DAX-30
- 5.1 Vorgehen und Bewertungsmethode
- 5.2 Kriterien und Bewertung
- 5.3 Ergebnisse des Rankings der Nachhaltigkeitsberichte der DAX-30
- 5.3.1 Nachhaltigkeitsberichtsvergleich MTU Aero Engines AG und RWE AG
- 5.3.2 Nachhaltigkeitsberichtsvergleich BMW AG und Fresenius SE & CO. KGaA und Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- 5.3.3 Nachhaltigkeitsberichtsvergleich Bayer AG und Covestro AG
- 6. Kritische Würdigung der zentralen Erkenntnisse
- 6.1 Mangelnde Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung beeinträchtigt Bewertung des CSR-Engagements
- 6.2 Steigende Motivation der DAX-Konzerne für Corporate Social Responsibility
- 7. Zusammenfassendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Thesis untersucht den Anspruch und die Wirklichkeit der Corporate Social Responsibility (CSR) der DAX-Konzerne. Ziel ist es, die Umsetzung von CSR-Prinzipien in der Praxis anhand der Nachhaltigkeitsberichterstattung der DAX-Unternehmen zu analysieren und zu bewerten. Dabei wird die Entwicklung der CSR-Regulierung in Deutschland und die Bedeutung der Nachhaltigkeitsberichterstattung als Instrument der CSR-Kommunikation beleuchtet.
- Entwicklung der CSR-Regulierung in Deutschland
- Analyse der Nachhaltigkeitsberichterstattung der DAX-Konzerne
- Bewertung der CSR-Performance der DAX-Unternehmen
- Bedeutung der Stakeholder-Perspektive im Kontext von CSR
- Herausforderungen und Chancen der CSR-Implementierung in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert die Problemstellung und Relevanz der CSR für DAX-Konzerne. Kapitel zwei beleuchtet die theoretischen Grundlagen von CSR, insbesondere die Grundsätze und Leitlinien sowie das stakeholderorientierte Konzept. Kapitel drei befasst sich mit der CSR-Richtlinie und dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, die CSR-Engagement zu einer Pflicht machen. Kapitel vier untersucht die Nachhaltigkeitsberichterstattung als Instrument der CSR-Kommunikation. Kapitel fünf analysiert und rankt die Nachhaltigkeitsberichte der DAX-30-Unternehmen anhand definierter Kriterien. Kapitel sechs bietet eine kritische Würdigung der zentralen Erkenntnisse, unter anderem die mangelnde Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility (CSR), Nachhaltigkeitsberichterstattung, DAX-Konzerne, Stakeholder, Stakeholder-Engagement, CSR-Richtlinie, CSR-Umsetzungsgesetz, Nachhaltigkeitsperformance, Vergleichbarkeit, Ranking, Regulierung, Non-Financial Reporting.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Untersuchung zur Corporate Social Responsibility (CSR)?
Ziel ist es, die Umsetzung von CSR-Prinzipien bei DAX-Konzernen zu analysieren und zu prüfen, ob die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Realität entspricht oder primär der Imagepflege dient.
Welche rechtlichen Grundlagen werden für die CSR-Pflicht herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf die EU-Richtlinie 2014/95/EU sowie deren Umsetzung in deutsches Recht durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz.
Was bedeutet Stakeholderorientierung im Kontext von CSR?
Stakeholderorientierung bedeutet, dass ein Unternehmen die Interessen aller relevanten Anspruchsgruppen (wie Mitarbeiter, Kunden, Umweltverbände) in sein Handeln und seine Berichterstattung einbezieht.
Warum wird die mangelnde Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichte kritisiert?
Unterschiedliche Rahmenwerke und Darstellungsformen erschweren es, das tatsächliche CSR-Engagement verschiedener DAX-Konzerne objektiv miteinander zu vergleichen und zu bewerten.
Welche Unternehmen werden in den Beispielvergleichen der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit vergleicht unter anderem die Nachhaltigkeitsberichte der MTU Aero Engines AG mit der RWE AG, sowie die der BMW AG mit Fresenius und der Bayer AG mit Covestro.
Was ist ein CSR-Ranking?
In einem CSR-Ranking werden Unternehmen anhand definierter Nachhaltigkeitskriterien bewertet und in eine Rangfolge gebracht, um "Best-in-Class"-Beispiele hervorzuheben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Anspruch und Wirklichkeit der Corporate Social Responsibility der DAX-Konzerne. Eine analytische Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957971