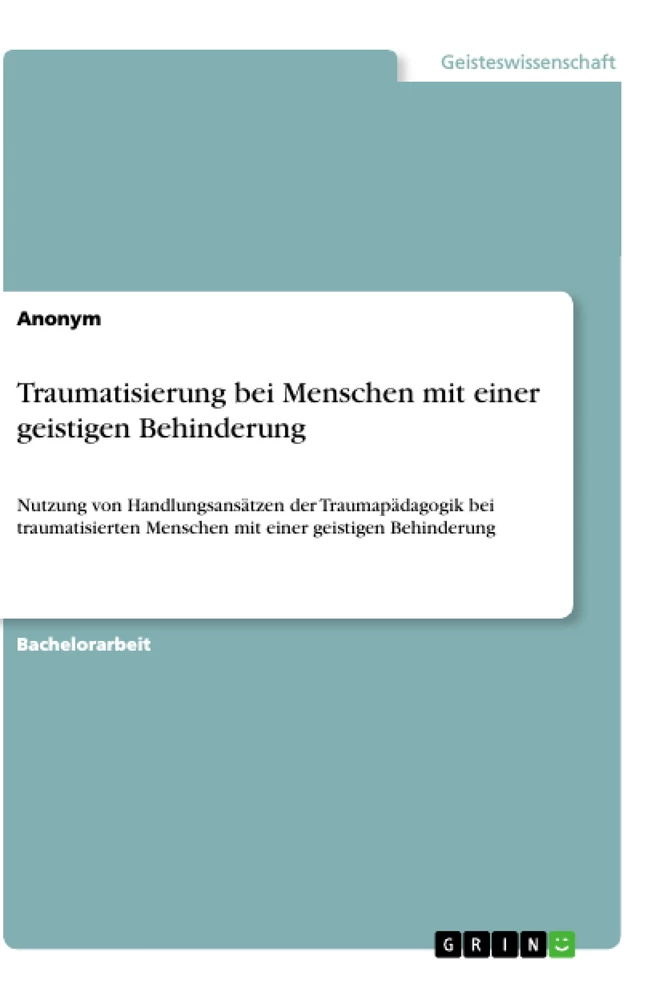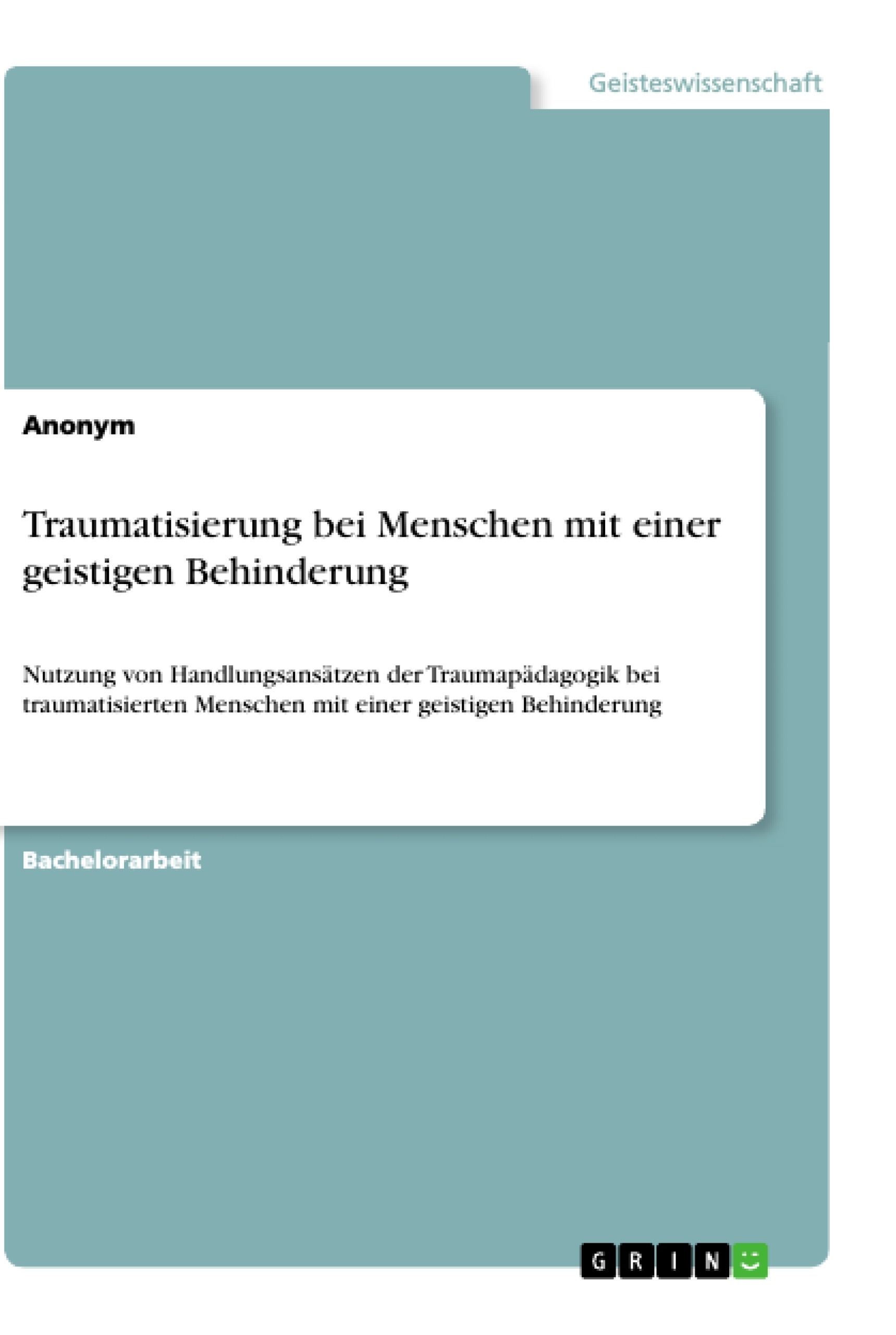Diese Arbeit widmet sich Traumatisierungen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Es stellt sich die Frage, inwieweit Fachkräfte der Sozialen Arbeit Handlungsansätze der Traumapädagogik bei traumatisierten Menschen mit einer geistigen Behinderung nutzen und perspektivisch gestalten können. Um sich der Thematik von Traumatisierungen zu nähern, werden zunächst die Grundlagen der Psychotraumatologie erläutert. Dies beinhaltet die Definition eines Traumas, genauso wie dessen Verlauf und mögliche Risiko- und Schutzfaktoren. In einem zweiten Teil werden dann verschiedene Traumafolgestörungen benannt und kurz beschrieben.
Nach wie vor beschäftigt sich die Wissenschaft viel zu wenig mit Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen dieser Klientel, obwohl nachgewiesen ist, dass bei ihnen ein erhöhtes Risiko besteht, Traumata zu erleiden und Folgeerscheinungen zu entwickeln. Die mangelnde und zum Teil noch komplett fehlende Auseinandersetzung von Traumata bei Menschen mit einer Behinderung findet sich auch innerhalb von Tätigkeitsfeldern der Profession der Sozialen Arbeit wieder. Traumafolgestörungen bleiben in der alltäglichen Arbeit in Einrichtungen der Behindertenhilfe noch viel zu häufig unerkannt und dadurch auch unbehandelt.
Dies kann mitunter auf fehlende Mitteilungsmöglichkeiten der betroffenen Personen sowie auf mangelnde psychotraumatologische Kenntnisse der Sozialarbeiter*innen zurückgeführt werden, die auffällige Verhaltensweisen zumeist dem Behinderungsbild zuordnen und erst bei extremen Veränderungen aufmerksam werden. Trauma und geistige Behinderung stehen in der Fachpraxis noch zu wenig in Verbindung. Vorhandene pädagogische Konzepte richten sich demnach nicht an mögliche Traumatisierungen und reichen in der Folge nicht aus, um geeignete Unterstützungsmaßnahmen für die Traumabewältigung darzustellen. Für die Arbeit mit traumatisierten Menschen hat sich in den letzten Jahren eine neue Fachdisziplin mit einem traumapädagogischen Ansatz entwickelt. Die Traumapädagogik bietet Richtlinien und Handlungsstrategien für eine pädagogische Unterstützung im Traumabewältigungsprozess. Traumapädagogische Konzepte richteten sich zunächst vornehmlich an die Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen, öffnen sich aber immer mehr auch anderen Arbeitsbereichen der Sozialen Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychotraumatologie
- Das Trauma
- Verlauf einer Traumatisierung
- Risiko- und Schutzfaktoren
- Traumafolgestörungen
- Akute Belastungsreaktion
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung
- Komorbiditäten
- Das Trauma
- Begriffsbestimmung geistige Behinderung
- Traumatisierung und geistige Behinderung
- Risikofaktoren
- Personale Risikofaktoren
- Umweltbedingte Risikofaktoren
- Diagnostik
- Konsequenzen für die Soziale Arbeit
- Risikofaktoren
- Traumapädagogik in der Sozialen Arbeit
- Traumapädagogische Grundhaltung
- Sichere Orte
- Selbstbemächtigung
- Bindungsorientierung
- Ressourcenorientierung
- Bedeutung von Traumapädagogik für die Traumabearbeitung
- Traumapädagogik und geistige Behinderung
- Anwendbarkeit und Grenzen
- Aspekte für die traumapädagogische Begleitung
- Ausblick
- Anwendbarkeit und Grenzen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich Traumatisierungen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung und untersucht, inwieweit Fachkräfte der Sozialen Arbeit Handlungsansätze der Traumapädagogik bei dieser Klientel nutzen und perspektivisch gestalten können.
- Die Grundlagen der Psychotraumatologie, einschließlich der Definition eines Traumas, dessen Verlauf und möglicher Risiko- und Schutzfaktoren.
- Die verschiedenen Traumafolgestörungen und deren Auswirkungen.
- Die spezifischen Risikofaktoren für Traumatisierungen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, sowohl im persönlichen Bereich als auch im sozialen Umfeld.
- Die Anwendbarkeit und Grenzen der Traumapädagogik im Kontext der geistigen Behinderung.
- Handlungsmöglichkeiten und Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Umgang mit traumatisierten Menschen mit einer geistigen Behinderung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel skizziert die Bedeutung des Themas Traumatisierung bei Menschen mit geistiger Behinderung und stellt die Relevanz der Traumapädagogik für die Soziale Arbeit heraus.
- Psychotraumatologie: Dieses Kapitel liefert eine grundlegende Einführung in die Psychotraumatologie, beleuchtet die Definition eines Traumas, seinen Verlauf und die relevanten Risiko- und Schutzfaktoren.
- Begriffsbestimmung geistige Behinderung: Dieses Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs "geistige Behinderung" und setzt den Fokus auf die Bedeutung von Inklusion und Empowerment in der Arbeit mit dieser Klientel.
- Traumatisierung und geistige Behinderung: Hier werden Risikofaktoren für Traumatisierungen bei Menschen mit geistiger Behinderung, sowohl auf individueller Ebene als auch im sozialen Umfeld, analysiert.
- Traumapädagogik in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel stellt die traumapädagogischen Grundhaltungen, Methoden und Konzepte vor und erklärt die Bedeutung der Traumapädagogik für die Traumabearbeitung.
- Traumapädagogik und geistige Behinderung: Dieses Kapitel analysiert die Anwendbarkeit und Grenzen der Traumapädagogik im Kontext der geistigen Behinderung und zeigt Handlungsmöglichkeiten sowie Herausforderungen auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Traumatisierung, geistige Behinderung, Psychotraumatologie, Traumapädagogik, Soziale Arbeit, Inklusion, Empowerment, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Traumafolgestörungen, Diagnostik, Handlungsmöglichkeiten und Grenzen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Traumatisierung bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958001