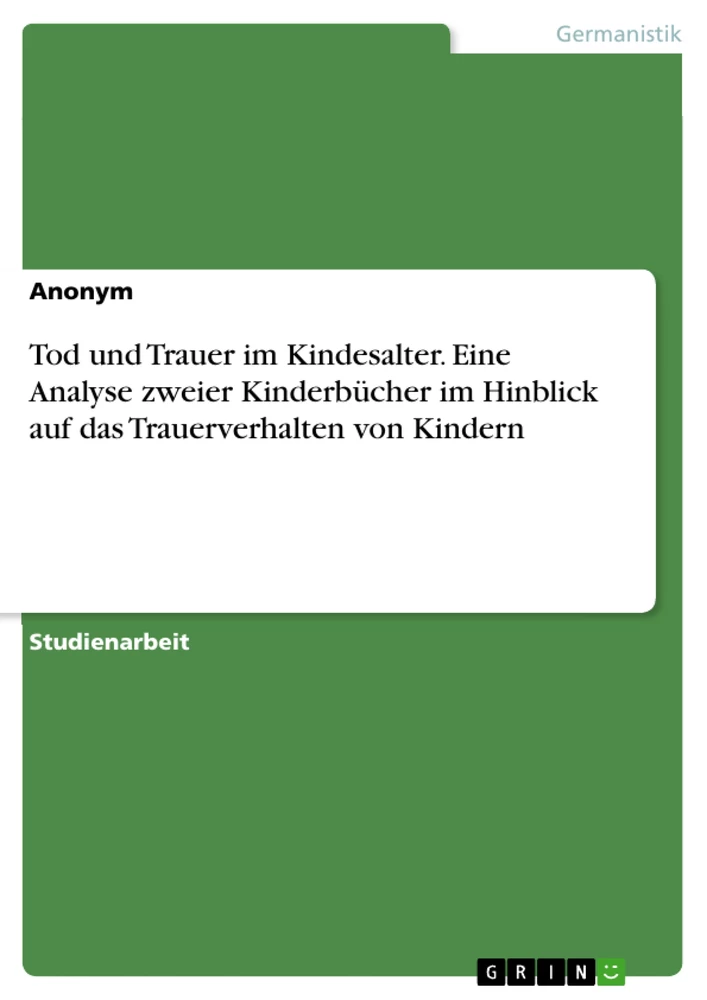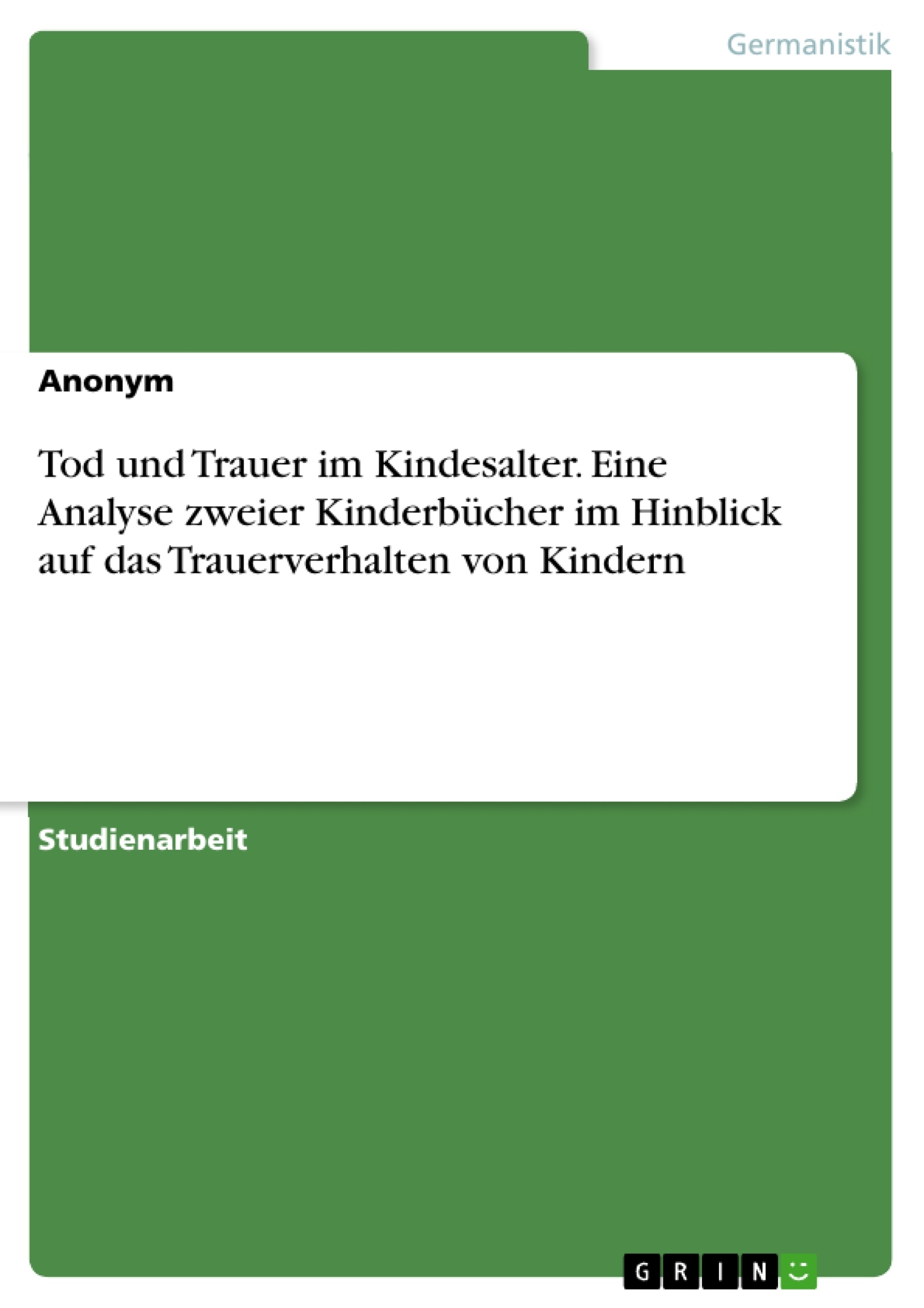Inwieweit unterscheidet sich sich das Trauerverhalten von Kindern im Vergleich zu dem eines Erwachsenen? Nehmen Kinder die Intensität eines Todesfalls ähnlich und genauso stark wahr, wie eine erwachsene Person? Besitzen Kinder bereits im jungen Alter eine genaue Vorstellung vom Tod und inwieweit verändert sich im Laufe des Wachstumsprozesses die Sicht auf das Thema?
Folglich um diese Fragen zu beantworten, wird zu Beginn der Hausarbeit auf die Definition und auf die Begrifflichkeit von Trauer eingegangen. Anschließend folgen die vier Phasen der Trauerreaktion bei Kindern, gefolgt von dem Trauerverhalten von Kindern und Erwachsenen. Danach werden die Vorstellungen des Todes in verschieden Altersklassen vorgestellt. Schließlich folgt eine Analyse zweier Kinderbücher, die das Thema Tod und Trauer auf unterschiedliche Weise thematisieren, unter Berücksichtigung der Kriterien zur Untersuchung von Kinderbüchern von Martina Plieth. Abschließend wird im Fazit ein Vergleich der beiden Bücher vorgenommen, mit besonderem Hinblick auf die unterschiedlichen Wege zur Vermittlung des Todes. Ebenfalls folgt die Beantwortung der Fragen hinsichtlich des Themas.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Trauer?
- Trauerreaktion beim Kind
- Das Trauerverhalten von Kindern und Erwachsenen nach Bowlby
- Todesvorstellungen von Kindern
- Kriterien nach Martina Plieth
- „Für immer“
- ,,Und was kommt dann?"
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Tod im Kindesalter und analysiert die verschiedenen Aspekte von Trauer und Tod aus psychologischer und pädagogischer Perspektive. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Kinder den Tod verstehen, welche Reaktionen sie auf den Verlust eines geliebten Menschen zeigen und wie sie mit diesem Thema umgehen können.
- Definition und Begrifflichkeit von Trauer
- Trauerreaktion beim Kind nach Bowlby
- Vergleich des Trauerverhaltens von Kindern und Erwachsenen
- Todesvorstellungen von Kindern in verschiedenen Altersstufen
- Analyse von Kinderbüchern zum Thema Tod und Trauer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik Tod im Kindesalter ein und erläutert die Relevanz des Themas für die pädagogische Praxis. Kapitel 2 beleuchtet die verschiedenen Aspekte von Trauer, einschließlich der Definition des Begriffs, der individuellen Reaktionen auf Verlust und der besonderen Herausforderungen für Kinder. Kapitel 2.1 beschreibt das vierphasige Modell der Trauerreaktion bei Kindern nach Bowlby, während Kapitel 2.2 die Unterschiede im Trauerverhalten von Kindern und Erwachsenen im Detail darstellt. Kapitel 2.3 beschäftigt sich mit der Entwicklung der Todesvorstellungen von Kindern in verschiedenen Altersgruppen. Die weiteren Kapitel analysieren Kinderbücher, die den Tod und Trauer auf unterschiedliche Weise behandeln, und diskutieren die pädagogischen Implikationen dieser literarischen Werke.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert sich auf folgende Schlüsselbegriffe: Tod, Trauer, Kind, Trauerverhalten, Todesvorstellungen, Kinderbuch, pädagogische Implikationen, Bowlby, Kübler-Ross, Plieth. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Aspekte des Themas Tod und Trauer, betrachtet die Entwicklung der Todesvorstellungen von Kindern und analysiert, wie pädagogische Ansätze das Verständnis und den Umgang mit Verlust im Kindesalter fördern können.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Tod und Trauer im Kindesalter. Eine Analyse zweier Kinderbücher im Hinblick auf das Trauerverhalten von Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958024